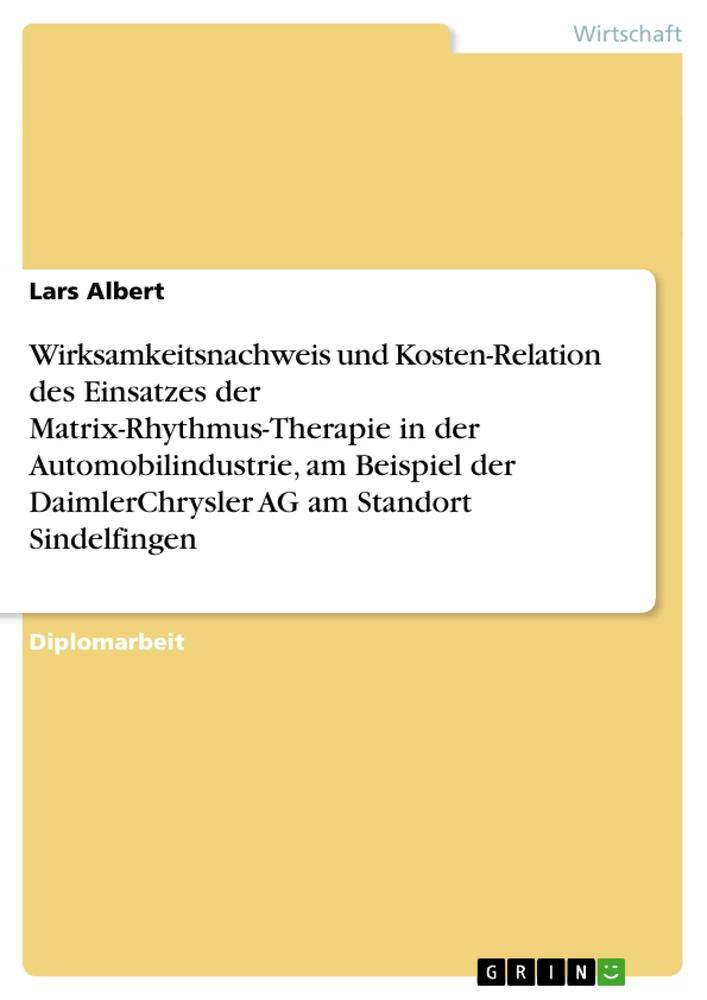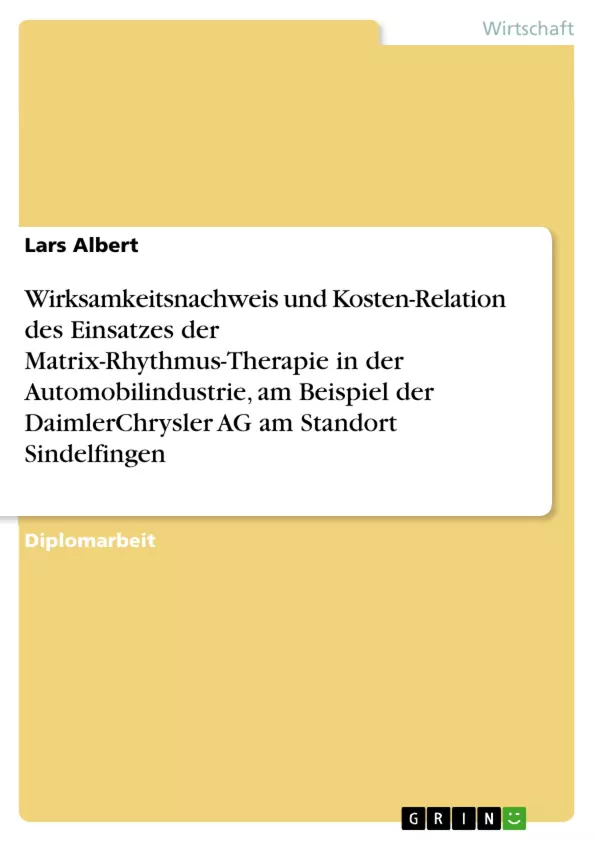„Ein gesundes Unternehmen braucht gesunde Mitarbeiter!“1- dieses vielfach verwendete Zitat ist unstrittig für alle Wirtschaftszweige zutreffend. In einer sowohl sehr arbeits- als auch produktionsintensiven Branche wie der Automobilindustrie gewinnt dieser Fakt noch größere Bedeutung. Nur die Unternehmen, welche über eine leistungsfähige, motivierte und produktive Belegschaft verfügen, werden sich dauerhaft Wettbewerbsvorteile sichern können.
Die vorliegende Diplomarbeit setzt sich mit einer Analyse auseinander, in welcher der Nutzen des Einsatzes eines relativ neuen physiotherapeutischen Behandlungsverfahrens, der sog. „Matrix-Rhythmus-Therapie“ für das Unternehmen und die Mitarbeiter innerhalb der DaimlerChrysler AG untersucht wurde. Die Arbeit betrachtet dabei u. a. im Rahmen einer Evaluation mittels Fragebögen eines Projektes der betrieblichen Gesundheitsförderung in der Automobilindustrie die Kosten und den evtl. daraus resultierenden Nutzen für das Unternehmen und gibt Empfehlungen für den weiteren Ausbau und der Effektivitätssteigerung dieser Form des Gesundheitsmanagements im Unternehmen. Neben einer humanitären Zielsetzung zur Gesunderhaltung der Physis und Psyche des Individuums (hier: des Arbeitnehmers) müssen solche Maßnahmen des Arbeitgebers im Rahmen unternehmerischer Entscheidungen zur kostenminimalen
Gestaltung der Produktion beitragen. Um ein möglichst gutes Unternehmensergebnis zu erreichen, müssen alle Ressourcen optimal genutzt werden. Für das Unternehmen ist daher entscheidend, dass Investitionen in eine solche Maßnahme mehr Nutzen als Kosten verursachen. Damit rückt im unternehmerischen Umfeld auch das Kosten-Nutzen-Verhältnis von betrieblicher Gesundheitsförderung in den Mittelpunkt. Nur jene Aktionen, die effektiv die Gesundheitsprozesse verbessern und dem Unternehmen, welches die Maßnahmen finanziert, eine positive Relation liefern, haben eine Chance, auf Dauer durchgeführt zu werden. Die Auswertung des neuen Verfahrens mitsamt seinem Behandlungsprozess, sowie dieses positive Verhältnis zu belegen bzw. zur Weiterentwicklung der entsprechenden Maßnahmen beizutragen, ist Aufgabe der Arbeit und der Evaluation.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- ,,Aging workforce" - Alternde Belegschaft und Demographie im Wandel
- Die DaimlerChrysler AG
- Der Gesamtkonzern
- Das Werk Sindelfingen
- Historie
- Gegenwart
- Der Werksärztliche Dienst am Standort Sindelfingen
- Die Sitzfertigung
- Analyse des Krankenstandes in der Bundesrepublik Deutschland
- Begriffsklärung
- Allgemeine Entwicklung der Arbeitsunfähigkeitszeiten in den letzten Jahren
- Entwicklung in der deutschen Automobilindustrie
- Bei den Hauptwettbewerbern
- Bei der DaimlerChrysler AG
- Am Standort Deutschland
- Im Werk Sindelfingen
- In der Abteilung BC/ATS
- Das betriebliche Gesundheitsmanagement
- Definition und Zielstellung
- Betriebliche Fehlzeiten
- Auswirkung von Fehlzeiten
- Ursachen von Fehlzeiten
- Außerbetriebliche Einflüsse
- Innerbetriebliche Einflüsse
- Maßnahmen zur Fehlzeitenreduktion
- Modellbeispiel
- Das Pilotprojekt
- Allgemeines
- Beschreibung
- Arbeitsmedizinischer Aspekt
- Ablauf
- Einführung und Überblick zur Thematik der Matrix-Rhythmus-Therapie
- Physiologischer Hintergrund
- Rhythmus
- Das Gerät
- Erzielbare Effekte
- Kosten
- Wissenschaftliche Grundlagen
- Die Matrix-Rhythmus-Therapie als neues innovatives Behandlungsverfahren
- Der Aufbau des Fragebogens
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Wirksamkeit und Kostenrelation des Einsatzes der Matrix-Rhythmus-Therapie (MRT) in der Automobilindustrie, am Beispiel der DaimlerChrysler AG am Standort Sindelfingen. Sie untersucht die MRT als potenzielles Instrument zur Reduzierung von Fehlzeiten und zur Steigerung der Mitarbeitergesundheit in einem industriellen Kontext.
- Analyse des Krankenstandes in der Automobilindustrie und bei der DaimlerChrysler AG
- Einführung des Konzepts des betrieblichen Gesundheitsmanagements und seine Relevanz für die Reduzierung von Fehlzeiten
- Beschreibung und wissenschaftliche Grundlagen der Matrix-Rhythmus-Therapie
- Durchführung eines Pilotprojekts zur Evaluierung der Wirksamkeit und Kostenrelation der MRT
- Bewertung der Ergebnisse und Ableitung von Handlungsempfehlungen für den Einsatz der MRT in der Automobilindustrie
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung - Die Einleitung führt in die Problemstellung ein und erläutert den Zusammenhang zwischen alternder Belegschaft, demografischem Wandel und dem wachsenden Bedarf an betrieblichem Gesundheitsmanagement in der Automobilindustrie.
- Kapitel 2: Die DaimlerChrysler AG - Dieses Kapitel stellt den Gesamtkonzern und das Werk Sindelfingen vor, wobei die Historie und Gegenwart des Werks beleuchtet werden. Zudem wird der Werksärztliche Dienst und die Sitzfertigung als Anwendungsbereich des Pilotprojekts vorgestellt.
- Kapitel 3: Analyse des Krankenstandes - Dieses Kapitel analysiert den Krankenstand in der Bundesrepublik Deutschland sowie in der Automobilindustrie, insbesondere bei der DaimlerChrysler AG am Standort Sindelfingen und in der Abteilung BC/ATS.
- Kapitel 4: Das betriebliche Gesundheitsmanagement - Dieses Kapitel definiert das betriebliche Gesundheitsmanagement und seine Zielstellung. Es beleuchtet die Auswirkungen und Ursachen von Fehlzeiten sowie verschiedene Maßnahmen zur Fehlzeitenreduktion.
- Kapitel 5: Das Pilotprojekt - Dieses Kapitel beschreibt das Pilotprojekt, das zur Evaluierung der Wirksamkeit und Kostenrelation der Matrix-Rhythmus-Therapie durchgeführt wurde. Es beinhaltet eine detaillierte Beschreibung der MRT, ihrer wissenschaftlichen Grundlagen sowie die Kosten und den Aufbau des Fragebogens.
Schlüsselwörter
Matrix-Rhythmus-Therapie, betriebliches Gesundheitsmanagement, Fehlzeiten, Automobilindustrie, DaimlerChrysler AG, Werk Sindelfingen, Sitzfertigung, Kostenrelation, Wirksamkeit, Pilotprojekt, wissenschaftliche Grundlagen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Matrix-Rhythmus-Therapie (MRT)?
Die Matrix-Rhythmus-Therapie ist ein innovatives physiotherapeutisches Behandlungsverfahren, das darauf abzielt, die natürliche Eigenschwingung der Körperzellen wiederherzustellen, um Heilungsprozesse zu fördern und Schmerzen zu lindern.
Welchen Nutzen hat die Matrix-Rhythmus-Therapie für Unternehmen?
Im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements kann die MRT dazu beitragen, den Krankenstand zu reduzieren, die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter zu erhalten und somit die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu sichern.
Wie wurde die Wirksamkeit der MRT bei DaimlerChrysler untersucht?
Die Untersuchung erfolgte im Rahmen eines Pilotprojekts am Standort Sindelfingen, bei dem die Wirksamkeit und die Kostenrelation der Therapie mittels Evaluation durch Fragebögen analysiert wurden.
Warum ist betriebliches Gesundheitsmanagement in der Automobilindustrie so wichtig?
Aufgrund der hohen Arbeits- und Produktionsintensität sowie einer alternden Belegschaft (Aging Workforce) ist die Gesunderhaltung der Mitarbeiter entscheidend für das Unternehmensergebnis.
Welche Rolle spielt das Kosten-Nutzen-Verhältnis bei Gesundheitsmaßnahmen?
Unternehmen investieren langfristig nur in Maßnahmen, die effektiv die Gesundheit verbessern und deren Nutzen die anfallenden Kosten übersteigt, um ein positives wirtschaftliches Ergebnis zu erzielen.
- Citation du texte
- Lars Albert (Auteur), 2006, Wirksamkeitsnachweis und Kosten-Relation des Einsatzes der Matrix-Rhythmus-Therapie in der Automobilindustrie, am Beispiel der DaimlerChrysler AG am Standort Sindelfingen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/55742