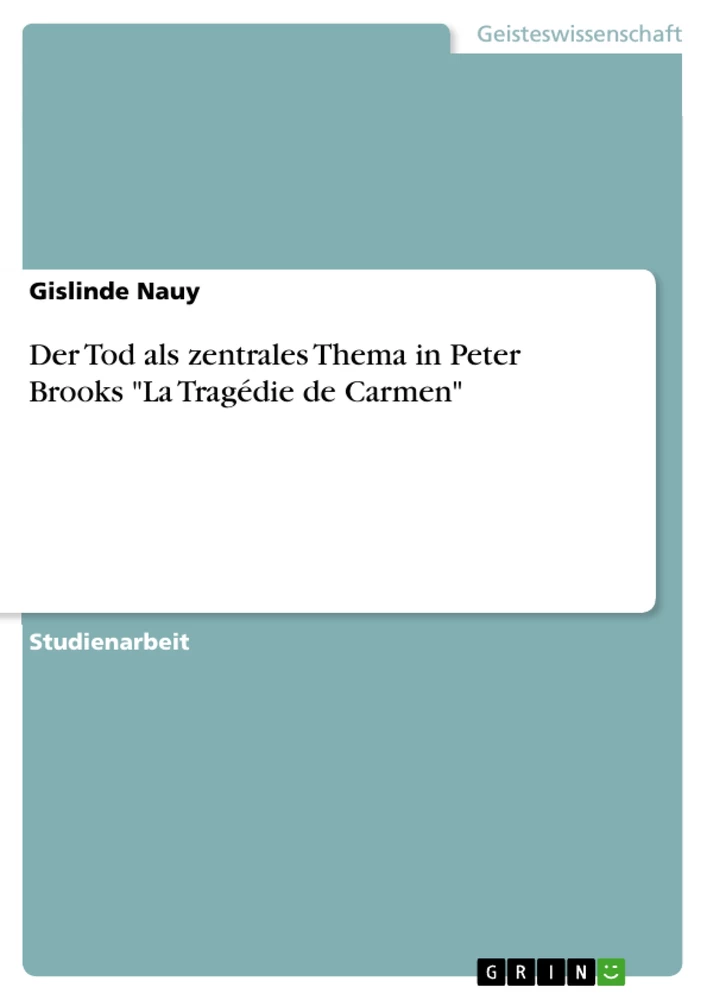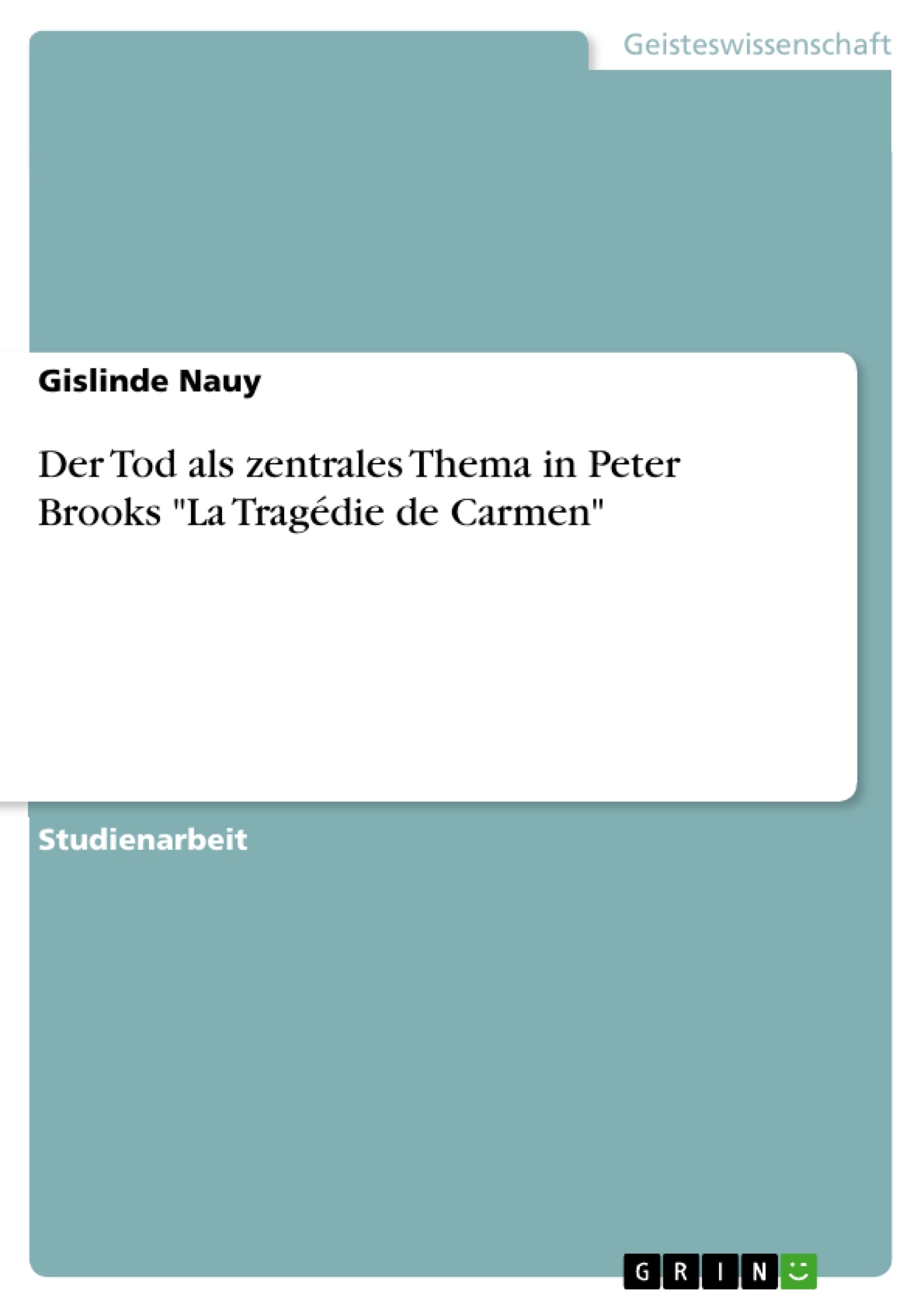Die Zigeunerin Carmen gilt als eine der schwer zu fassendsten Figuren der Operngeschichte. Obwohl Bizets Partitur sich auf den ersten Blick aus beschwingten, leicht zugänglichen Stücken zusammensetzt, sind die inneren Vorgänge der Titelfigur sehr undurchsichtig und nur sehr schwer zu verstehen. Carmens Handlungsweise wirkt unrealistisch, unlogisch und dadurch nicht nachvollziehbar: es fällt schwer, sich in sie hineinzuversetzen und ihre Gefühle nachzuempfinden. Man mag sie als flatterhafte, bunte und amüsierende Gestalt verstehen, doch einem tieferen Blick hält dieses Bild nicht Stand. Eine Inszenierung der „Carmen“ reicht in der Regel nicht, um Handlung und Titelfigur vollends zu erfassen. Es gab und gibt in Vergangenheit und Gegenwart die verschiedensten Ansätze, sich diesem Ziel zu nähern. Peter Brook hat dabei einen sehr eigenwilligen Weg eingeschlagen. Er entfernt sich von der Carmen als einem Massenereignis mit Chor, Statisten und großem Orchester. Er lässt weniger sehen und dafür mehr spüren, wobei er besonderen Wert auf eine individuelle und präzise Personenregie legt. Carmen und die anderen Hauptfiguren treten aus dem „Schutz“ einer menschenüberfüllten Bühne hervor, es gibt nichts mehr, wohinter sie sich verstecken könnten. Somit trifft der Operbesucher auf eine Carmen, die für sich steht - ohne Gesellschaft die sie umgibt, eine Carmen, die alleine mit sich ihre Tragödie erlebt bis zum bitteren Ende, und die gerade deshalb jeden ganz persönlich etwas angeht. Da in dieser Arbeit der Weg zur Analyse hauptsächlich über die Beschäftigung mit dem Theatertext und dessen Vorlage geht, ist die Vorgehensweise überwiegend die einer Transformationsanalyse.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Aufführungstext - Inszenierungstext
- Bizet und Mérimée
- Das Problem der Fassungen
- Brook-Bizet – Mérimée
- Beziehungen und Konflikte
- Der Tod
- Zuniga
- Garcia
- Escamillo
- Carmen
- Don José
- Fazit: Ist Brooks Carmen ein „Todesengel“?
- Carmens Einstellung zu Schicksal und Tod
- Der Ehrenkodex
- Was versteht Brook unter „Carmens Tragödie? “
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert Peter Brooks Inszenierung „La Tragédie de Carmen“ und untersucht, wie der Regisseur die Titelfigur und ihre Tragödie im Kontext von Bizets Musik und Mérimées Novelle interpretiert. Die Arbeit verfolgt das Ziel, die künstlerischen Entscheidungen Brooks in Bezug auf die Charakterisierung von Carmen, die Darstellung des Todes und die Bedeutung der Ehrenkodex im Stück zu analysieren.
- Die Transformation der Carmen-Figur von der Novelle zur Opernbühne und schließlich zu Brooks Inszenierung.
- Die Rolle des Todes in der Inszenierung und die Bedeutung der verschiedenen Todesfälle für die Charakterentwicklung und den Handlungsverlauf.
- Die Interpretation des Ehrenkodex in „La Tragédie de Carmen“ und seine Auswirkungen auf das Schicksal der Figuren.
- Die Inszenierungstechniken Brooks und seine individuelle Herangehensweise an die Umsetzung von Bizets Musik und Mérimées Text.
- Der Einfluss von Brooks Inszenierung auf das Verständnis der Carmen-Figur und ihrer Tragödie.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Carmen-Figur als eine der schwer zu fassenden Figuren der Operngeschichte vor und erläutert die Besonderheiten von Brooks Inszenierung. Kapitel 2 befasst sich mit dem Aufführungstext und dem Inszenierungstext von „La Tragédie de Carmen“ und analysiert die Unterschiede zwischen den verschiedenen Versionen der Oper. Kapitel 3 beleuchtet die Entstehung der Oper und die Beziehung zwischen Bizets Oper und Mérimées Novelle. Die folgenden Kapitel untersuchen die verschiedenen Beziehungen und Konflikte zwischen den Hauptfiguren, die Rolle des Todes in der Inszenierung und Carmens Einstellung zu Schicksal und Tod.
Schlüsselwörter
Peter Brook, La Tragédie de Carmen, Carmen, Bizet, Mérimée, Oper, Musiktheater, Inszenierung, Todesengel, Ehrenkodex, Tragödie, Transformationsanalyse.
- Citation du texte
- Gislinde Nauy (Auteur), 2005, Der Tod als zentrales Thema in Peter Brooks "La Tragédie de Carmen", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/55813