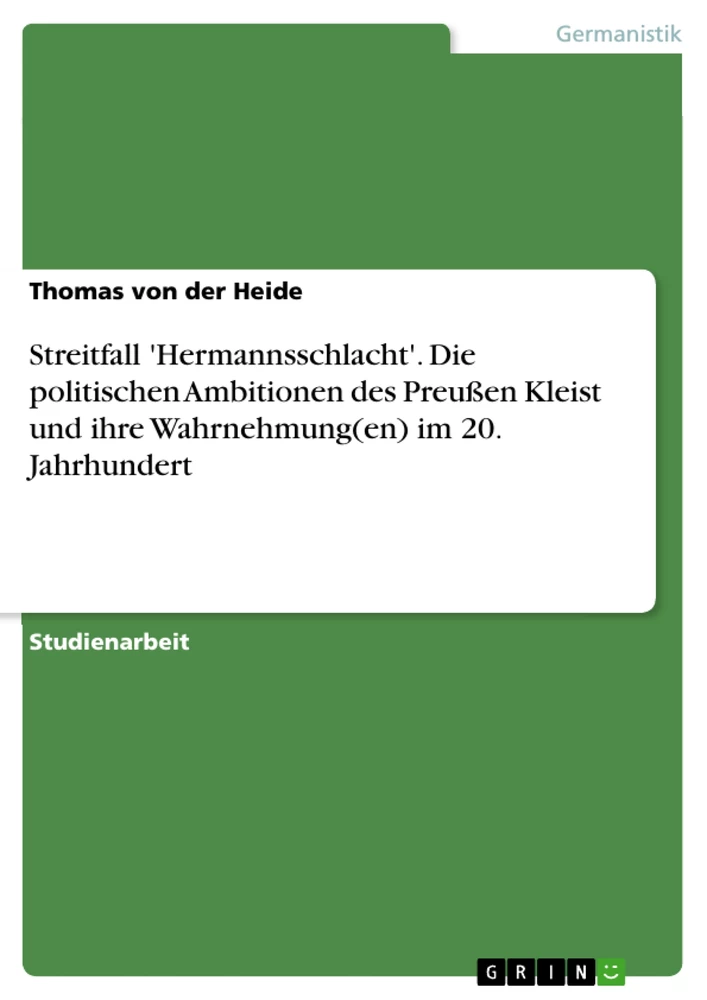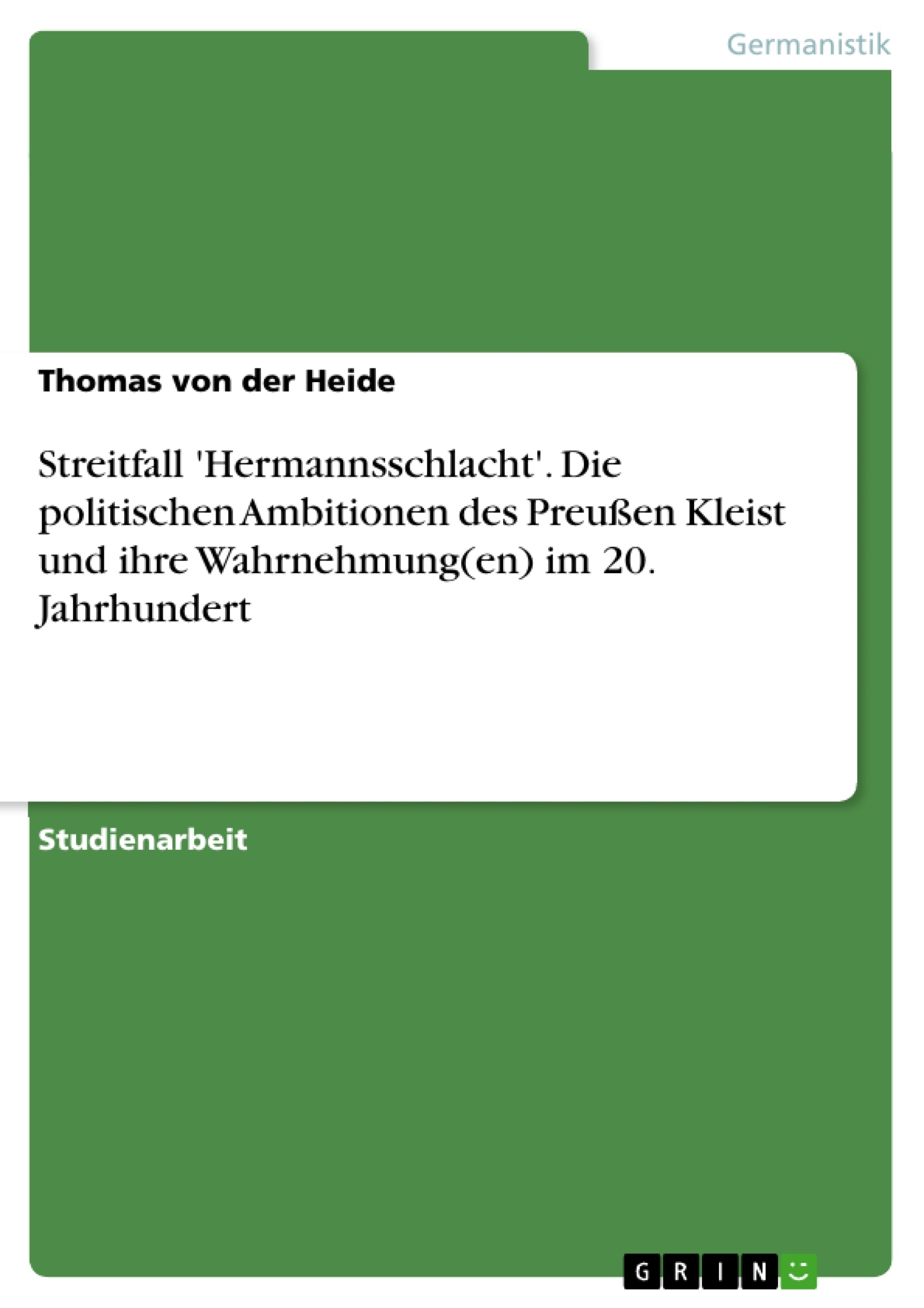Verfolgt man die nun gut zweihundert Jahre währende Rezeptionsgeschichte des literarischen Werks Heinrich von Kleists, so lässt sich kaum ein deutscher Autor nennen, dessen Schriften so kontrovers und gänzlich gegensätzlich gedeutet wurden wie die des preußischen Dichters. Vor dem Hintergrund verschiedener Epochen und im Kontext aus unterschiedlichsten gesellschaftlichen oder wissenschaftlichen Richtungen stammender Interpretationsansätze blickt die Kleist-Rezeption auf eine Geschichte voller radikaler Deutungen und sich gegenseitig widersprechender ideologischer Vereinnahmungen zurück. 1 Als beispielhaft für die in diesem Fall politischideologisch vollständig entgegengesetzten Deutungsansätze eines einzigen Kleistschen Werkes dient das Arminius-Drama ‚Die Hermannsschlacht’. Allein ein Blick auf den Rezeptionsverlauf des Stücks im 20. Jahrhundert offenbart zwei radikale Interpretationslinien, die für ihren jeweiligen zeitgenössischen Kontext zwar normbildenden Status genossen, sich zueinander allerdings, im Bezug auf Motivation und Ergebnis, völlig gegensätzlich verhalten: der rassistischen und imperialistischen Deutung des Dramas durch den nationalsozialistischen Kulturapparat steht eine marxistisch-humanistische Rezeption der Literaturwissenschaft im Umfeld der sogenannten 68’er-Revolte in Westdeutschland unversöhnlich gegenüber. 2 Diese im krassesten Gegensatz zueinander stehenden Ansätze sind Gegenstand der vorliegenden Hausarbeit. Sie sollen, voneinander unabhängig, in ihren Argumentationen und im Bezug auf potentielle ideologische Einflüsse nebeneinander dargestellt werden, um einen Überblick und einen Einblick in die jeweilige Rezeptionslinien zu gewährleisten. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitende Überlegungen
- Die politische Situation zur Entstehungszeit des Dramas
- Das Kriegskonzept der preußischen Reformer
- Vorbilder
- Frankreich
- Spanien
- Niederschlag in der, Hermannsschlacht'
- Ergebenheit an das große Ziel
- Propaganda
- Guerilla-Krieg
- Vorbilder
- Der Revanchegedanke
- Kleist und die Nationalsozialisten
- Das Arminiusdrama als propagandistisches Vorzeigestück
- Hermann als Führer
- Die gefühlsgeleitete Tat
- Imperialistische Drohung
- Kleist als Utopist
- Bestandsaufnahme
- Deutschland
- Napoleon
- Defensiver Krieg und größeres Ziel
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die politisch-ideologische Rezeption des Dramas „Die Hermannsschlacht“ von Heinrich von Kleist im 20. Jahrhundert. Sie untersucht, wie das Stück in verschiedenen gesellschaftlichen und politischen Kontexten gedeutet wurde und welche ideologischen Einflüsse sich auf die Rezeption ausgewirkt haben. Die Arbeit betrachtet dabei zwei gegensätzliche Interpretationsansätze: die nationalsozialistische und die marxistisch-humanistische Rezeption.
- Die Rezeption des Dramas im nationalsozialistischen Kontext
- Die Rezeption des Dramas im Kontext der 68'er-Revolte
- Die Analyse der hermeneutischen Qualität beider Rezeptionsansätze
- Die Frage nach der Übereinstimmung der Rezeption mit Kleists eigener Intention
- Die Rolle der „Hermannsschlacht“ als politisches Statement im Kontext der preußischen Reformbewegung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Kontroversen und gegensätzlichen Interpretationen in der Rezeptionsgeschichte von Kleists Werken beleuchtet. Dabei wird das Arminius-Drama „Die Hermannsschlacht“ als Beispiel für die radikale Spaltung in der Deutung eines einzigen Werks herangezogen. Anschließend wird die politische Situation zur Entstehungszeit des Dramas im Kontext der preußischen Reformbewegung und der Napoleonischen Kriege untersucht, um die Ambitionen und Ziele Kleists mit dem Drama zu beleuchten.
Das dritte Kapitel analysiert die nationalsozialistische Rezeption der „Hermannsschlacht“, die das Stück als propagandistisches Vorzeigestück zur Unterstützung des Revanchegedankens und der nationalsozialistischen Ideologie nutzte. Das vierte Kapitel befasst sich mit der humanistisch orientierten Rezeption des Dramas im Kontext der 68'er-Revolte, die Kleists Werk als Kritik an der preußischen Militärpolitik und als Plädoyer für eine humanistische Gesellschaftsordnung interpretierte. Die Arbeit schließt mit einem Vergleich der beiden Rezeptionsansätze und der Herausarbeitung neuer Probleme, die sich aus der Analyse ergeben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Rezeptionsgeschichte von Heinrich von Kleists „Die Hermannsschlacht“ im 20. Jahrhundert. Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Rezeption, Interpretation, nationalsozialistische Ideologie, marxistisch-humanistische Rezeption, Propaganda, preußische Reformbewegung, Napoleonische Kriege, Hermannsschlacht, Arminiusdrama.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Kleists 'Hermannsschlacht' so umstritten?
Das Drama wurde im 20. Jahrhundert extrem gegensätzlich interpretiert – einerseits als nationalsozialistisches Propagandastück, andererseits als marxistisch-humanistisches Werk.
Wie deuteten die Nationalsozialisten das Drama?
Sie sahen in Hermann den idealen "Führer" und nutzten das Stück zur Verherrlichung von blindem Gehorsam, Rassenhass und kriegerischer Revanche.
Was war der Fokus der 68er-Rezeption?
In diesem Kontext wurde Kleist eher als Utopist und Kritiker preußischer Machtpolitik gesehen, wobei das Stück als Plädoyer für einen defensiven Befreiungskampf gedeutet wurde.
In welchem historischen Kontext entstand das Werk?
Kleist schrieb das Drama 1808 unter dem Eindruck der napoleonischen Besatzung und als Aufruf zum Widerstand gegen die französische Fremdherrschaft.
Was sind zentrale Motive der Hermannsschlacht?
Zentrale Themen sind der Guerillakrieg, bedingungslose Loyalität zum Vaterland und die psychologische Manipulation des Gegners durch Propaganda.
- Citation du texte
- Thomas von der Heide (Auteur), 2004, Streitfall 'Hermannsschlacht'. Die politischen Ambitionen des Preußen Kleist und ihre Wahrnehmung(en) im 20. Jahrhundert, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/55827