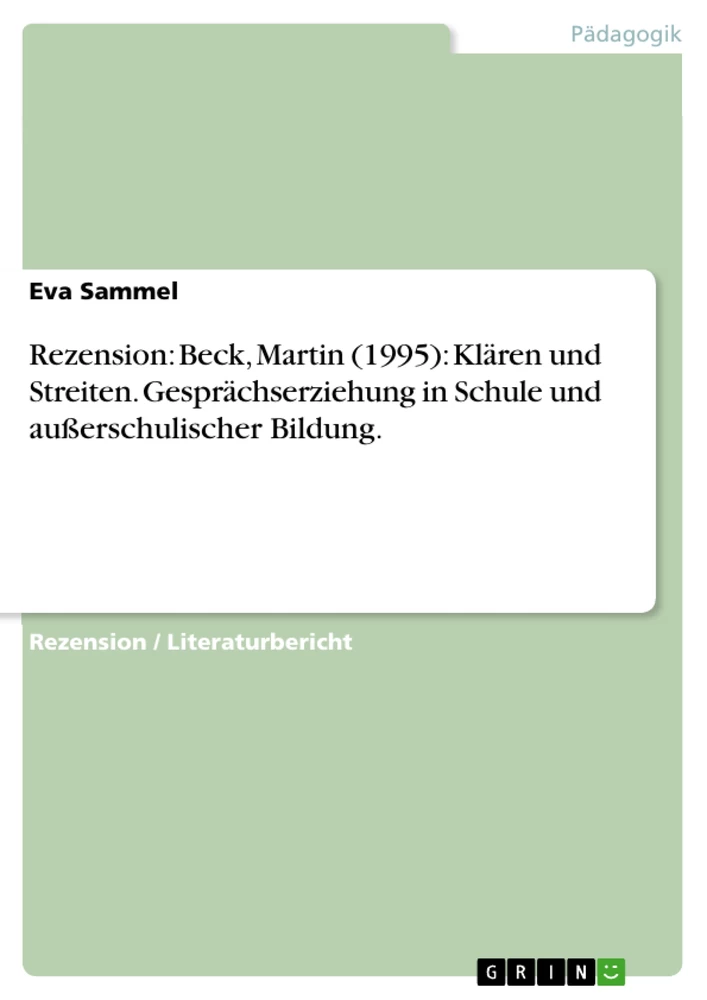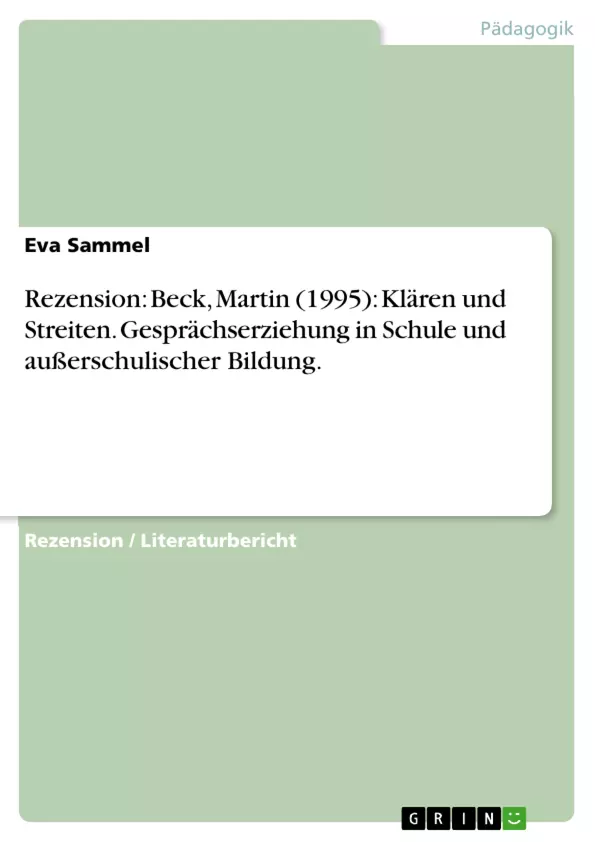„„Klären“ und „Streiten“ heißen die Gesprächsformen, in denen Menschen an der Willensbil-dung und Entscheidungsfindung […] teilnehmen.“ (Beck 1995, 7)
Den Auftakt macht Hellmut Geißner, Universitätsprofessor für Sprechwissenschaft und Spre-cherziehung, mit seinem Aufsatz „Klären und Streiten“, indem er Gesprächsformen und ihre Bezugsrichtungen anführt und erläutert. In einer Abbildung findet man eine Gliederung über „Formen des Gesprächs“. Die beiden Hauptgruppen bilden „Personengespräche“ und „Sach-gespräche“. (S. 16) Als Untergruppen der „Sachgespräche“ werden schließlich „Klärungsge-spräch“ und „Streitgespräch“ unterschieden. An dieser Stelle erfahren wir zum ersten Mal eine knappe Definition der beiden Begriffe:
„Beim Klärungsgespräch sprechen gleichberechtigte Personen miteinander [… und] versuchen, […] ihr Problem […] miteinander zu klären [… und] suchen gemeinsam nach Lösungen. […] Beim Streitge-spräch handelt es sich um das Austragen einer Meinungsverschiedenheit […] [z]wei Lösungsvorschläge konkurrieren miteinander. Die Partner werden zu Meinungs-Gegnern.“ (S. 17)
Anhand eines analysierenden Beispiels, hier eine Filmszene einer Betriebsmitarbeiter-Besprechung, erläutert er weitere Fachbegriffe, wie z.B. „(A)Symmetrie“ und „Sprechrollen“, und versucht Lösungsansätze und Vorschläge zur Erlernung von Konfliktfähigkeit aufzuzei-gen.
Inhaltsverzeichnis
- Klären und Streiten
- Formen des Gesprächs
- Personengespräche
- Sachgespräche
- Klärungsgespräch
- Streitgespräch
- Gesprächserziehung in der Schule
- Schülerorientierte Gesprächserziehung als Methodenlernen
- Argumentieren
- Rhetorische Kommunikation in der beruflichen Weiterbildung für Führungskräfte
- Konfliktrhetorik – Methoden des Streitens
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Buch „Klären und Streiten – Gesprächserziehung in Schule und außerschulischer Bildung“ befasst sich mit der Bedeutung von Gesprächserziehung und analysiert unterschiedliche Formen des Streitens und Klärens. Es beleuchtet die Bedeutung dieser Kommunikationsformen für die Willensbildung und Entscheidungsfindung in verschiedenen Lebensbereichen.
- Die verschiedenen Formen von Gesprächsformen und ihre Bezugsrichtungen
- Die Bedeutung von Gesprächserziehung in der Schule
- Die Entwicklung von Konfliktfähigkeit und deren Bedeutung für verschiedene Lebensbereiche
- Die Anwendung von rhetorischen Kommunikationsmethoden in der beruflichen Weiterbildung
- Der Umgang mit Konflikten und die Entwicklung von Konflikt(verstehens)fähigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel von Hellmut Geißner führt in die Thematik von „Klären und Streiten“ ein und stellt verschiedene Gesprächsformen vor, darunter Personengespräche und Sachgespräche. Es werden dabei auch die Begriffe „Klärungsgespräch“ und „Streitgespräch“ definiert.
- Martin Beck, der Herausgeber des Buches, widmet sich in seinem Beitrag der Gesprächserziehung in der Schule. Er betont die Bedeutung von „Klären“ und „Streiten“ als alltägliche Kommunikationsmuster und die Notwendigkeit von Gesprächserziehung, um diese Fähigkeiten zu fördern.
- Madeleine Hofer analysiert den Begriff des „Argumentierens“ und führt eine Einzelbuchbesprechung durch, in der sie die verschiedenen Ansätze der Autoren zum Thema „Streiten und Klären“ kritisch beleuchtet.
- Bertram Thiel untersucht die Rolle der rhetorischen Kommunikation in der beruflichen Weiterbildung für Führungskräfte und beschreibt ein systematisches Weiterbildungsprogramm.
- Rolf Grießhammer widmet sich der „Konfliktrhetorik“ und präsentiert ein zwölf-thesiges Stufenmodell zur Entwicklung von Konflikt(verstehens)fähigkeit. Er betont die Bedeutung von reflektierter Lebensgestaltung und Konfliktfähigkeit im Alltag.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen des Buches sind: Gesprächserziehung, Kommunikationsformen, „Klären“ und „Streiten“, Konfliktfähigkeit, rhetorische Kommunikation, methodisches Lernen, berufliche Weiterbildung und Konflikt(verstehens)fähigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen einem Klärungs- und einem Streitgespräch?
Im Klärungsgespräch suchen gleichberechtigte Partner gemeinsam nach Lösungen für ein Problem. Im Streitgespräch konkurrieren zwei gegensätzliche Meinungen, und die Partner werden zu Gegnern.
Warum ist Gesprächserziehung in der Schule notwendig?
Sie fördert die Konfliktfähigkeit der Schüler und vermittelt methodische Kompetenzen, um an gesellschaftlicher Willensbildung und Entscheidungsfindung teilnehmen zu können.
Was versteht man unter „Konfliktrhetorik“?
Rolf Grießhammer beschreibt dies als ein Stufenmodell zur Entwicklung von Konfliktverstehensfähigkeit, das auf reflektierter Lebensgestaltung basiert.
Welche Rolle spielt rhetorische Kommunikation in der Weiterbildung für Führungskräfte?
Sie dient als systematisches Instrument, um Führungskräften Methoden des sachlichen Klärens und fairen Streitens in beruflichen Kontexten zu vermitteln.
Wie unterteilt Hellmut Geißner die Formen des Gesprächs?
Er unterscheidet grundlegend zwischen Personengesprächen und Sachgesprächen, wobei Klärungs- und Streitgespräche Untergruppen der Sachgespräche bilden.
- Citar trabajo
- Eva Sammel (Autor), 2005, Rezension: Beck, Martin (1995): Klären und Streiten. Gesprächserziehung in Schule und außerschulischer Bildung., Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/55860