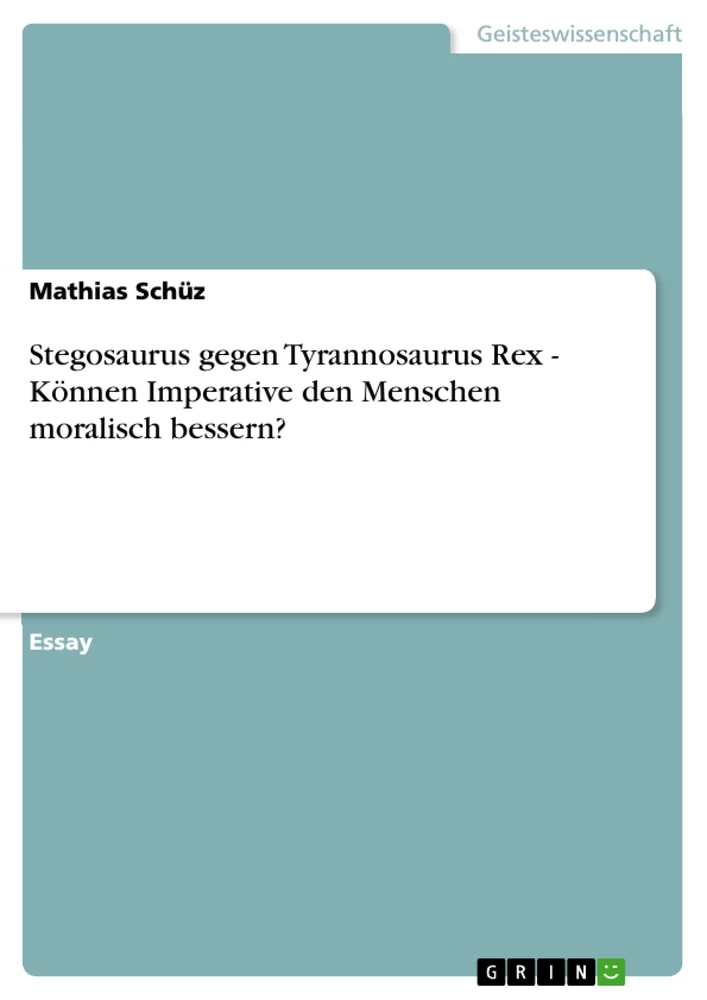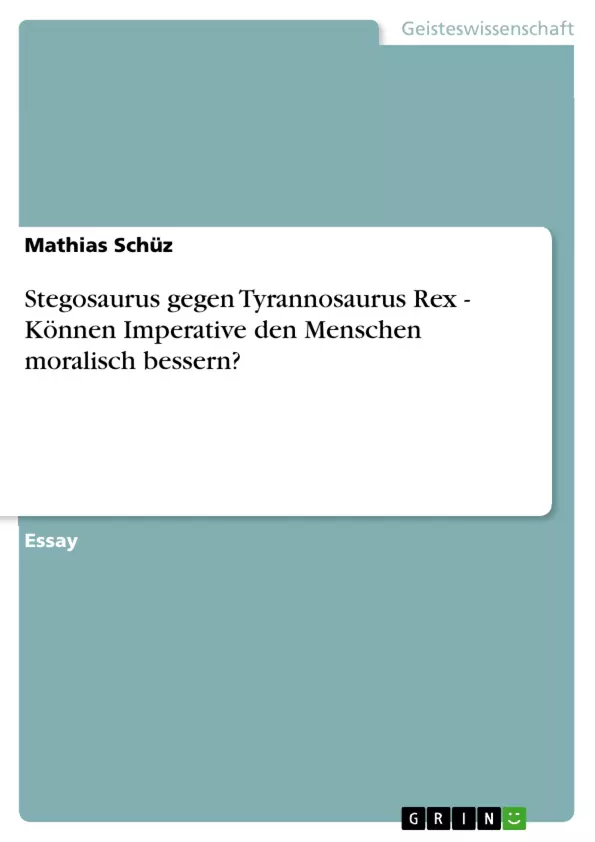Seit Jahrtausenden versuchen moralische Gebote, Imperative, Appelle und Regeln die Menschen im Umgang miteinander zu einem „besseren“ Verhalten zu erziehen. Betrachtet man den moralischen Zustand der heutigen Menschheit, kommen Zweifel über den Erfolg dieser Bemühungen auf. Der Jahresbericht von Amnesty International registrierte auch 1995 Menschenrechtsverletzungen an Frauen und Männer in 151 Ländern der Welt - darunter auch Deutschland und die Schweiz. Tausende von Menschen wurden von staatlichen Behörden ihrer Länder getötet, viele ohne faire Gerichtsverhandlungen verurteilt und hingerichtet, andere Opfer politischer Morde durch Soldaten und Polizei oder extralegaler Todesschwadronen. Gefangene wurden zu Tode gefoltert oder starben an den Folgen vorsätzlicher Mißhandlungen und Vernachlässigung.
Schlagen nicht schon diese wenigen Andeutungen über den desolaten moralischen Zustand der Menschheit Ethikern - den Spezialisten für moralische Imperative - ins Gesicht, wenn sie behaupten, gewisse ethische Prinzipien - wie z. B. die „Berücksichtung der Interessen aller Betroffenen“ - seien „stark genug“, eine Sklavenhaltergesellschaft oder krasse Formen von Rassismus und Sexismus auszuschließen? Warum sind so viele Versuche, Menschen über moralische Appelle, Gebote oder Verbote zu bessern, bisher gescheitert? Ist damit auch die Ethik für alle Zeiten diskreditiert? Zeigt sie sich gar als eine Geschichte gescheiterter Besserungsversuche? Oder ist vielleicht ihre eigentliche Aufgabe, den tieferen Sinn dieses Scheiterns aufzudecken? Ethik diente dann nicht mehr dazu, die Menschheit vom „Bösen“ weg zum „Guten“ hin zu führen, sondern eher das Bewußtsein für Gut und Böse zu schärfen.
Inhaltsverzeichnis
- Imperative als Erfindung zur Selbstverteidigung
- Imperative als Produkt der Evolution
- Der erste" Imperativ - von Gott aufgegeben?
- Die Welt der Imperative ..
- Jenseits von Imperativen?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text „Stegosaurus gegen Tyrannosaurus Rex“ von Mathias Schüz befasst sich mit der Frage, ob moralische Imperative dazu geeignet sind, den Menschen moralisch zu verbessern. Schüz argumentiert, dass Imperative zwar das Ziel haben, die Menschheit zu einem „besseren“ Verhalten zu führen, aber letztendlich daran scheitern.
- Die Ursprünge und Wirkungsweise moralischer Imperative
- Die Rolle der Evolution und des „egoistischen Gens“ in der Entwicklung von Moral
- Die Grenzen und Widersprüche von moralischen Imperativen
- Der Einfluss von Machtstrukturen und Selbstverteidigung auf die Entstehung von Imperativen
- Die Frage nach dem „tieferen Sinn“ des Scheiterns moralischer Besserungsversuche
Zusammenfassung der Kapitel
Der Text beleuchtet zunächst die Entstehung von Imperativen als Reaktion auf die Bedrohung durch Gewalt und Aggression. Anhand der Fabel vom Stegosaurus und dem Tyrannosaurus Rex zeigt Schüz auf, wie ein Imperativ zur Selbstverteidigung einer Gruppe erfunden wird, um das eigene Überleben zu sichern. Anschließend werden die verschiedenen Perspektiven auf die Entstehung von Moral diskutiert: Imperative als vom Menschen erfunden, in der Natur verankert oder von Gott gegeben. In diesem Zusammenhang wird auch die Rolle des „egoistischen Gens“ bei der evolutionären Entwicklung von Moral beleuchtet.
Schlüsselwörter
Moralische Imperative, Ethik, Selbstverteidigung, Evolution, egoistisches Gen, Tyrannosaurus Rex, Stegosaurus, Friedrich Dürrenmatt, Machtstrukturen, Besserungsversuche, Gut und Böse
- Citation du texte
- Dr. Mathias Schüz (Auteur), 1996, Stegosaurus gegen Tyrannosaurus Rex - Können Imperative den Menschen moralisch bessern?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/56067