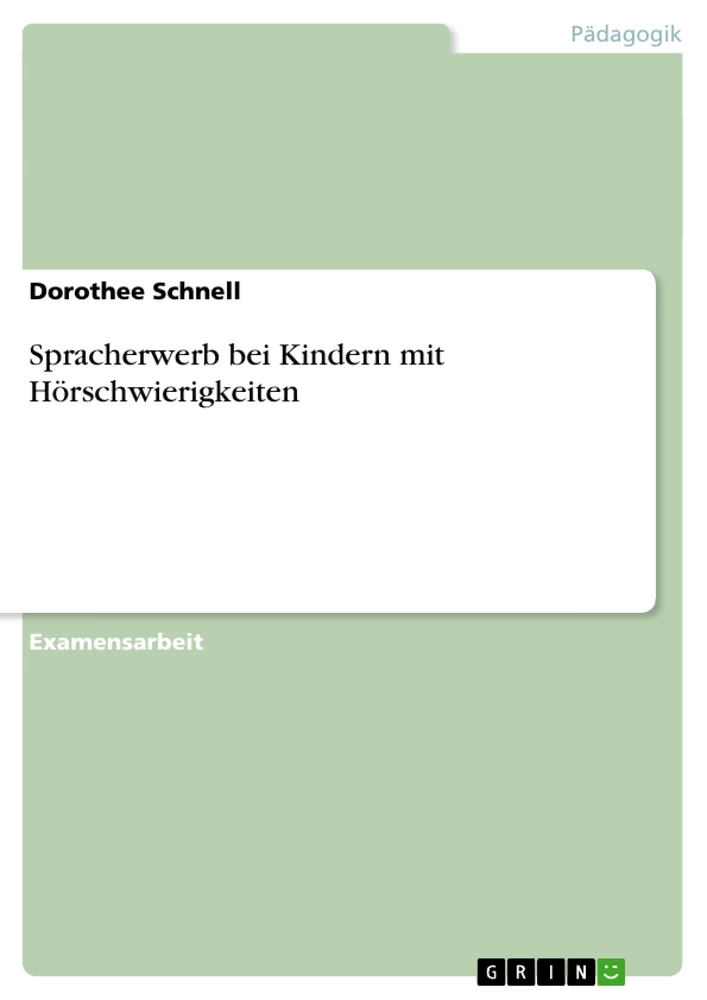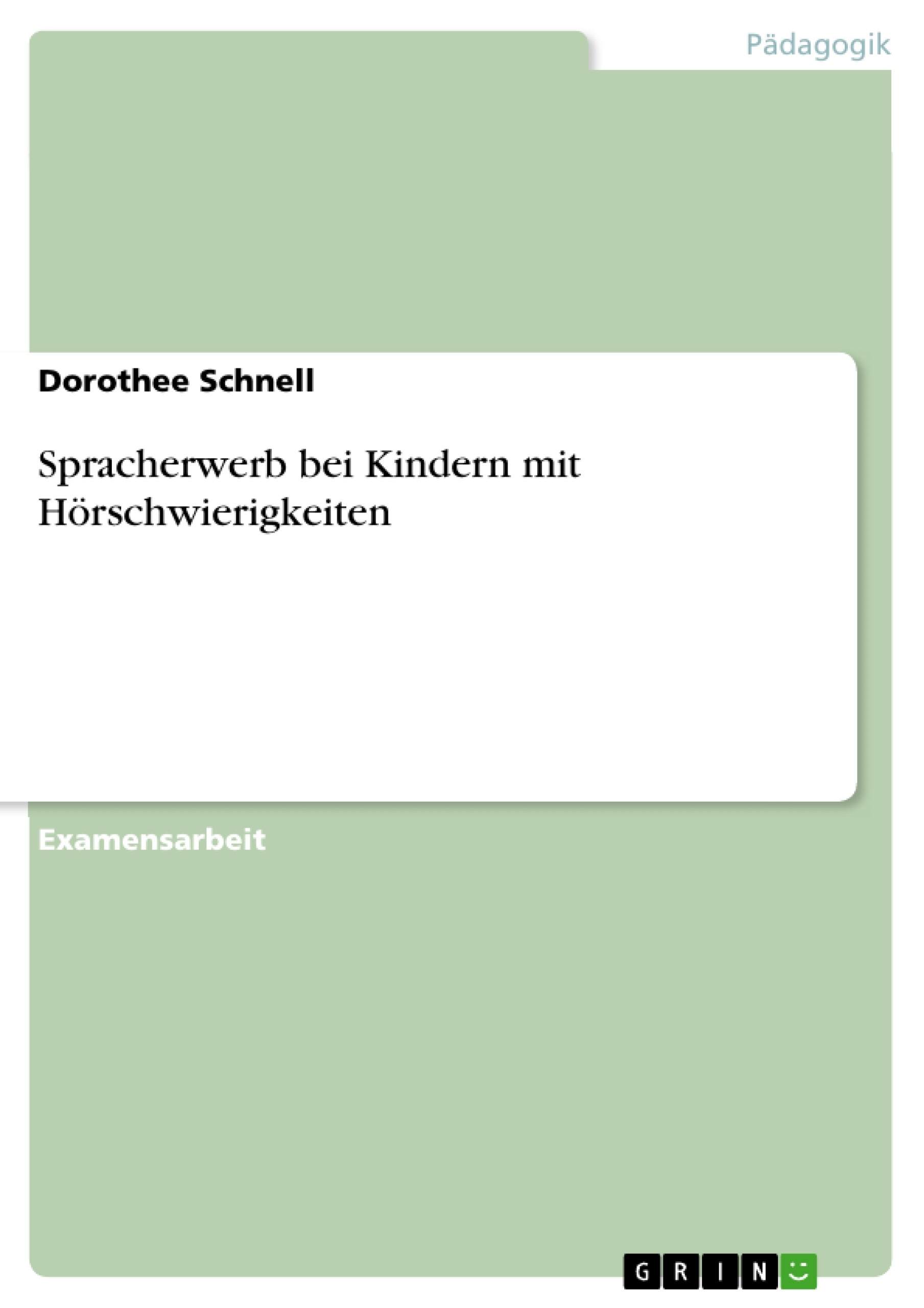Diese Examensarbeit zeigt auf, wie schwierig es für einen Menschen mit schlechtem oder ganz ohne Gehör ist, die Lautsprache zu erwerben.Sie klärt erst den gewöhnlichen Spracherwerb und stellt dann mögliche Hörbeeinträchtigungen dar.Nach Darstellung konkreter Erwerbsmöglichkeiten bei den Betroffenen wird noch das wichtige Thema der Frühförderung behandelt. Danach folgt noch ein kurzer Abriss der Geschichte der pädagogischen Bewegung zur Sprachbildung von Gehörlosen/Schwerhörigen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 SPRACHERWERB
- 1.1 Was Sprache ist
- 1.1.1 Gemeinsamkeiten aller Sprachen
- 1.1.2 Unterschiede der Sprachen
- 1.1.3 Deutsch-
- 1.2 Verschiedene Spracherwerbstheorien-
- 1.2.1 Nativistischer Ansatz-
- 1.2.2 Lerntheoretischer Ansatz/ Behaviorismus
- 1.2.3 Kognitivistischer Ansatz-
- 1.2.4 Interaktionistischer Ansatz
- 1.3 Interpretation und Fortführung der allgemeinen Diskussion
- 1.4 Stufen des Spracherwerbs -
- 1.1 Was Sprache ist
- 2 AUDITIVE BEEINTRÄCHTIGUNG UND MÖGLICHKEITEN DER
MEDIZINISCHEN VERSORGUNG
- 2.1 Schweregrade von Schwerhörigkeit--
- 2.2 Das CI und andere Hörhilfen-
- 2.2.1 Das CI
- 2.2.1.1 Aufbau und Implantation des CIs--
- 2.2.1.2 Indikation ·
- 2.2.1.3 Zeitpunkt der Implantation
- 2.2.2 Andere Hörhilfen
- 2.3 Frühförderung -
- 3 SPRACHE ERWERBEN OHNE GEHÖR-
- 3.1 Grundlagen der Lautspracherziehung bei Hörgeschädigten-
- 3.2 Aufgabenbereiche der Lautspracherziehung -
- 3.2.1 Sprachwahrnehmung ·
- 3.2.2 Sprechatmung
- 3.2.3 Stimmgebung-
- 3.2.4 Artikulation
- 3.2.5 Dialogische Gesprächsführung--
- 3.3 Lautbildung--
- 3.3.1 Konsonanten-
- 3.3.1.1 Plosive
- 3.3.1.2 Nasale
- 3.3.1.3 Frikative--
- 3.3.1.4 Der Laterallaut
- 3.3.1.5 Tremulanten
- 3.3.1.6 Der Hauchlaut-
- 3.3.2 Vokale
- 3.3.3 Diphthonge
- 3.4 Technische und manuelle Hilfssysteme--
- 3.4.1 Technische Hilfssysteme-------
- 3.4.2 Manuelle Hilfssysteme -
- 3.5 Einsatz von Gebärdensprache --
- 4 FRÜHFÖRDERUNG
- 4.1 Prävention
- 4.2 Notwendigkeit der Früherfassung
- 4.3 Weitere Untersuchungsmethoden----
- 4.3.1 Der Morosche Schreckreflex
- 4.3.2 Der akustische Lidreflex
- 4.3.3 Der motorische Schallreaktionstest-
- 4.3.4 Schuluntersuchung---
- 4.4 Maßnahmen und Hörgeräteversorgung
- 4.5 Förderung konkret-
- 5
BEWEGUNG
GESCHICHTE UND STAND DER PÄDAGOGISCHEN
ZUR
SPRACHBILDUNG
SCHWERHÖRIGEN/GEHÖRLOSEN
- 5.1 Geschichte
- 5.2 Heutiger Stand
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Herausforderungen, die eine Hörschädigung für den Spracherwerb eines Kindes darstellt. Ziel ist es, die Auswirkungen von Hörschwierigkeiten auf die Lautsprachentwicklung zu beleuchten und geeignete pädagogische Ansätze zur Förderung der Sprachentwicklung bei betroffenen Kindern zu erörtern.
- Die verschiedenen Theorien zum Spracherwerb und deren Bedeutung für das Verständnis der Schwierigkeiten von Kindern mit Hörschwierigkeiten
- Die verschiedenen Arten und Grade von Hörschädigungen und die Möglichkeiten der medizinischen Versorgung, insbesondere die Rolle von Hörhilfen wie dem Cochlea-Implantat (CI)
- Die Herausforderungen der Lautsprachentwicklung bei Kindern mit Hörschwierigkeiten und die verschiedenen Methoden der Lautspracherziehung, einschließlich technischer und manueller Hilfssysteme
- Die Wichtigkeit der Frühförderung, um Sprachschwierigkeiten aufgrund von Hörschwierigkeiten zu verhindern, sowie die verschiedenen Methoden der Diagnostik und Förderung
- Ein historischer Überblick über die pädagogische Bewegung für die Sprachbildung von Hörgeschädigten und eine Analyse des aktuellen Stands der Forschung.
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1 beleuchtet die Komplexität des Spracherwerbs und stellt verschiedene Theorien vor, die erklären, wie Kinder Sprache lernen. Es werden sowohl die Gemeinsamkeiten als auch die Unterschiede verschiedener Sprachen betrachtet.
- Kapitel 2 beschäftigt sich mit den Auswirkungen von Hörschädigungen auf das Hörvermögen und die Möglichkeiten der medizinischen Versorgung. Es werden verschiedene Schweregrade von Hörschwierigkeiten und die Funktionsweise von Hörhilfen wie dem CI detailliert erläutert.
- Kapitel 3 analysiert die Herausforderungen der Lautsprachentwicklung bei Kindern mit Hörschwierigkeiten. Es werden verschiedene Methoden der Lautspracherziehung vorgestellt, die auf die spezifischen Bedürfnisse dieser Kinder zugeschnitten sind, sowie die Bedeutung technischer und manueller Hilfssysteme.
- Kapitel 4 befasst sich mit der Frühförderung, die präventiv Sprachschwierigkeiten aufgrund von Hörschwierigkeiten vorbeugen soll. Es werden verschiedene Methoden der Diagnostik und Förderung vorgestellt, die sicherstellen, dass betroffene Kinder frühzeitig die bestmögliche Unterstützung erhalten.
- Kapitel 5 gibt einen kurzen Überblick über die Geschichte der pädagogischen Bewegung für die Sprachbildung von Hörgeschädigten und einen Kommentar zum aktuellen Stand der Forschung.
Schlüsselwörter
Spracherwerb, Hörschädigung, Gehörlosigkeit, Lautspracherziehung, Frühförderung, Cochlea-Implantat (CI), Hörhilfen, Sprachentwicklung, Diagnostik, Pädagogik, Sprachbildung.
Häufig gestellte Fragen
Welche Herausforderungen haben Kinder mit Hörschädigungen beim Spracherwerb?
Hörgeschädigte Kinder haben Schwierigkeiten, Lautsprache auf natürlichem Weg zu erwerben, da die auditive Wahrnehmung eingeschränkt oder gar nicht vorhanden ist.
Was ist ein Cochlea-Implantat (CI)?
Das CI ist eine elektronische Hörhilfe, die durch operative Implantation Menschen mit schwerer Schwerhörigkeit oder Gehörlosigkeit ein gewisses Hörvermögen ermöglicht.
Warum ist Frühförderung bei Hörschwierigkeiten so wichtig?
Frühförderung dient der Früherfassung und präventiven Unterstützung, um Sprachdefizite zu minimieren und die kognitive sowie soziale Entwicklung sicherzustellen.
Welche Spracherwerbstheorien werden in der Arbeit diskutiert?
Es werden der nativistische, lerntheoretische (Behaviorismus), kognitivistische und interaktionistische Ansatz behandelt.
Welche Aufgabenbereiche umfasst die Lautspracherziehung?
Dazu gehören Sprachwahrnehmung, Sprechatmung, Stimmgebung, Artikulation und die dialogische Gesprächsführung.
Wird in der Arbeit auch die Gebärdensprache thematisiert?
Ja, die Arbeit geht auf den Einsatz der Gebärdensprache als ergänzendes oder alternatives Kommunikationsmittel ein.
- Quote paper
- Dorothee Schnell (Author), 2005, Spracherwerb bei Kindern mit Hörschwierigkeiten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/56088