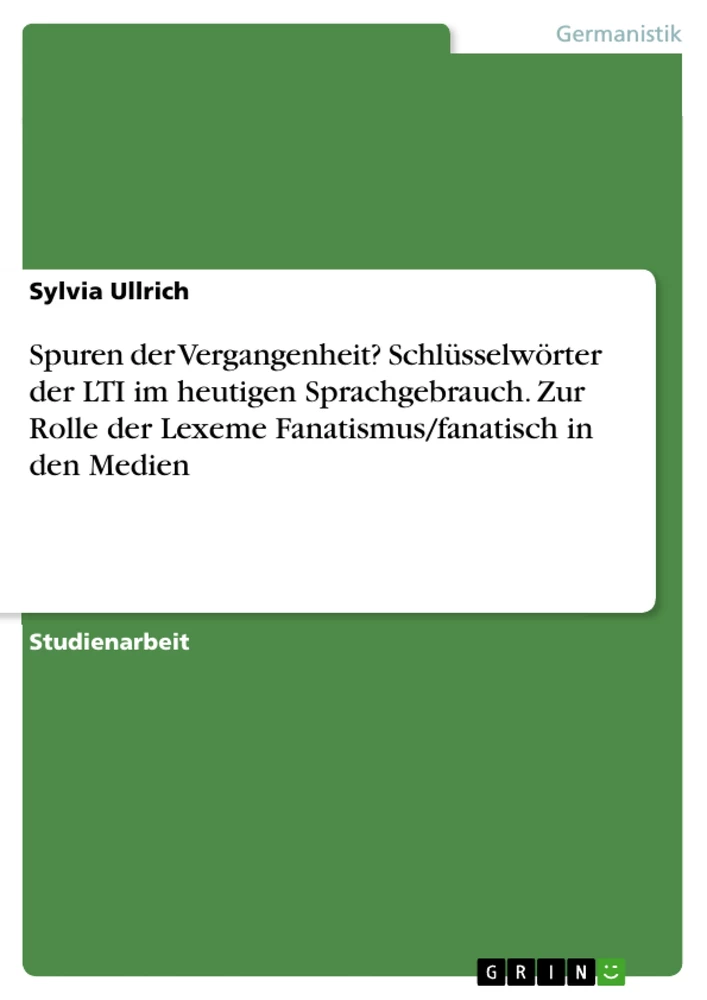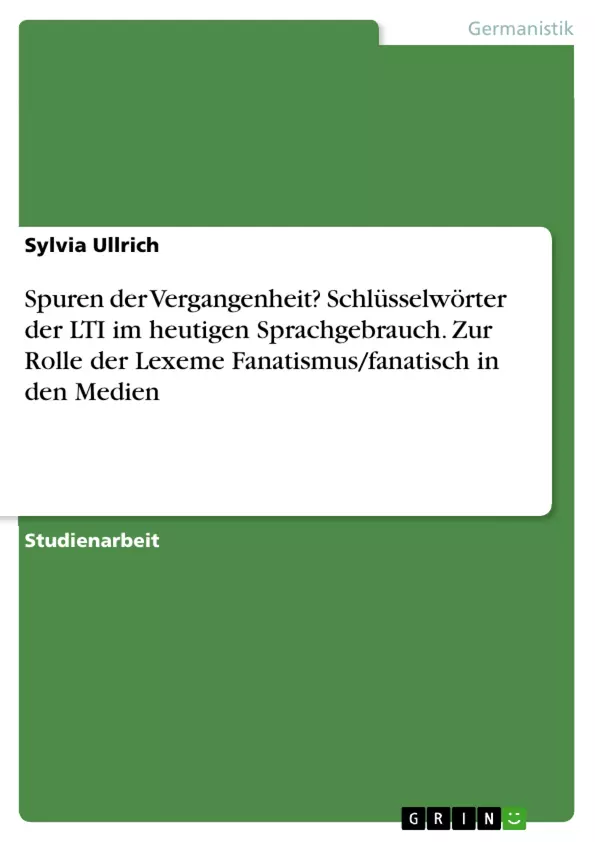Deutschland im Jahr 2005. Die Berliner Republik ist angekommen im dritten Jahrtausend. Begriffe wie Hartz IV, Eigenverantwortung, private Altersvorsorge und Ähnliche mehr dominieren den politischen Diskurs sowie den Alltag des Einzelnen und zeichnen ein Bild ihrer Zeit - nicht zuletzt womöglich auch über die Gegenwart hinaus. So werden diese im Sprachgebrauch hoch frequentierten sprachlichen Ausdrücke mit einiger Wahrscheinlichkeit auch künftigen Generationen wertvolle Hinweise auf Wesenszüge und Eigenheiten ihrer Entstehungszeit liefern. Gerade diese - wenngleich häufig implizit wirkende -Aussagekraft ist es, die diese Begriffe zu einem höchst informativen und spannenden Bereich der linguistischen Forschung machen. Erreichen sie einen bestimmten Status hinsichtlich ihrer Häufigkeit und relativen Bedeutung für das gesamtsprachliche Lexikon, spricht die Linguistik von Schlüsselwörtern. Doch nicht nur (potenzielle) Schlüsselwörter des gegenwärtigen Sprachgebrauchs erweisen sich als äußerst aufschlussreich. Auch der Umgang einer Sprachgemeinschaft mit Schlüsselwörtern vergangener Generationen und Epochen bietet Stoff für umfangreiche linguistische Auseinandersetzungen. Für den Bereich der germanistischen Linguistik erscheint, wie so oft, - neben sprachlichen Entwicklungen in der DDR - die Zeit des Nationalsozialismus von besonderer Eignung und Relevanz für derartige Betrachtungen zu sein. Sechzig Jahre nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges - der Eindruck der offiziellen Gedenkfeiern scheint noch allgegenwärtig - bietet sich dem aufmerksamen Betrachter mitunter ein zwiespältiges Bild; die Medaille der noch jungen Demokratie scheint zwei Seiten zu haben. Bezieht die Vorderseite ihren Glanz aus der radikal vollzogenen Abkehr von nationalsozialistischem Sprach-und Gedankengut - nicht wenige Politikerkarrieren scheiterten jüngst allein an Vergleichen mit dem Nationalsozialismus -, so offenbart die zweite, eher im Verborgenen liegende Seite einen weit weniger strengen und konsequenten Umgang mit der deutschen Vergangenheit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung - Gegenstand, Zielsetzung, Methoden
- Herkunft und Entwicklung des Lexems Fanatismus - ein Überblick
- Theoretische Grundlagen: Zur Rolle von Schlüsselwörtern in der Sprache
- Zum Begriff des Schlüsselworts
- Schlüsselwörter vs. Schlagwörter – eine Abgrenzung
- Exkurs: Schlüssel- und Schlagwörter im Bundestagswahlkampf 2005
- Schlüsselwörter der LTI
- Fanatismus/fanatisch als Schlüsselwort und -wert der LTI
- Die Lexeme Fanatismus/ fanatisch im heutigen Sprachgebrauch
- Einführende Betrachtungen – Klemperers Ahnung einer LQI
- Fanatismus im religiösen Kontext
- Fanatismus im politischen und gesellschaftlichen Kontext
- Fanatische Fans? - ein Sonderfall
- Fazit/ Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Verwendung der Lexeme „Fanatismus“ und „fanatisch“ in heutigen Medien im Kontext von Victor Klemperers „LTI – Notizbuch eines Philologen“. Ziel ist es, die Bedeutung von Schlüsselwörtern im Allgemeinen und den Umgang der heutigen Gesellschaft mit Schlüsselwörtern der NS-Zeit im Besonderen zu beleuchten. Die Analyse basiert auf einem Korpus deutscher Printmedien, wobei rechtsgerichtete Publikationen ausgeschlossen sind.
- Bedeutungswandel des Lexems „Fanatismus“
- Rolle von Schlüsselwörtern in der Sprachgeschichte
- Klemperers Analyse der „Lingua Tertii Imperii“ (LTI)
- Verwendung von „Fanatismus/fanatisch“ in aktuellen Medien
- Reflexion des Umgangs mit der NS-Vergangenheit in der heutigen Sprache
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung - Gegenstand, Zielsetzung, Methoden: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt den Untersuchungsgegenstand: die aktuelle Verwendung der Lexeme "Fanatismus" und "fanatisch" im Kontext der NS-Sprache. Die Arbeit untersucht, ob ein Rückgriff auf nationalsozialistisches Denken vorliegt oder ob die Verwendung lediglich einen neuen Umgang mit der Vergangenheit darstellt. Die Methodik umfasst die Analyse eines Korpus aus deutschen Printmedien, wobei rechtsgerichtete Publikationen bewusst ausgeschlossen werden. Die Arbeit stützt sich auf Klemperers "LTI" und untersucht die Bedeutung von Schlüsselwörtern im Allgemeinen und im Kontext der NS-Zeit im Besonderen.
Herkunft und Entwicklung des Lexems Fanatismus - ein Überblick: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des Begriffs "Fanatismus" und seinen Bedeutungswandel im Laufe der Zeit. Es untersucht die semantischen Verschiebungen und die unterschiedlichen Konnotationen des Wortes, die von religiösen Ursprüngen bis hin zu politischen und gesellschaftlichen Bedeutungen reichen. Die Entwicklung des Begriffs wird im Kontext seiner Verwendung und seiner Assoziationen analysiert.
Theoretische Grundlagen: Zur Rolle von Schlüsselwörtern in der Sprache: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die Untersuchung dar. Es definiert den Begriff "Schlüsselwort" und grenzt ihn von "Schlagwort" ab. Der Abschnitt über den Bundestagswahlkampf 2005 dient als Exempel, um Schlüsselwörter der aktuellen politischen Debatte zu illustrieren. Es analysiert die Rolle von Schlüsselwörtern innerhalb eines Sprachsystems und ihrer Bedeutung für das Verständnis von historischen und gesellschaftlichen Entwicklungen. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der Semantik und Pragmatik solcher Wörter und ihrer Funktion in der Kommunikation.
Schlüsselwörter der LTI: Dieses Kapitel analysiert die Schlüsselwörter Klemperers, die er in seiner "LTI" identifiziert hat. Es legt den Fokus auf die besonderen Merkmale dieser Wörter im Kontext der NS-Propaganda und ihrer Bedeutung im Aufbau eines ideologischen Systems. Es untersucht die sprachliche Strategie und die Macht der Worte, um die Ideologie des Nationalsozialismus zu propagieren und zu verfestigen. Die Analyse betont die Wirkung der ausgewählten Wörter und ihrer Funktion als Träger von nationalsozialistischer Ideologie.
Fanatismus/fanatisch als Schlüsselwort und -wert der LTI: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die spezifische Rolle der Lexeme "Fanatismus" und "fanatisch" in der NS-Sprache. Es analysiert, wie diese Wörter im nationalsozialistischen Kontext instrumentalisiert und ideologisch aufgeladen wurden und welche Funktion sie im System der NS-Propaganda innehatten. Es untersucht die semantischen Verschiebungen und die Bedeutungswandel dieser Wörter während des Nationalsozialismus, um ihre zentrale Funktion als Schlüsselwörter der LTI zu verdeutlichen.
Die Lexeme Fanatismus/ fanatisch im heutigen Sprachgebrauch: Dieses Kapitel untersucht die aktuelle Verwendung der Lexeme „Fanatismus“ und „fanatisch“ in verschiedenen Kontexten. Es betrachtet religiöse, politische und gesellschaftliche Beispiele und analysiert die Bedeutung und die Konnotationen des Wortes in der modernen Sprache. Es wird die Frage behandelt, ob die aktuelle Verwendung einen Bezug zur nationalsozialistischen Verwendung aufweist und wie die Gesellschaft mit diesem Erbe umgeht. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Vergleich zwischen historischer und aktueller Bedeutung und die möglichen Ursachen für die heutige Anwendung.
Schlüsselwörter
Fanatismus, fanatisch, Schlüsselwörter, Lingua Tertii Imperii (LTI), Victor Klemperer, Nationalsozialismus, Sprachgeschichte, Semantik, Bedeutungswandel, Mediensprache, politische Sprache, Sprachkritik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: "Fanatismus/fanatisch als Schlüsselwort und -wert der LTI"
Was ist der Gegenstand der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Verwendung der Lexeme „Fanatismus“ und „fanatisch“ in heutigen Medien im Kontext von Victor Klemperers „LTI – Notizbuch eines Philologen“. Sie beleuchtet den Bedeutungswandel dieser Wörter und analysiert, ob ein Rückgriff auf nationalsozialistisches Denken vorliegt oder ob die heutige Verwendung einen neuen Umgang mit der Vergangenheit darstellt.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Bedeutung von Schlüsselwörtern im Allgemeinen und den Umgang der heutigen Gesellschaft mit Schlüsselwörtern der NS-Zeit im Besonderen zu beleuchten. Sie analysiert den Bedeutungswandel des Lexems „Fanatismus“, die Rolle von Schlüsselwörtern in der Sprachgeschichte und die Verwendung von „Fanatismus/fanatisch“ in aktuellen Medien. Letztlich reflektiert sie den Umgang mit der NS-Vergangenheit in der heutigen Sprache.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Analyse basiert auf einem Korpus deutscher Printmedien (rechtsgerichtete Publikationen ausgeschlossen). Die Arbeit stützt sich auf Klemperers "LTI" und untersucht die Bedeutung von Schlüsselwörtern im Kontext der NS-Zeit. Die Methodik umfasst die Analyse der Semantik und Pragmatik der Schlüsselwörter und deren Funktion in der Kommunikation.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung (Gegenstand, Zielsetzung, Methoden); Herkunft und Entwicklung des Lexems Fanatismus; Theoretische Grundlagen (Rolle von Schlüsselwörtern); Schlüsselwörter der LTI; Fanatismus/fanatisch als Schlüsselwort der LTI; Die Lexeme Fanatismus/fanatisch im heutigen Sprachgebrauch; Fazit/Ausblick.
Wie wird der Begriff "Schlüsselwort" definiert und abgegrenzt?
Die Arbeit definiert den Begriff "Schlüsselwort" und grenzt ihn von "Schlagwort" ab. Ein Exkurs zum Bundestagswahlkampf 2005 illustriert Schlüsselwörter in der aktuellen politischen Debatte. Der Fokus liegt auf der Bedeutung von Schlüsselwörtern innerhalb eines Sprachsystems und ihrer Funktion in der Kommunikation.
Welche Rolle spielen die Schlüsselwörter der LTI in der Arbeit?
Die Arbeit analysiert die von Klemperer in seiner „LTI“ identifizierten Schlüsselwörter und deren besondere Merkmale im Kontext der NS-Propaganda. Der Fokus liegt auf der sprachlichen Strategie und der Macht der Worte, um die Ideologie des Nationalsozialismus zu propagieren und zu verfestigen.
Wie werden "Fanatismus" und "fanatisch" im Kontext der LTI untersucht?
Die Arbeit analysiert, wie die Lexeme „Fanatismus“ und „fanatisch“ im nationalsozialistischen Kontext instrumentalisiert und ideologisch aufgeladen wurden und welche Funktion sie in der NS-Propaganda innehatten. Es wird der semantische Wandel dieser Wörter während des Nationalsozialismus untersucht.
Wie wird die heutige Verwendung von "Fanatismus" und "fanatisch" analysiert?
Die Arbeit untersucht die aktuelle Verwendung der Lexeme in religiösen, politischen und gesellschaftlichen Kontexten. Sie analysiert Bedeutung und Konnotationen in der modernen Sprache und fragt nach einem Bezug zur nationalsozialistischen Verwendung und dem Umgang der Gesellschaft mit diesem Erbe. Ein Vergleich zwischen historischer und aktueller Bedeutung wird vorgenommen.
Welche Schlüsselwörter werden in der Arbeit behandelt?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Fanatismus, fanatisch, Schlüsselwörter, Lingua Tertii Imperii (LTI), Victor Klemperer, Nationalsozialismus, Sprachgeschichte, Semantik, Bedeutungswandel, Mediensprache, politische Sprache, Sprachkritik.
- Quote paper
- Sylvia Ullrich (Author), 2005, Spuren der Vergangenheit? Schlüsselwörter der LTI im heutigen Sprachgebrauch. Zur Rolle der Lexeme Fanatismus/fanatisch in den Medien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/56089