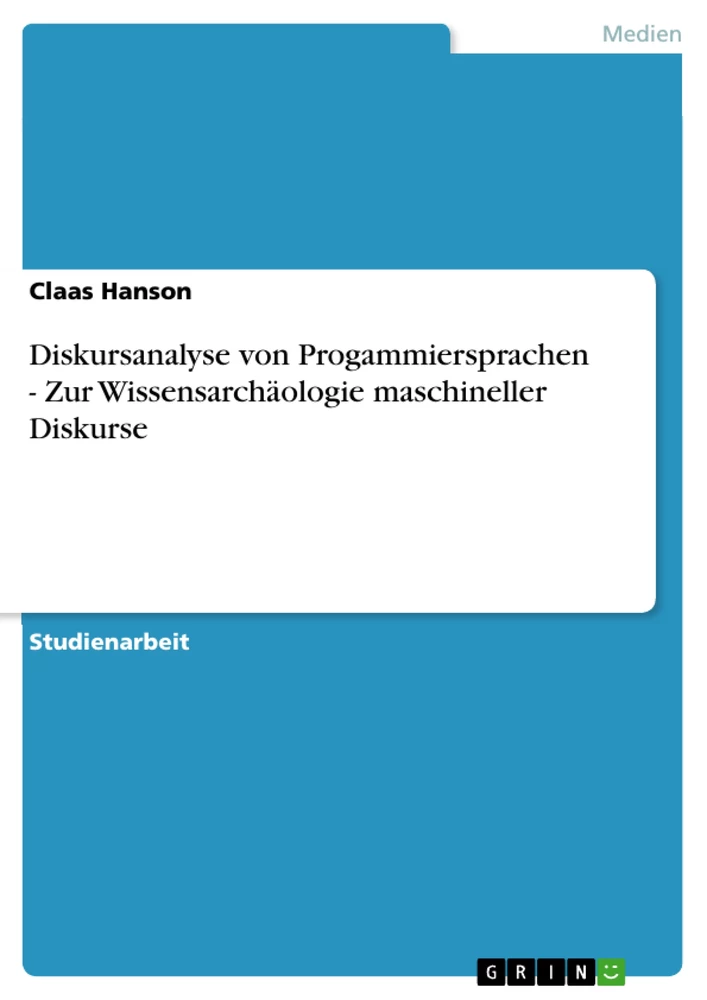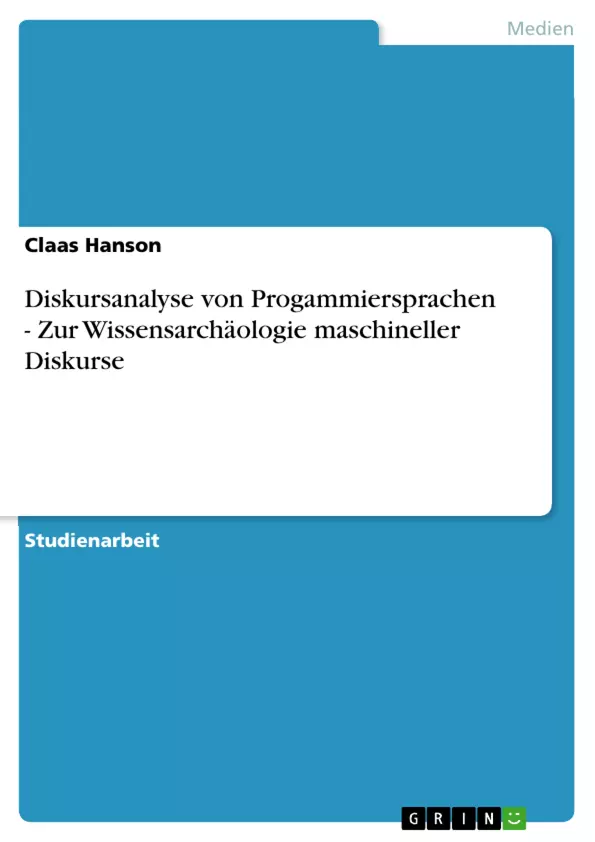Der Computer als ›rechnender Raum‹, als abstraktes Zeichensystem oder als ideologische Metapher: die Ontologie der Maschine ist immer auch ein Betätigungsfeld der Anthropologie. Den konkurrierenden Definitionen des Computers wohnt immer auch ein Stück Selbstbeschreibung des Menschen und seiner Position zur Umwelt inne. Der Mensch formuliert durch Technik Aussagen über sich und über die Welt, der er sich durch eben jene Maschinen entfremdet fühlt.
Claas Hanson eröffnet im vorliegenden Buch eine diskursive Perspektive auf das Abbildungssystem Computer. Jenseits einer Hardware-Geschichtsschreibung, einer Phänomenologie der Apparate, nähert er sich der Thematik mittels der Diskursanalyse nach Michel Foucault.
Zentral sind dabei die Fragen, was uns Programmieren ›bedeutet‹, und inwieweit der Computer als Abbildungssystem der Realität Wissen in Simulationen schaffen kann. Die Genese des Computers wird als Geschichte seiner Programmierung, als stringenter Weg in die Abstraktion von der Maschine beschrieben. Sprachkonzepte bilden den Schlüssel zum tieferen Verständnis des ›Maschinen-Seins‹. Fragen nach der Hardware-Software-Dualität wird genauso nachgegangen werden, wie den Fragen nach wechselseitiger Simulation und den vielfältigen Widersprüchlichkeiten. Eine ergebnisorientierte Diskursanalyse zu einer Kernproblematik exemplifiziert die Anwendung der Methode auf dieses Wissensfeld. Die Einordnung des Menschen und der Maschine in verschiedene Positionen der Diskurse mag zudem einige Anregungen für unser Selbstverständnis als Mensch und als ›Nutzer‹ geben.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Diskursanalyse nach Michel Foucault
- Archäologie des Wissens
- Anwendbarkeit auf den Gegenstand der Arbeit
- Computergeschichte als Programmiergeschichte
- Sprache – das Codieren von Information
- Schrift - das symbolische Programmieren der Welt
- Exkurs zur Maschine: Mensch - Maschine - Interaktion
- Alles Software? – Alles Hardware?
- Programmiersprachen und linguistische Konzepte
- Kompetenz und Performanz
- Programmierung als Konstruktion von Realität
- Fragen und Begriffe zur Diskursanalyse
- Diskursanalytische Ansätze
- Resümmee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Computer aus einer diskursiven Perspektive, indem sie die Programmiergeschichte als Weg in die Abstraktion von der Maschine beschreibt. Zentral ist die Frage, was Programmieren bedeutet und inwieweit der Computer als Abbildungssystem der Realität Wissen in Simulationen schafft. Die Arbeit beleuchtet die Diskursfelder, in denen der Computer wirksam wird und die für sein Funktionieren notwendig sind.
- Diskursanalyse des Computers nach Michel Foucault
- Die Rolle von Sprache und Schrift in der Programmierung
- Die Konstruktion von Realität durch Programmierung
- Die Hardware-Software-Dualität
- Machtfragen der Computernutzung
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Das Vorwort führt in die Thematik ein und beschreibt den Computer als "rechnenden Raum", abstraktes Zeichensystem und ideologische Metapher. Es wird betont, dass die Ontologie der Maschine eng mit der Anthropologie verbunden ist und dass der Mensch durch Technik Aussagen über sich und die Welt formuliert. Die Arbeit wählt einen diskursanalytischen Ansatz nach Michel Foucault, um die Bedeutung des Computers für unsere Wahrnehmung der Realität zu untersuchen.
Diskursanalyse nach Michel Foucault: Dieses Kapitel erläutert die Grundzüge der Diskursanalyse nach Foucault, wobei betont wird, dass es sich nicht um eine konsistente Methode handelt. Foucault's "Archäologie des Wissens" wird als Ausgangspunkt für die methodische Reflexion seiner Arbeiten herangezogen. Das Kapitel diskutiert Foucaults Abkehr von traditionellen Geschichtsauffassungen und die Bedeutung des Konzepts der Archäologie für seine Diskursanalyse.
Computergeschichte als Programmiergeschichte: Dieses Kapitel betrachtet die Computergeschichte nicht als bloße Hardware-Chronik, sondern als Geschichte der Programmierung. Es wird argumentiert, dass sprachliche Konzepte der Schlüssel zum Verständnis des "Maschinen-Seins" sind. Der Fokus liegt auf der Entwicklung von Programmierkonzepten und der damit verbundenen Abstraktion von der Maschine.
Sprache – das Codieren von Information: Dieses Kapitel befasst sich mit der Rolle der Sprache im Kontext der Programmierung. Es analysiert, wie Sprache zur Codierung von Informationen und zur Steuerung von Computern eingesetzt wird und wie dies die Beziehung zwischen Mensch und Maschine beeinflusst.
Schrift - das symbolische Programmieren der Welt: Dieser Abschnitt untersucht den Zusammenhang zwischen Schrift und dem symbolischen Programmieren der Welt. Er beleuchtet die Interaktion zwischen Mensch und Maschine und die Fragen der Hardware-Software-Dualität, sowie die wechselseitige Simulation und die vielfältigen Widersprüchlichkeiten, die mit dieser Beziehung verbunden sind.
Programmiersprachen und linguistische Konzepte: Hier werden Programmiersprachen unter linguistischen Aspekten betrachtet. Konzepte wie Kompetenz und Performanz werden angewendet, um das Verständnis von Programmiersprachen zu vertiefen und deren Einfluss auf die Konstruktion von Realität zu beleuchten.
Programmierung als Konstruktion von Realität: Dieses Kapitel analysiert, wie Programmierung zur Konstruktion von Realität beiträgt. Es werden die Möglichkeiten und Grenzen dieser Konstruktion erörtert und deren Auswirkungen auf unser Verständnis von Wirklichkeit untersucht.
Fragen und Begriffe zur Diskursanalyse: Das Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der diskursanalytischen Untersuchung des Computers dar und erläutert die gewählte Methodik der Analyse.
Diskursanalytische Ansätze: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Ansätze zur Diskursanalyse und wendet diese auf den Gegenstand der Arbeit an, um die Kernproblematik zu untersuchen.
Schlüsselwörter
Diskursanalyse, Michel Foucault, Archäologie des Wissens, Computergeschichte, Programmierung, Sprache, Schrift, Hardware, Software, Realität, Simulation, Macht, Wissen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Diskursanalyse des Computers
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Computer aus einer diskursiven Perspektive, indem sie die Programmiergeschichte als Weg in die Abstraktion von der Maschine beschreibt. Zentral ist die Frage, was Programmieren bedeutet und inwieweit der Computer als Abbildungssystem der Realität Wissen in Simulationen schafft. Die Arbeit beleuchtet die Diskursfelder, in denen der Computer wirksam wird und die für sein Funktionieren notwendig sind.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verwendet einen diskursanalytischen Ansatz nach Michel Foucault. Foucaults "Archäologie des Wissens" dient als methodischer Ausgangspunkt. Die Arbeit reflektiert die methodischen Herausforderungen und die Abkehr von traditionellen Geschichtsauffassungen im Foucaultschen Denken.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Diskursanalyse des Computers nach Michel Foucault, die Rolle von Sprache und Schrift in der Programmierung, die Konstruktion von Realität durch Programmierung, die Hardware-Software-Dualität, und Machtfragen der Computernutzung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst ein Vorwort, Kapitel zur Diskursanalyse nach Foucault, zur Computergeschichte als Programmiergeschichte, zur Rolle von Sprache und Schrift in der Programmierung, zu Programmiersprachen und linguistischen Konzepten, zur Programmierung als Konstruktion von Realität, Kapitel zu Fragen und Begriffen der Diskursanalyse und zu diskursanalytischen Ansätzen, sowie ein Resümmee. Ein Inhaltsverzeichnis und eine Zusammenfassung der Kapitel sind ebenfalls enthalten.
Was wird im Vorwort erläutert?
Das Vorwort führt in die Thematik ein und beschreibt den Computer als "rechnenden Raum", abstraktes Zeichensystem und ideologische Metapher. Es betont die enge Verbindung zwischen der Ontologie der Maschine und der Anthropologie und die Rolle der Technik bei der Formulierung von Aussagen über Mensch und Welt. Der diskursanalytische Ansatz nach Foucault wird begründet.
Welche Rolle spielen Sprache und Schrift?
Die Arbeit untersucht die zentrale Rolle von Sprache und Schrift bei der Codierung von Informationen und der Steuerung von Computern. Sie analysiert, wie Sprache die Beziehung zwischen Mensch und Maschine beeinflusst und wie Schrift zum symbolischen Programmieren der Welt beiträgt. Der Zusammenhang zwischen Hardware und Software wird kritisch beleuchtet.
Wie wird Realität konstruiert?
Die Arbeit analysiert, wie Programmierung zur Konstruktion von Realität beiträgt, erörtert die Möglichkeiten und Grenzen dieser Konstruktion und untersucht deren Auswirkungen auf unser Verständnis von Wirklichkeit. Die Konzepte von Kompetenz und Performanz aus der Linguistik werden dabei angewendet.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Diskursanalyse, Michel Foucault, Archäologie des Wissens, Computergeschichte, Programmierung, Sprache, Schrift, Hardware, Software, Realität, Simulation, Macht, Wissen.
Was ist das Fazit der Arbeit?
(Das Resümee der Arbeit wird im Kapitel "Resümmee" detailliert behandelt und ist in diesem FAQ-Abschnitt nicht explizit zusammengefasst.)
- Quote paper
- Claas Hanson (Author), 2003, Diskursanalyse von Progammiersprachen - Zur Wissensarchäologie maschineller Diskurse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/56482