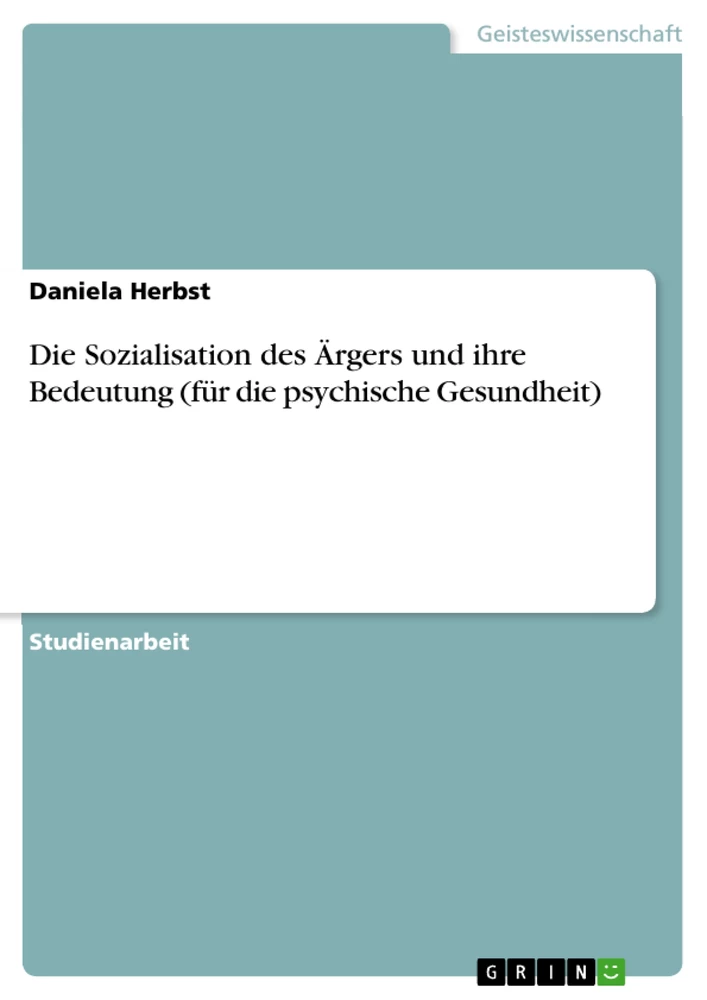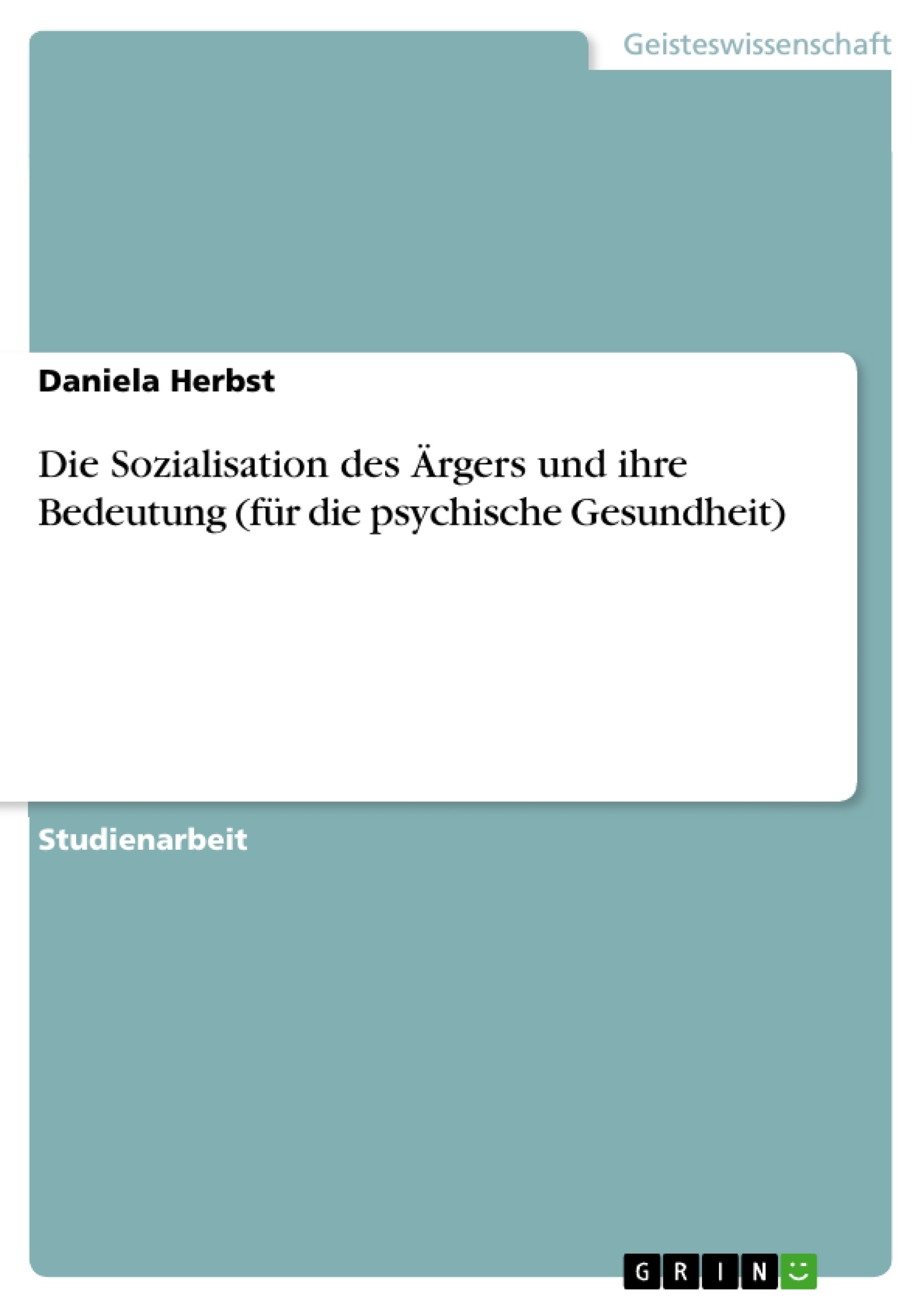In unserer alltäglichen Kommunikation verwenden wir häufig Begriffe, deren Bedeutung uns intuitiv zwar bekannt ist, die tatsächlich zu definieren uns allerdings äußert schwer fällt. Zu dieser Kategorie gehört auch der das Wort Ärger. Uns allen ist seit unserer frühesten Kindheit das Bild des Rumpelstilzchens geläufig, dass wütend stampft, zetert und sich schließlich entzweireißt.
In dieser geradezu prototypischen und sehr überspitzt dargestellter Form ist die Ärgeremotion jedoch kaum anzutreffen, deshalb scheint es zunächst nötig sie genauer zu klassifizieren und gegen ähnliche Gefühlsklassen abzugrenzen. Um die Definition des Ärgers abzurunden, bietet es sich des Weiteren an, ihre Ausdrucksformen zu erfassen und die Einbettung in unser Alltagsleben mit einzubeziehen. Dies soll zum einen durch eine nähere Beleuchtung des bedeutenden Werkes „The expression of the emotions in man and animals“ von Charles Darwin geschehen, das 1872 erschienen ist. Die darin, vielfach heute noch gültige Beobachtungen, zum Ausdruck von Hass (hatred) und Zorn (anger) sind als Schablonen verwendbar und erleichtern den Zugang zu diesem Bereich erheblich. Zum anderen erfolgt eine Auseinandersetzung mit dem sogenannten „AHA-Syndrom“.
Bisher wurde nur die Emotion als solche angesprochen, da der Mensch aber ein soziales Wesen ist, sind sein Verhalten und somit auch seine Gefühle auch im Kontext der ihn umgebenden Gesellschaft beziehungsweise Kultur zu betrachten.
Zusammengefasst unter dem Begriff Sozialisation soll deshalb die Frage nach der Art und Weise wie der Umgang mit Ärger vermittelt wird geklärt werden, aber auch durch welche Träger, wie hoch ihr jeweiliger Einfluss ist und in welchen Phasen dies geschieht. Dabei liegt das Augenmerk sowohl auf allgemeinen Aspekten, wie auch auf kulturellen und geschlechtsspezifischen Unterschieden. In letzter Konsequenz gilt es dann zu analysieren, worin die Bedeutung einer sozialisierten Ärger-Emotion nun liegt und welche Gefahren eine fehlerhafte Vermittlung, unter anderem für die psychische Gesundheit, birgt.
Eingebettet in die vorliegende Darstellung sollen zudem zwei sehr unterschiedliche Forschungsarbeiten etwas genauer in den Blick gerückt werden: Die Untersuchung des Linguisten Kövecses sowie die Längsschnittstudie der beiden Forscherinnen Miller und Sperry.
Inhaltsverzeichnis
- Die Definition, Abgrenzung und Einbindung der Ärger-Emotion
- Die Definition und Spezifikation des Ärgers
- Die Abgrenzungsschwierigkeiten und der Ärgerausdruck nach Darwin
- Die Einbindung der Ärger-Emotion: das AHA-Syndrom
- Exkurs: Die Bedeutung der Sprache: Metaphern und Metonymien
- Die Sozialisation der Ärger-Emotion
- Die Sozialisation und ihre Träger
- Exkurs: Die Studie von Miller und Sperry
- Die Frage nach der Reichweite der Sozialisation
- Die Richtung der Sozialisation und ihre verschiedenen Phasen
- Die geschlechtsspezifische Sozialisation der Ärger-Emotion
- Die Bedeutung der Sozialisation des Ärgers (für die psychische Gesundheit)
- Die entscheidenden Funktionen des sozialisierten Ärgers
- Der Ärger als Zustand oder als Eigenschaft
- Die Verstärkungs- gegen die Abfuhr-Hypothese
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit beschäftigt sich mit der Sozialisation des Ärgers und deren Bedeutung für die psychische Gesundheit. Sie analysiert, wie die Emotion Ärger in verschiedenen sozialen Kontexten gelernt und vermittelt wird, und beleuchtet dabei die Rolle von Kultur, Geschlecht und sozialem Umfeld. Die Arbeit untersucht zudem die Auswirkungen einer erfolgreichen bzw. fehlerhaften Sozialisation des Ärgers auf die psychische Gesundheit.
- Definition, Abgrenzung und Einbindung der Ärger-Emotion
- Sozialisation des Ärgers: Träger, Prozesse und Phasen
- Die Bedeutung des sozialisierten Ärgers für die psychische Gesundheit
- Kulturelle und geschlechtsspezifische Unterschiede in der Sozialisation des Ärgers
- Die Folgen einer fehlerhaften Sozialisation des Ärgers
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Dieses Kapitel widmet sich der Definition und Abgrenzung der Ärger-Emotion. Es werden verschiedene Arten von Ärger beschrieben und die typischen Merkmale des Ärgers im sozialen Kontext beleuchtet. Zudem wird die Verbindung des Ärgers mit anderen Emotionen wie Neid, Eifersucht und Enttäuschung betrachtet.
- Kapitel 2: Dieses Kapitel fokussiert auf die Sozialisation des Ärgers. Es werden die verschiedenen Träger der Sozialisation und die Mechanismen der Vermittlung des Umgangs mit Ärger in unterschiedlichen Phasen des Lebens analysiert. Besonderes Augenmerk liegt auf den kulturellen und geschlechtsspezifischen Aspekten der Sozialisation.
- Kapitel 3: Dieses Kapitel untersucht die Bedeutung der Sozialisation des Ärgers für die psychische Gesundheit. Es beleuchtet die positiven Funktionen einer erfolgreichen Sozialisation und die negativen Folgen einer fehlerhaften Vermittlung des Umgangs mit Ärger.
Schlüsselwörter
Ärger-Emotion, Sozialisation, psychische Gesundheit, Kultur, Geschlecht, Ausdruck, Bewältigung, Verstärkungs-Hypothese, Abfuhr-Hypothese, Interpersonelle Beziehungen, Emotionen, Kommunikation, Sprache, AHA-Syndrom.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter der Sozialisation von Ärger?
Sozialisation bezeichnet den Prozess, in dem Kinder lernen, wie sie ihre Ärgeremotionen im Kontext ihrer Kultur und Gesellschaft wahrnehmen, ausdrücken und regulieren dürfen.
Welche Rolle spielt Charles Darwin bei der Erforschung von Emotionen?
In seinem Werk „The expression of the emotions in man and animals“ beschrieb Darwin universelle Ausdrucksformen von Zorn und Hass, die als biologische Basis für das Verständnis von Ärger dienen.
Was ist das „AHA-Syndrom“?
Das AHA-Syndrom steht für Anger (Ärger), Hostility (Feindseligkeit) und Aggression. Es beschreibt einen Komplex aus Gefühlen, Einstellungen und Verhaltensweisen im Umgang mit Ärger.
Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Ärgersozialisation?
Ja, Jungen und Mädchen werden oft unterschiedlich sozialisiert: Während bei Jungen aggressivere Ausdrucksformen oft eher toleriert werden, wird bei Mädchen häufig eine stärkere Regulation oder Unterdrückung von Ärger erwartet.
Wie beeinflusst fehlgeleitete Ärgersozialisation die psychische Gesundheit?
Eine mangelhafte Vermittlung von Strategien zur Ärgerbewältigung (z.B. ständige Unterdrückung oder unkontrollierte Ausbrüche) kann zu chronischem Stress, Depressionen oder psychosomatischen Erkrankungen führen.
- Quote paper
- Magistra Artium Daniela Herbst (Author), 2002, Die Sozialisation des Ärgers und ihre Bedeutung (für die psychische Gesundheit), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/56543