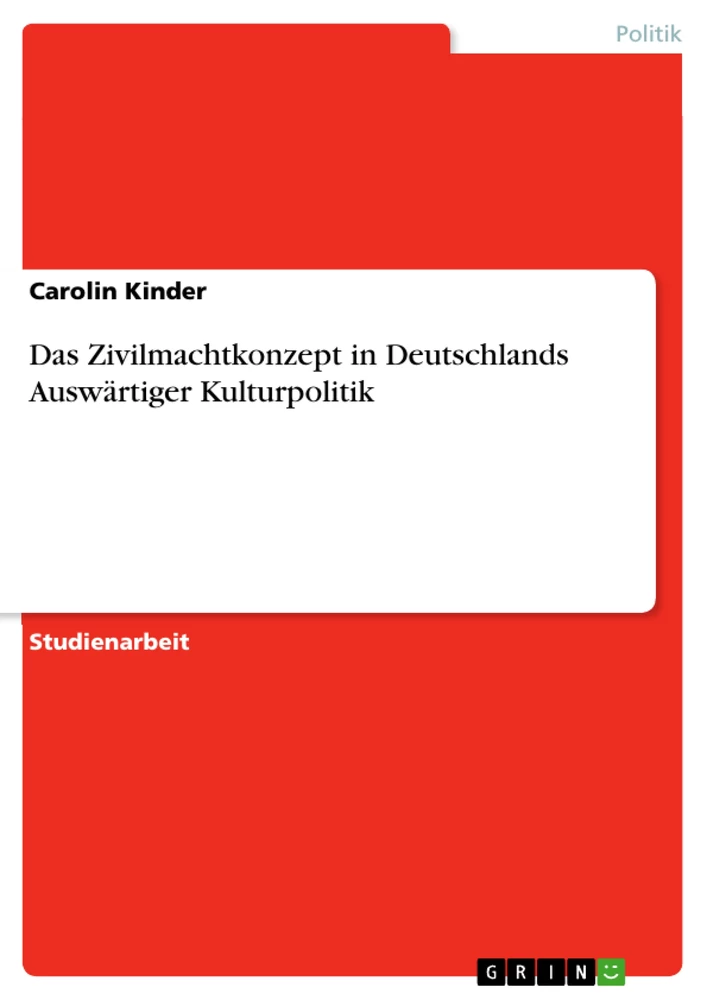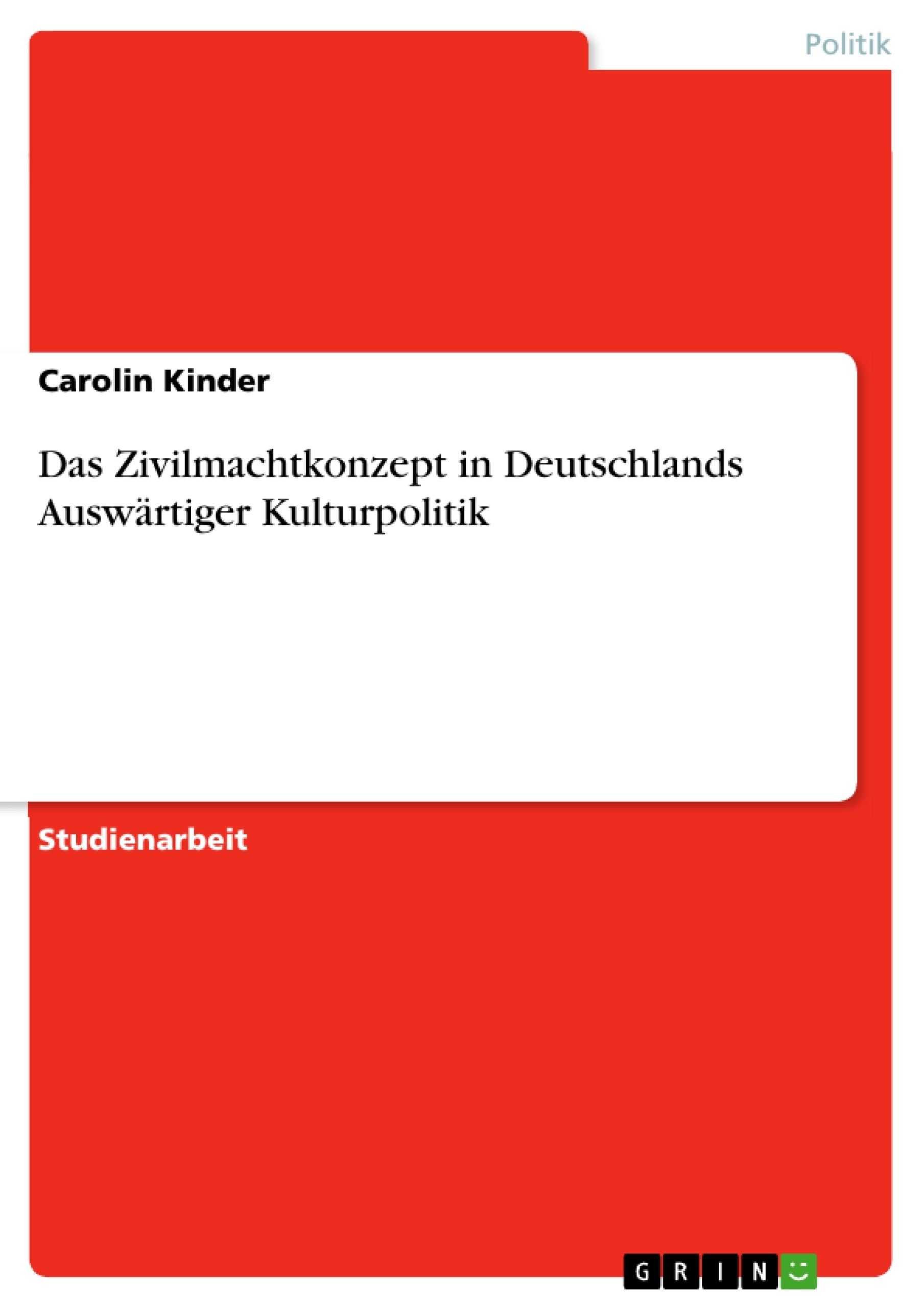Die Wichtigkeit und den Bedarf dieser Arbeit wurde mit den Terrorakten des 11. Septembers unterstrichen. Auswärtige Kulturpolitik kann dabei eine auf Friedenserhaltung, Konfliktprävention und Verwirklichung der Menschenrechte ausgerichtete Außenpolitik bestärken. Die Fähigkeiten, in anderen Kulturen zu denken und zu fühlen, ist für die Fragen der Sicherheitspolitik unverzichtbar. Die Annäherung durch Dialog kann eine Basis für gemeinsame Verständigung schaffen und sich so als Konfliktpotentiale vermindernde Kommunikation verstehen. Daher wird in Deutschland die Auswärtige Kulturpolitik als „dritte Säule der Außenpolitik“ bezeichnet. Bei so viel positiver Leistung ist es geradezu verwunderlich, wenn in der Zeitschrift für Kulturaustausch 4/01 festgestellt wird, „dass ausgerechnet die Auswärtige Kulturpolitik einen hohen Nachholbedarf an wissenschaftlicher Begleitung hat". Dabei kann gerade die Wissenschaft dabei helfen, Komplexität durchschaubar zu machen, Entwicklungslinien zu zeichnen und womöglich auch Handlungsoptionen zu benennen. Zur theoretischen Analyse der Auswärtigen Kulturpolitik lassen sich dabei die Theorien der Außenpolitik fast problemlos verwenden. So können sowohl der Realismus, Liberalismus als auch der Konstruktivismus als die drei Hauptparadigmen der allgemeinen Außenpolitik in gewissen Bereichen der Kulturpolitik Erklärungshilfen leisten, wenn Kulturpolitik als ein spezielles Gebiet der Außenpolitik gesehen wird. Neben diesen „klassischen“ Paradigmen bildete sich mit dem „Zivilmachtansatz“ ein neuer Forschungsstrang in den Internationalen Beziehungen heraus. Universelle Werte wurden dabei als Bestandteil nationaler Interessen gesehen. Aus einem kollektiven Identitätsbewusstsein ergibt sich das Bekenntnis zu einer explizit wertorientierte Außenpolitik. Anfang der 1990er wurde dieses Konzept von Hanns W. Maull auch auf Deutschland angewandt. Ziel dieser Arbeit soll es nun sein zu zeigen, ob und in wieweit die Auswärtige Kulturpolitik der Bundesrepublik Deutschland diesem Konzept gerecht wird. Untersuchungsgegenstand wird dabei die „Konzeption 2000“ sein, die vom Auswärtigen Amt nach ausführlicher Erörterung mit dem Ausschuss für Kultur und Medien des Deutschen Bundestages, den Ländern und den Bundesressorts als Leitlinie der Auswärtigen Kulturpolitik entwickelt wurde. Die theoretische Hauptfragestellung dieser Arbeit wird dabei lauten, ob und inwieweit die Ziele und Grundsätze der Konzeption 2000 dem Zivilmachtkonzept entsprechen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Deutsche Auswärtige Kulturpolitik
- II.1. Organisation
- II.2 Konzeptionelle Grundlagen
- III. Das Zivilmachtkonzept
- III.1 Theoretische Konzeption eines Idealtypen
- III.2 Außenpolitische Handlungsmuster und Instrumente einer Zivilmacht
- IV. Analyse der Konzeption 2000
- IV.1 Zivilmacht und Ziele der Auswärtigen Kulturpolitik
- IV.2 Grenzen des Zivilmachtkonzepts für die „Konzeption 2000“
- V. Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert, ob und inwieweit die Auswärtige Kulturpolitik der Bundesrepublik Deutschland dem Zivilmachtkonzept gerecht wird. Sie untersucht dabei die „Konzeption 2000“ als Leitlinie der Auswärtigen Kulturpolitik, die vom Auswärtigen Amt entwickelt wurde. Die Hauptuntersuchungsfrage lautet: Entsprechen die Ziele und Grundsätze der Konzeption 2000 dem Zivilmachtkonzept?
- Bedeutung der Kulturpolitik als wichtiger Faktor der Außenpolitik
- Organisation und Rolle der Auswärtigen Kulturpolitik in Deutschland
- Theoretische Konzeption des Zivilmachtkonzepts
- Analyse der „Konzeption 2000“ im Kontext des Zivilmachtkonzepts
- Grenzen des Zivilmachtkonzepts für die „Konzeption 2000“
Zusammenfassung der Kapitel
- I. Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die Bedeutung der Kulturpolitik als Instrument der Außenpolitik, insbesondere im Kontext des 11. Septembers 2001. Sie unterstreicht die Notwendigkeit wissenschaftlicher Begleitung der Auswärtigen Kulturpolitik und stellt das Zivilmachtkonzept als relevantes analytisches Instrument vor.
- II. Deutsche Auswärtige Kulturpolitik: Dieses Kapitel beschreibt die Organisationsstruktur der Auswärtigen Kulturpolitik in Deutschland und erklärt die Rolle des Auswärtigen Amts sowie die Bedeutung gesellschaftlicher Mittlerorganisationen. Es beleuchtet die „Konzeption 2000“ als Leitlinie der Auswärtigen Kulturpolitik.
- III. Das Zivilmachtkonzept: Dieses Kapitel stellt die theoretische Konzeption des Zivilmachtkonzepts vor und erläutert seine zentralen Elemente. Es skizziert die Außenpolitischen Handlungsmuster und Instrumente, die mit dem Zivilmachtansatz verbunden sind.
- IV. Analyse der Konzeption 2000: Dieses Kapitel untersucht, ob und inwieweit die Ziele und Grundsätze der „Konzeption 2000“ dem Zivilmachtkonzept entsprechen. Es analysiert die Rolle des Zivilmachtkonzepts in der Auswärtigen Kulturpolitik und beleuchtet die möglichen Grenzen des Konzepts für die „Konzeption 2000“.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Themen der deutschen Auswärtigen Kulturpolitik und dem Zivilmachtkonzept. Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Auswärtige Kulturpolitik, Zivilmachtkonzept, „Konzeption 2000“, Mittlerorganisationen, Kulturdiplomatie, transnationale Kooperation, Werteorientierung, Friedenserhaltung, Konfliktprävention.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet „Auswärtige Kulturpolitik“ als dritte Säule der Außenpolitik?
Sie ergänzt die politische und wirtschaftliche Außenpolitik durch den Dialog zwischen Kulturen, um Friedenserhaltung und Konfliktprävention zu fördern.
Was ist das „Zivilmachtkonzept“ nach Hanns W. Maull?
Es beschreibt einen Außenpolitik-Ansatz, bei dem universelle Werte als Teil nationaler Interessen gesehen werden und die Politik explizit wertorientiert handelt.
Was ist die „Konzeption 2000“?
Es ist die vom Auswärtigen Amt entwickelte Leitlinie für die deutsche Auswärtige Kulturpolitik zu Beginn des 21. Jahrhunderts.
Welche Rolle spielen Mittlerorganisationen in Deutschland?
Gesellschaftliche Mittlerorganisationen (wie das Goethe-Institut) setzen die Ziele der Auswärtigen Kulturpolitik operativ um und fördern die transnationale Kooperation.
Warum ist Kulturpolitik für die Sicherheitspolitik wichtig?
Besonders nach den Terroranschlägen des 11. Septembers wurde klar, dass die Fähigkeit, in anderen Kulturen zu denken, unverzichtbar für die Vermeidung von Konfliktpotentialen ist.
Entspricht die deutsche Kulturpolitik dem Zivilmachtkonzept?
Die Arbeit analysiert, inwieweit die Ziele der Konzeption 2000 (Menschenrechte, Dialog) diesen theoretischen Idealtyp einer Zivilmacht widerspiegeln.
- Citation du texte
- Carolin Kinder (Auteur), 2003, Das Zivilmachtkonzept in Deutschlands Auswärtiger Kulturpolitik , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/56683