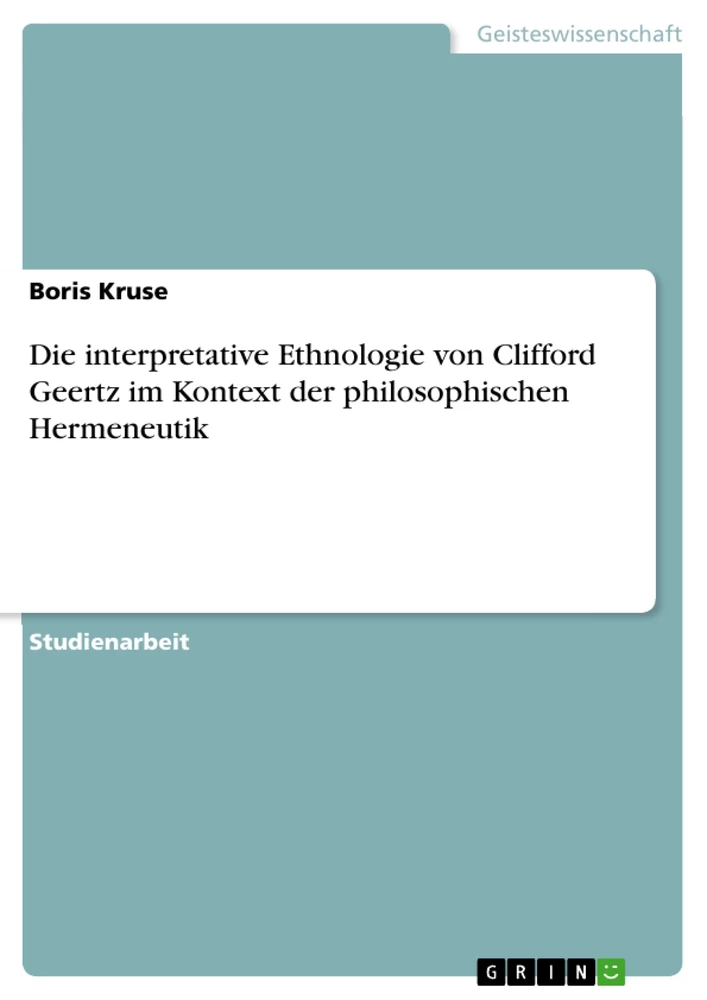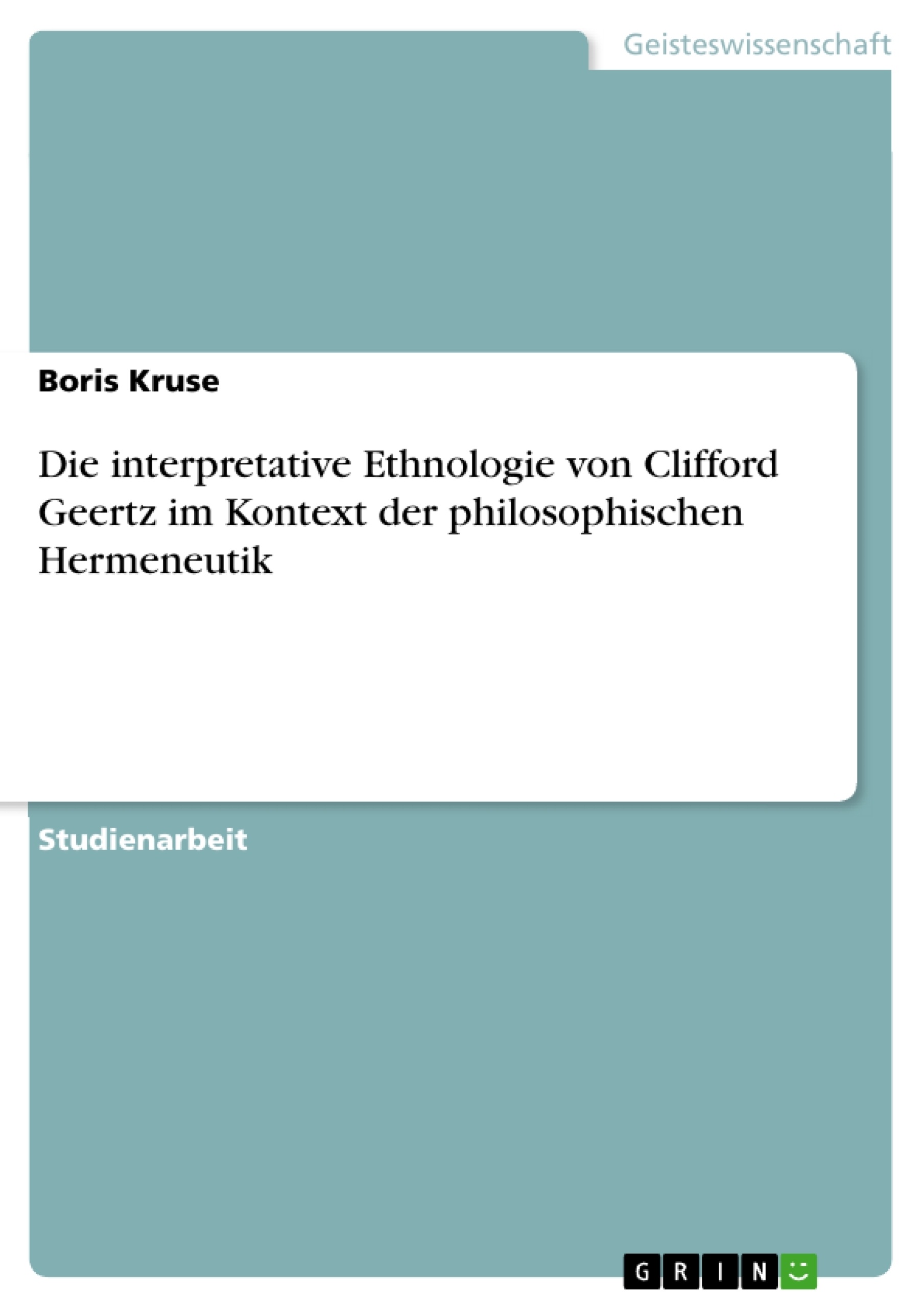Seit den 60er Jahren haben in der Ethnologie Auseinandersetzungen über die Darstellbarkeit von Kultur stattgefunden. Im Gegensatz zu vorangegangenen Fachdebatten wurde dabei nicht mehr vorrangig auf spezifische anthropologische Konzeptionen Bezug genommen, sondern v.a. auf die deutende Tätigkeit des Ethnologen bei der Erarbeitung seines Forschungsberichtes, sprich der Ethnographie. Nicht erst seit Etablierung der teilnehmenden Beobachtung im anthropologischen Diskurs durch Bronislaw Malinowski stützte sich ethnographische Autorität in weitgehendem Ausmaß auf publizierte Erlebnisberichte über Feldforschungen. Ein Wissenschaftler, der möglichst umfassende sprachliche und sonstige kulturelle Vorkenntnisse zu besitzen hatte, unternahm ausgedehnte Reisen zu den fremden Kulturen, an deren Leben er dann im Idealfall als gleichwertiges Gesellschaftsmitglied teilhaben sollte. Daran schloß sich eine Aufarbeitung der gewonnenen Einsichten in Form einer Monographie oder eines wissenschaftlichen Artikels mit quasi-realistischem Erzählgestus an. Kultur, so könnte das Credo des entsprechenden Wissenschaftsverständnisses subsumiert werden, läßt sich weitgehend objektiv und in allgemeingültigen Ausdrücken und Kategorien erfassen, wenn der Forscher nur gründlich und unvoreingenommen arbeitet- will sagen: wenn er seine eigenen Vorurteile zu überwinden und statt dessen den vermeintlich unbestechlichen Blick des Wissenschaftlers zu gebrauchen versteht. An einer derartigen Ausübung ethnographischer Autorität wurden zunehmend Zweifel geäußert. Neue Denkansätze, die aus der Philosophie oder auch der Philologie übernommen wurden, fanden erstmals Eingang in den kulturwissenschaftlichen Diskurs. Als besonders fruchtbar erwies sich dabei die Hermeneutik. Einen Markstein stellen die Schriften des US-amerikanischen Ethnologen Clifford Geertz und dessen Programm einer interpretativen Ethnologie dar. Die Aufgabe dieser Arbeit wird es sein, den philosophiegeschichtlichen Hintergrund, vor dem Geertz seinen Ansatz entwickelte, zu rekonstruieren Dazu sollen herausragende Positionen hermeneutischer Philosophie bis zur 2. Hälfte des 20.Jh.s herangezogen werden. Im Anschluß daran wird sich die Frage stellen, ob Geertz den daraus resultierenden als auch den selbstgestellten Ansprüchen gerecht geworden ist oder nicht. Ferner soll diskutiert werden, ob Geertz mit seinen Beiträgen dem anthropologischen Wissenschaftsdiskurs einen ernstzunehmenden Beitrag für eine weitergehende Debatte geliefert hat.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Hermeneutik im Wandel der Zeit
- 2.1. Grundlagen: die klassische Hermeneutik
- 2.2. Die Hermeneutik nach der Aufklärung: Schleiermacher
- 2.3. Der Historismus: Dilthey
- 2.4. Die ontologische Wendung und die Hermeneutik des 20. Jh.s
- 2.4.1. Das Vorurteil im Verstehensprozeß
- 2.4.2. Die Bedeutung der Frage
- 3. Clifford Geertz und die Hermeneutik
- 3.1. Direkte Anknüpfungspunkte an die Hermeneutik
- 3.1.1. Der Common Sense- Begriff
- 3.1.2. Erfahrungsnahe vs. erfahrungsferne Darstellungen
- 3.1.3. Zeitlichkeit und Horizont
- 3.2. Geertz Kulturbegriff
- 3.2.1. Exkurs: Paul Ricoeur
- 3.2.2. Kultur als offenes Buch
- 4. Das Problem der Dialogizität in Philosophie, Philologie und Ethnologie
- 4.1. Geertz` monologische Auffassung des hermeneutischen Zirkels
- 4.2. Die Dialektik des hermeneutischen Zirkels
- 4.3. Die Stellung des Subjektes bei Geertz
- 4.4. Ausblicke auf einen selbstreflexiven Ansatz in der interpretativen Ethnologie
- 5. Schlußbetrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit rekonstruiert den philosophiegeschichtlichen Hintergrund von Clifford Geertz’ Ansatz der interpretativen Ethnologie. Sie untersucht, inwieweit Geertz den Ansprüchen der Hermeneutik gerecht wird und einen Beitrag zur anthropologischen Debatte leistet.
- Die Entwicklung der Hermeneutik vom 16. Jahrhundert bis zur zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
- Die Verbindung von Clifford Geertz’ Werk zur hermeneutischen Tradition
- Das Problem der Dialogizität in der Interpretation
- Die Rolle des Subjekts in der interpretativen Ethnologie
- Die Bedeutung von Geertz’ Werk für die anthropologische Forschung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel erläutert den historischen Kontext der Debatte um die Darstellbarkeit von Kultur in der Ethnologie und führt die Arbeit von Clifford Geertz als einen Wendepunkt ein. Das zweite Kapitel beleuchtet die Entwicklung der Hermeneutik von der klassischen Periode bis zur ontologischen Wendung des 20. Jahrhunderts. Dabei werden die Beiträge von Schleiermacher und Dilthey hervorgehoben. Das dritte Kapitel analysiert Geertz’ Verbindung zur Hermeneutik und seine Definition von Kultur als einem „offenen Buch“. Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit der Dialogizität in der Interpretation und Geertz’ monologischer Auffassung des hermeneutischen Zirkels. Abschließend wird diskutiert, inwieweit Geertz’ Ansatz einen selbstreflexiven Ansatz in der interpretativen Ethnologie ermöglicht.
Schlüsselwörter
Hermeneutik, Clifford Geertz, interpretative Ethnologie, Kulturbegriff, Dialogizität, hermeneutischer Zirkel, subjektive Interpretation, Ethnographie, Feldforschung, Common Sense.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Clifford Geertz unter "interpretativer Ethnologie"?
Geertz betrachtet Ethnologie nicht als objektive Beobachtung, sondern als Deutung von Kultur, die er als ein System von Symbolen oder als "offenes Buch" versteht.
Was ist der hermeneutische Zirkel?
Es ist ein Verstehensprozess, bei dem das Ganze aus dem Einzelnen und das Einzelne aus dem Ganzen begriffen wird, was Geertz auf die Analyse von Kulturen überträgt.
Wie grenzt sich Geertz von der klassischen Ethnographie ab?
Er zweifelt an der rein objektiven Darstellbarkeit von Kultur und betont stattdessen die subjektive Rolle des Forschers beim Verfassen des Forschungsberichtes.
Welche Rolle spielt Paul Ricoeur in diesem Kontext?
Ricoeurs Philosophie diente Geertz als wichtige theoretische Grundlage, insbesondere die Idee, soziales Handeln wie einen Text zu lesen.
Was bedeutet "Common Sense" bei Geertz?
Geertz analysiert den gesunden Menschenverstand als kulturelles System, das je nach Gesellschaft unterschiedliche Formen annimmt und interpretiert werden muss.
- Citar trabajo
- Boris Kruse (Autor), 2003, Die interpretative Ethnologie von Clifford Geertz im Kontext der philosophischen Hermeneutik, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/56725