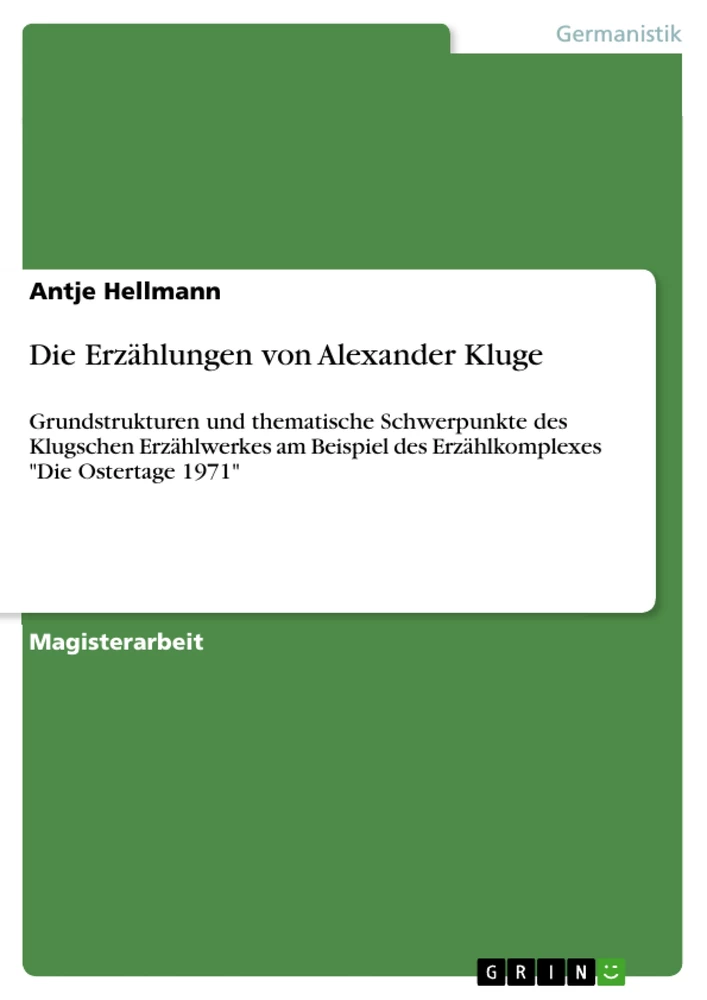Drei dicke Bände mit einem Gewicht von schätzungsweise drei Kilo vereinen das erzählerische Gesamtwerk von Alexander Kluge. Im Jahr 2000 erschien die Chronik der Gefühle mit den zwei Bänden Basisgeschichten und Lebensläufe,die sowohl die teilweise überarbeiteten Erzählungen aus den 60er-, 70er- und 80er- Jahren als auch zahlreiche neue enthalten, die in den 90ern vor allem unter dem Eindruck der Wende und dem Zerfall der Sowjetunion entstanden sind. Kluge betrachtet alle diese Geschichten als eine Einheit. 2003 veröffentlichte er weitere 500 Erzählungen unter dem GesamttitelDie Lücke, die der Teufel läßt. Im Vorwort schreibt er, dass damit „die SUCHE NACH ORIENTIERUNG“ fortgesetzt wird, aber unter einem neuen Erzählinteresse. Während in derChronik der Gefühle„die subjektive Seite, d.h. das menschliche Gefühl und die Zeit“ eine Rolle spielten, und es darum ging, „die Lücken zu finden, in denen sich Leben bewegt“, tritt in dem neuen Erzählband „die Geisterwelt der objektiven Tatsachen“ stärker in den Vordergrund. In Kluges Geschichten wird die Frage verhandelt, welchen Anteil subjektive Gefühle und objektive Tatsachen an der Konstitution der Welt, an der Vorstellung von Realität und Wahrheit haben. Schon die frühen Geschichten von Kluge beschäftigen sich mit der Welt der Tatsachen, und meistens erscheint diese als übermächtig. Die Erzählungen von 1973, die unter dem Titel Lernprozesse mit tödlichen Ausgang erstmalig veröffentlicht wurden, bezeichnet Wilhelm Heinrich Pott als „durchweg melancholisch“. Ähnlich wie auch schon in dem 1962 erschienenen ErzählbandLebensläufe wird über die Menschen in der Bundesrepublik, im prosperierenden Nachkriegsdeutschland mit einer „seismographische[n] Empfindlichkeit für die Regungen des Alltags“ berichtet. Kluge, dem es darum geht, Zusammenhänge in der Gesellschaft sichtbar zu machen, wendet sich in einer Spektralanalyse allen sozialen Schichten und Generationen zu. Insbesondere interessieren ihn die gehobenen Mittelschichten; Ingenieure, Offiziere, Juristen, Ärzte, Philologen, generell Wissenschaftler. Ins Blickfeld geraten aber auch Arbeiter, Hausfrauen, Verkäuferinnen sowie diverse Vertreter der Unterwelt, Kriminelle, Zuhälter und Prostituierte. Es sind keine Erfolgsgeschichten. Das Leben der Menschen ist seltsam gefangen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. ARBEIT UND LEBEN
- 3. GRUNDLEGENDE ERZÄHLTECHNISCHE MITTEL
- 3.1 DAS PARADIGMATISCHE ERZÄHLEN AM BEISPIEL VON PFÖRTLS REISE
- 3.2 PERSPEKTIVWECHSEL, PARODIE, KOMIK UND IRONIE
- 3.3 DAS PRINZIP DER MONTAGE
- 3.4 FIKTION ODER AUTHENTIZITÄT ODER FIKTIVE AUTHENTIZITÄT
- 3.5 DIE HERSTELLUNG VON „ZUSAMMENHANG“
- 4. DIE DURCH DIE ARBEITSZEIT DIALEKTISCH DEFINIERTE FREIZEIT
- 4.1 GRENZEN DER INDIVIDUELLEN ERFAHRUNGSBILDUNG
- 4.2 ÜBERTRAGUNG DES PRODUKTIONSRHYTHMUS AUF DIE FREIZEIT
- 4.3 MEHR SCHEIN ALS SEIN – DIE TOTALVERWEIGERUNG DES CHEFFAHRERS LÖWE
- 4.4 DIE ENTFREMDUNG VOM EIGENEN KÖRPER BEIM CHEMIKER DRALLE
- 4.5 AUSWIRKUNGEN AUF DAS BEZIEHUNGSLEBEN
- 4.5.1 Nichts fließt bei der Jugend
- 4.5.2 Resignation im Familienleben
- 4.6 DIE FLUCHT IN DEN KONSUM
- 5. DER DISKURS ÜBER DIE ENTFREMDUNG
- 5.1 ENTFREMDUNG VOM NATURZUSTAND BEI ROUSSEAU
- 5.2 WIEDERERLANGUNG DER GANZHEITLICHKEIT DURCH HÖHERE KUNST BEI SCHILLER
- 5.3 DIE UNTERSCHEIDUNG ZWISCHEN LEBENDIGER UND TOTER ARBEIT BEI MARX
- 5.4 DAS BESONDERE im WÜRGEGRIFF DES ALLGEMEINEN BEI ADORNO
- 5.5 WERTIGKEIT DER PHILOSOPHISCHEN THEORIEN
- 6. DER SYSTEMABHÄNGIGE DENKER
- 6.1 WORAN LEIDET PHILIPP DaLQUEN?
- 6.2 THEORIE VERSUS PRAXIS
- 6.3 KEINE GRENZEN FÜR DIE UNENDLICHE ANSTRENGUNG
- 7. DAS STÖRPOTENTIAL DER FREIZEIT - DIE UNGLÜCKE NEHMEN ZU
- 8. DAS AUF ARBEIT PROGRAMMIERTE INDIVIDUUM
- 8.1 DAS WUNDER DES VERSCHWUNDENEN STEINS
- 8.2 KURZURLAUB ALS SCHNELLREPARATUR AM BEISPIEL DER FRAU MÜCKERT
- 8.3 JEDER NACH SEINEN FÄHIGKEITEN, KEINEM NACH SEINEN BEDÜRFNISSEN
- 8.4 RACHE SCHLAG UND GEGENSCHLAG
- 8.4.1 Verlust der Selbstkontrolle bedeutet Zeitverlust
- 8.4.2 Die Rache für verlorene Zeit und ungelebtes Leben
- 8.4.3 Die rationalisierte Liebesbeziehung
- 8.4.4 Der unsympathische Held
- 9. MUTZLAFFS OSTERN
- 9.1 DIE WOHNVERHÄLTNISSE
- 9.2 EINSAME AUSGLEICHSBEWEGUNGEN
- 9.3 POESIE UND KreativiTÄT
- 9.4 AUF DER SUCHE NACH DER POESIE
- 9.5 DAS VERSAgen der KultURINDUSTRIE BEI DER BEFRIEDIGUNG MENSCHLICHER SEHNSÜCHTE
- 9.6 MUTZLAFFS GEGENOSTERN
- 10. WEITERFÜHRENDE ZUSAMMENFASSUNG
- 10.1 DIE WIDERSTÄNDIGEN GEFÜHLE ALS ZEUGNIS EINES FALSCHEN LEBENS
- 10.2 HUMOR UND AUFKLÄRUNG BEI KLUGE
- 10.3 DIE THEMATISCHEN BASISEINHEITEN DES ZUSAMMENHANGS
- 10.3.1 Die Ostertage 1971 als Grundbaustein des zusammenhängenden Denkens
- 10.3.2 Lernprozesse mit tödlichem Ausgang
- 10.3.3 Lebensläufe
- 10.3.4 Schlachtbeschreibung
- 10.3.5 Neue Geschichten
- 10.3.6 Chronik der Gefühle
- 10.3.7 Die Lücke, die der Teufel lässt
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit analysiert die Erzählungen von Alexander Kluge und untersucht deren grundlegende Strukturen sowie thematische Schwerpunkte. Die Arbeit konzentriert sich dabei auf den Erzählkomplex „Die Ostertage 1971“ als exemplarischen Fall, um Kluges erzählerische Methoden und zentrale Themen zu beleuchten.
- Analyse der erzähltechnischen Mittel im Werk von Alexander Kluge
- Die Auseinandersetzung mit den Themen Arbeitszeit und Freizeit in den Erzählungen
- Die Darstellung des Entfremdungsdiskurses in Kluges Werk
- Die Untersuchung des „System-abhängigen Denkers“ und dessen Auswirkungen auf das Individuum
- Die Analyse der Rolle von Humor und Aufklärung im Kontext der Klugeschen Erzählkunst
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel wird die Einleitung in die Thematik der Arbeit gegeben. Kapitel 2 beleuchtet das Zusammenspiel von Arbeit und Leben in den Erzählungen, während Kapitel 3 die grundlegenden erzähltechnischen Mittel Kluges anhand von Beispielen aus dem Werk analysiert. Kapitel 4 befasst sich mit der dialektischen Beziehung von Arbeitszeit und Freizeit, während Kapitel 5 den Entfremdungsdiskurs in den Erzählungen untersucht. Kapitel 6 analysiert die Figur des „System-abhängigen Denkers“, während Kapitel 7 die Bedeutung des Störpotenzials der Freizeit für das Individuum beleuchtet. Kapitel 8 untersucht das auf Arbeit programmierte Individuum und dessen Auswirkungen auf das Leben, Kapitel 9 beleuchtet die Geschichte von Mutzlaffs Ostern und dessen Suche nach Poesie. Schließlich fasst Kapitel 10 die zentralen Erkenntnisse der Arbeit zusammen und stellt die Relevanz der Ostertage 1971 als Baustein des zusammenhängenden Denkens in Kluges Erzählwerk heraus.
Schlüsselwörter
Die Arbeit widmet sich den Erzählungen von Alexander Kluge und analysiert insbesondere den Erzählkomplex „Die Ostertage 1971“. Die zentralen Themen der Arbeit sind Arbeitszeit, Freizeit, Entfremdung, System-abhängiges Denken, Humor, Aufklärung, und die Konstitution von Realität und Wahrheit in Kluges Werk.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptthemen in Alexander Kluges Erzählungen?
Zentrale Themen sind die Dialektik von Arbeitszeit und Freizeit, die Entfremdung des Individuums, die Konstitution von Realität und die Suche nach Orientierung in der modernen Gesellschaft.
Was versteht Kluge unter dem "Prinzip der Montage"?
Kluge nutzt die Montage, um verschiedene Textsorten, Fakten und Fiktionen miteinander zu verknüpfen und so neue Zusammenhänge zwischen subjektiven Gefühlen und objektiven Tatsachen sichtbar zu machen.
Welche Rolle spielt die "Entfremdung" in seinem Werk?
Kluge greift Diskurse von Marx, Adorno und Rousseau auf, um zu zeigen, wie der Produktionsrhythmus und gesellschaftliche Zwänge das Privatleben und den Körper des Menschen durchdringen.
Was ist die "Chronik der Gefühle"?
Es ist ein im Jahr 2000 erschienenes erzählerisches Gesamtwerk Kluges, das Lebensläufe und Basisgeschichten vereint und die subjektive Seite der menschlichen Erfahrung beleuchtet.
Wie nutzt Kluge Humor und Ironie?
Humor und Ironie dienen in Kluges Geschichten als Mittel der Aufklärung, um die Absurdität systemabhängigen Denkens und die Gefangenheit des Lebens bloßzustellen.
- Quote paper
- Antje Hellmann (Author), 2004, Die Erzählungen von Alexander Kluge, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/56895