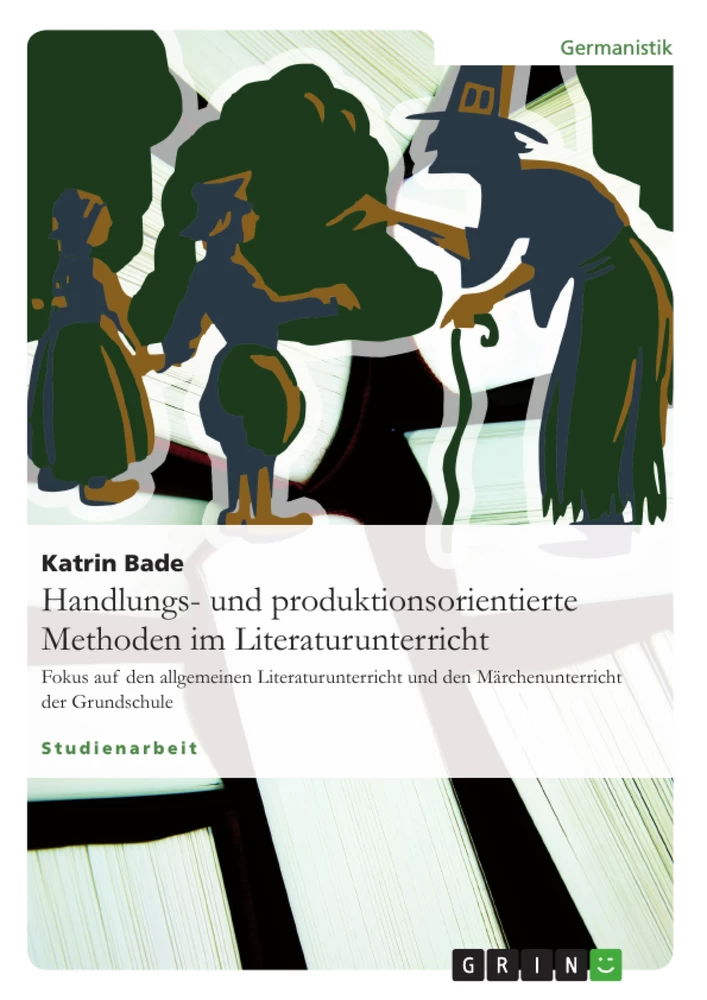Seit der handlungs- und produktionsorientierte Unterricht mit Beginn der 80er als Didaktiktheorie formuliert und in den darauffolgenden Jahren stetig weiterentwickelt wurde, ist diese Unterrichtsform unter anderem im Literaturunterricht aller Schulstufen ein fester Bestandteil. Kaum eine Lehrerhandreichung verzichtet auf Elemente des umfangreichen, von Günter Waldmann erstmals zusammengestellten Katalogs der unterschiedlichen Methoden [Waldmann, 2004, S. 62-85], um den Literaturunterricht fassbarer, motivierender, auf die Bedürfnisse der Schüler abgestimmt und so individueller zu gestalten.
Basierend auf Erkenntnissen verschiedener literaturwissenschaftlicher Strömungen (vor allem der Rezeptionsästhetik und des Dekonstruktivismus), der Pädagogik, der Lernpsychologie und auch der Soziologie (Lesesozialisation und -motivation), ergab sich ein Handlungsbedarf in der Schulpraxis, um dem wohl wichtigsten und grundlegendsten Anspruch des Literaturunterrichts gerecht zu werden: Fördern und Erhalten der Lesemotivation.
Dieser übergeordnete Anspruch ergibt sich aus anderen Zielen des Literaturdidaktik (wie Förderung der Medienkompetenz, Ausbildung der Urteilsfähigkeit und kritischen Herangehensweise, dies unter anderem durch die Kenntnis formaler Strukturen [Hassenstein, 1998, S.482] ), da aus der Lernpsychologie seit langem bekannt ist, dass intrinsisch motiviertes Lernen nachhaltigeren und dauerhafteren Erfolg hat als das, welches durch extrinsische Motivation initiiert wurde.
Trotz dieser schüler- und praxisorientierten Motivation sehen sich die Vertreter dieses Ansatzes in eine anhaltende, sehr kontrovers (teilweise sogar polemisch) geführte Debatte mit den Vertretern des traditionellen Literaturunterrichts verwickelt. Dafür gibt es mehrere Gründe, Hauptargument ist jedoch, dass produktionsorientierte Verfahren zum einen den literarischen Texten nicht gerecht werde und außerdem unwissenschaftlich sei, da die Verfahren gleichbedeutend für guten Unterricht gesehen würden. Dies sei letztendlich aber nichts anderes als "literarisches Basteln".
Die Frage ist also, ob diese beiden Positionen unvereinbar gegenüberstehen oder ob im Interesse der Literatur und der Schüler, die sich mit ihr beschäftigen müssen, ein Kompromiss möglich sein kann. Interessant ist, welche Rolle die produktiven Verfahren dabei einnehmen können. Vor diesem Hintergrund werden Möglichkeiten erörtert, wie Märchen unter verschiedenen Zielsetzungen in der Grundschule produktionsorientiert erarbe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Von einer Methode zu einem didaktischen Ansatz – die Entwicklung
- Der Literaturunterricht zwischen Fachdidaktik und Fachwissenschaft
- Darstellung der Argumentation für die Produktionsorientierung
- Darstellung der Gegenargumentation
- Der „goldene“ Mittelweg
- Handlungs- und produktionsorientierte Verfahren im Unterricht
- Didaktisches Phasenmodell literarischen Textverstehens nach Waldmann
- Die Ordnung der produktiven Verfahren
- Methodische Überlegungen
- Mögliche produktive Verfahren im Märchenunterricht der Grundschule
- Die Sterntaler - Überlegungen für eine erste Klasse
- Frau Holle – Überlegungen für eine vierte Klasse
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert die Entwicklung des handlungs- und produktionsorientierten Ansatzes im Literaturunterricht. Dabei geht es vor allem um die Frage, inwiefern diese Unterrichtsform dem Anspruch gerecht wird, Lesemotivation zu fördern und gleichzeitig wissenschaftlich fundiert ist.
- Entwicklung des handlungs- und produktionsorientierten Ansatzes im Literaturunterricht
- Kritische Betrachtung der Produktionsorientierung im Kontext des heutigen Literaturunterrichts
- Didaktische Modelle und methodische Überlegungen für den produktionsorientierten Literaturunterricht
- Beispiele für produktive Verfahren im Märchenunterricht der Grundschule
- Diskussion der Rolle von produktiven Verfahren für die Lesesozialisation und -motivation
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Entstehung und Verbreitung des handlungs- und produktionsorientierten Unterrichts im Literaturunterricht und stellt den Zusammenhang mit der Förderung der Lesemotivation her. Das zweite Kapitel zeichnet die Entwicklung des Ansatzes von einer bloßen Methode zu einem didaktischen Konzept nach. Dabei werden literaturwissenschaftliche Strömungen, pädagogische und lernpsychologische Erkenntnisse sowie die Rolle des Rezipienten im Literaturprozess beleuchtet. Im dritten Kapitel werden die Argumente für und gegen die Produktionsorientierung im heutigen Literaturunterricht diskutiert.
Das vierte Kapitel widmet sich den handlungs- und produktionsorientierten Verfahren im Unterricht, insbesondere dem didaktischen Phasenmodell nach Waldmann, der Ordnung der produktiven Verfahren und methodischen Überlegungen. Das fünfte Kapitel präsentiert konkrete Beispiele für produktive Verfahren im Märchenunterricht der Grundschule, darunter „Die Sterntaler“ für die erste Klasse und „Frau Holle“ für die vierte Klasse.
Schlüsselwörter
Der Text beschäftigt sich mit den zentralen Begriffen des handlungs- und produktionsorientierten Literaturunterrichts, darunter Lesemotivation, Rezeptionsästhetik, Dekonstruktivismus, produktive Verfahren, didaktische Modelle, Märchenunterricht und Lesesozialisation.
Häufig gestellte Fragen
Was ist handlungs- und produktionsorientierter Literaturunterricht?
Es ist ein didaktischer Ansatz, bei dem Schüler aktiv mit Texten umgehen (z.B. Umschreiben, Vertonen, Illustrieren), um ein tieferes Verständnis und eine höhere Lesemotivation zu entwickeln.
Warum wird dieser Ansatz oft als "literarisches Basteln" kritisiert?
Kritiker befürchten, dass die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Text zugunsten von rein kreativen Tätigkeiten verloren geht und dem literarischen Werk nicht gerecht wird.
Welche Rolle spielt die Rezeptionsästhetik dabei?
Die Rezeptionsästhetik betont, dass der Leser den Sinn eines Textes erst im Akt des Lesens mitgestaltet, was die Grundlage für produktive Verfahren im Unterricht bildet.
Wie kann man Märchen produktionsorientiert unterrichten?
Beispiele sind das Weiterschreiben von Märchen wie "Die Sterntaler" oder das Verändern der Perspektive in "Frau Holle", um die Struktur und Moral des Textes spielerisch zu erfassen.
Was ist das Phasenmodell nach Günter Waldmann?
Es ist ein Modell, das produktive Verfahren in verschiedene Phasen des Textverstehens einordnet, um einen strukturierten und dennoch kreativen Literaturunterricht zu gewährleisten.
- Citar trabajo
- Katrin Bade (Autor), 2006, Handlungs- und produktionsorientierte Methoden im Literaturunterricht, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/57093