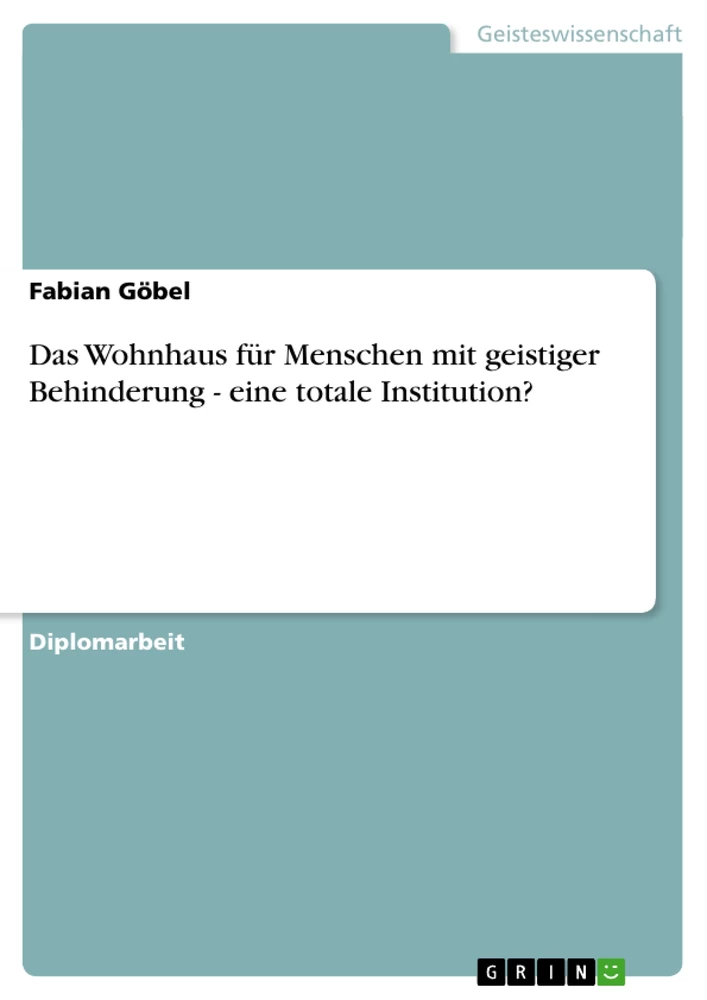den deutschen Bundestag zur Errichtung einer Kommission zur „Enquête der Heime“ aus dem Jahre 2001 heißt es an einer Stelle: „Sie (die Institution Heim) vereinigt oft alle Bedürfnisse unter einem Dach, beschneidet die anthropologische Weltoffenheit des Menschen; sie erfaßt einen Menschen nicht nur hinsichtlich einer spezifischen Behinderung, sondern total; ...“. An anderer Stelle heißt es: „Um sich den Bedingungen der Institution anzupassen, entwickeln Heimbewohner oft passive Verhaltensweisen. Aufgrund der besonderen Abhängigkeits- und Gewaltverhältnisse zu den Mitarbeitern leben sie in der Angst, daß Kritik zu persönlichen Nachteilen führen könnte, was noch mehr für Angehörige gilt.“ Und weiter: „Oftmals rigide Hausordnungen symbolisieren die unvermeidliche Einschränkungen fast aller (!) Grundrechte ...“ und zudem würden „... die institutionellen Strukturen ihre Umsetzbarkeit verunmöglichen ...“. Diese Schrift wurde von zahlreichen Forschern, Fachleuten und Wissenschaftlern unterzeichnet, darunter Experten aus den Bereichen der Behindertenpädagogik, der Pflegewissenschaften, der Gerontologie und der Soziologie. Sie alle sind der Auffassung, dass die gegenwärtige Situation der stationären Unterstützung und Unterbringung Hilfsbedürftiger durch einen in der Sichtweise nicht angemessenen, teilweise sehr veralteten und den Ideen der sozialen Arbeit des 19. Jahrhunderts entsprechenden Rahmen so nicht länger leist- und tragbar sei. Die Idee der Heimunterbringung habe sich in keinster Weise den sich ändernden Realitäten und Lebensbedingungen des Individuums während der letzten 150 Jahre angepasst, so dass der Versorgungstyp Heim „... den Ansprüchen (...) der post- oder spätmodernen Menschen des 21. Jahrhunderts nicht mehr gerecht werden (könne).“
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. ERVING GOFFMAN und die „,Totale Institution“.
- 2.1. ERVING GOFFMAN - Biografie, Motivation und Forschung..
- 2.2. Darstellung des GOFFMANschen Konzepts der „Totalen Institution“.
- 2.2.1. Merkmale einer „Totalen Institution“.
- 2.2.1.1. Arten der „,Totalen Institution“
- 2.2.1.2. Das zentrale Merkmal aller „Totaler Institutionen“.
- 2.2.1.3. Insasse und Personal
- 2.2.1.4. Der Widerspruch zwischen „Drin“ und „Draußen“
- 2.2.1.5. Zusammenfassung.
- 2.2.2. Die Welt der Insassen..
- 2.2.2.1. Direkte Formen der Demütigung des Selbst.
- 2.2.2.2. Versteckte Formen der Demütigung des Selbst..
- 2.2.2.3. Das Privilegiensystem .
- 2.2.2.4. Typen der individuellen Bewältigung..
- 2.2.2.5. Aspekte der Insassenkultur
- 2.2.2.6. Entlassung...
- 2.2.2.7. Zusammenfassung.
- 2.2.3. Die Welt des Personals..
- 2.2.3.1. Mensch und Material
- 2.2.3.2. Ziele und Perspektiven der Institution.
- 2.2.3.3. Zusammenfassung.
- 2.2.4. Anstaltszeremonien
- 2.2.4.1. Formen institutioneller Zeremonien...
- 2.2.4.2. Die institutionelle Zurschaustellung als Indikator der Veränderlichkeit
- 2.2.4.3. Zusammenfassung..
- 2.2.5. Einschränkende Aspekte.
- 2.2.5.1. Gruppenspezifische Rollendifferenzierung..
- 2.2.5.2. Institutionsspezifische Unterschiede.
- 2.2.5.3. Zusammenfassung..
- 2.3. Auswirkung.
- 3. MAUD MANNONI und die „Gesprengte Institution“
- 3.1. MAUD MANNONI – Biografie, Motivation und Forschung..
- 3.2. Darstellung des MANNONIschen Konzepts der „Gesprengten Institution“.
- 3.2.1. MANNONIS Kritik.
- 3.2.1.1. Mechanismen und Funktionen von totalitären Institutionen nach MANNONI
- 3.2.1.2. Die Institution Familie
- 3.2.1.3. Zusammenfassung ....
- 3.2.2. Merkmale der „Gesprengten Institution“
- 3.2.2.1. Das Verhältnis zur Außenwelt..
- 3.2.2.2. Das Prinzip der aktiven Teilhabe
- 3.2.2.3. Das „Fort - Da\" oder: MANNONIS Klientensicht
- 3.2.2.5. Zusammenfassung
- 3.2.3. Die „,,École expérimental - Institution éclatée\" in Bonneuil.
- 3.3. Auswirkung..
- 4. Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Aussagen GOFFMANS und MANNONIS
- 4.1. Gemeinsamkeiten..
- 4.2. Unterschiede
- 4.3. Zusammenfassung.
- 5. Die Dimensionen der Behinderung
- 5.1. Begriffsklärungen......
- 5.1.1. Definitionen von Behinderung.
- 5.1.1.1. Die medizinisch-juristische Definition..
- 5.1.1.2. Die behindertenpädagogische Definition
- 5.1.1.3. Die WHO-Klassifikationen
- 5.1.1.4. Die behindertensoziologische Definition
- 5.1.2. Zusammenfassung
- 5.2. Einrichtungen der stationären Behindertenhilfe.
- 5.2.1. Das Wohnhaus
- 5.2.2. Das außenbetreute Wohnen..
- 5.3. Ziele der stationären Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung..
- 5.3.1. Normalisierung..
- 5.3.2. Integration......
- 5.3.3. Selbstbestimmung
- 5.3.4. Zusammenfassung.
- 6. Merkmale der „,Totalen Institution“ im Bereich der stationären Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung..
- 6.1. Der Aspekt der Übertragbarkeit
- 6.1.1. Bewohner = Insasse?
- 6.1.2. Anteile der „Totalen Institution\" im Wohnhaus..
- 6.1.2.1. Das Merkmal der Trennung der Orte.
- 6.1.2.2. Die Rollen der Insassen und des Personals
- 6.1.2.3. Der Einzug ins Wohnhaus
- 6.1.2.4. Demütigung und Wiederaufbau des Selbst..
- 6.1.2.5. Eine Chance zum Wiederaufbau des Selbst: Die Privilegien im Wohnhaus und ihre Funktion......
- 6.1.2.6. Bewältigungsmöglichkeiten
- 6.1.2.7. Typen der individuellen Anpassung.
- 6.1.2.8. Vergeudete Zeit?.
- 6.1.2.9. Aspekte des Auszuges
- 6.1.2.10. Das offizielle Ziel und seine inoffiziellen Folgen.
- 6.1.2.11. Interpretationsprozesse
- 6.1.2.12. Willkürliche Arbeitsdienste?.
- 6.1.2.13. Zeremonien
- 6.1.2.14. Öffentlichkeitsarbeit oder Zurschaustellung?
- 6.2. Auswertung………………………………
- 7. Wohnhaus und Sprengung..
- 7.1. Der kleinste gemeinsame Nenner?.
- 7.2. Partielle oder totale Sprengung?.
- 7.3. MANNONI und das Wohnhaus
- 7.3.1. Das Wohnhaus durch MANNONIS Brille
- 7.3.2. Wo werden die Sprengsätze gezündet?..
- 8. Schlussgedanken ........
- 8.1. Alternativen für die Praxis
- 8.1.1. Der persönliche Beitrag.
- 8.1.2. Ein differenziertes und individuelles Angebot.
- 8.1.3. Das „Persönliche Budget“.
- 8.2. Ausblick.
- Übertragung der Theorien von Goffman und Mannoni auf den Kontext der stationären Behindertenhilfe
- Analyse der Merkmale einer „Totalen Institution“ im Wohnhaus
- Bewertung der Möglichkeiten einer „Sprengung“ der Institution Wohnhaus im Sinne Mannoni
- Kritik an den Bedingungen und Auswirkungen von stationärer Behindertenhilfe
- Suche nach alternativen, selbstbestimmungsorientierten Ansätzen in der Behindertenhilfe
- Kapitel 2: Dieses Kapitel beleuchtet die Theorie der „Totalen Institution“ von Erving Goffman. Es werden die Merkmale einer „Totalen Institution“ beschrieben und die Auswirkungen auf Insassen und Personal analysiert.
- Kapitel 3: Das Kapitel beschäftigt sich mit dem Konzept der „Gesprengten Institution“ von Maud Mannoni. Es werden die Kritikpunkte an totalitären Institutionen und die Merkmale einer „Gesprengten Institution“ dargestellt.
- Kapitel 5: Das Kapitel liefert einen Überblick über den Begriff der Behinderung und die verschiedenen Definitionen. Außerdem werden die Einrichtungen der stationären Behindertenhilfe und die Ziele der stationären Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung vorgestellt.
- Kapitel 6: Das Kapitel befasst sich mit der Übertragbarkeit des Konzepts der „Totalen Institution“ auf den Bereich der stationären Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung. Es werden die Merkmale einer „Totalen Institution“ im Wohnhaus analysiert und ihre Auswirkungen auf die Bewohner untersucht.
- Kapitel 7: Dieses Kapitel befasst sich mit der „Sprengung“ des Wohnhauses im Sinne von Mannoni. Es werden die Möglichkeiten und Grenzen einer partiellen oder totalen Sprengung diskutiert.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit analysiert das Wohnhaus für Menschen mit geistiger Behinderung anhand der Theorien von Erving Goffman und Maud Mannoni. Sie untersucht, ob und inwiefern die Konzepte der „Totalen Institution“ und der „Gesprengten Institution“ auf die stationäre Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung anwendbar sind.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Totale Institution, Gesprengte Institution, Behinderung, stationäre Behindertenhilfe, Wohnhaus, Normalisierung, Integration, Selbstbestimmung, Goffman, Mannoni
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine "Totale Institution" nach Erving Goffman?
Eine Einrichtung, in der alle Lebensbereiche (Schlafen, Arbeiten, Freizeit) unter einer einzigen Autorität am selben Ort stattfinden und streng reglementiert sind.
Können Wohnhäuser für Menschen mit Behinderung totale Institutionen sein?
Die Arbeit analysiert kritisch, ob starre Hausordnungen und Abhängigkeitsverhältnisse im Wohnhaus Züge einer totalen Institution aufweisen.
Was bedeutet "Sprengung" der Institution nach Maud Mannoni?
Es bezeichnet die Überwindung totalitärer Strukturen durch aktive Teilhabe der Klienten und eine stärkere Öffnung zur Außenwelt.
Welche Ziele verfolgt die moderne stationäre Behindertenhilfe?
Zentral sind die Prinzipien der Normalisierung, Integration und vor allem der Selbstbestimmung der Bewohner.
Was ist das "Persönliche Budget"?
Ein Finanzierungsmodell, das Menschen mit Behinderung ermöglicht, notwendige Unterstützungsleistungen selbst einzukaufen und so ihre Autonomie zu stärken.
- Quote paper
- Fabian Göbel (Author), 2005, Das Wohnhaus für Menschen mit geistiger Behinderung - eine totale Institution?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/57161