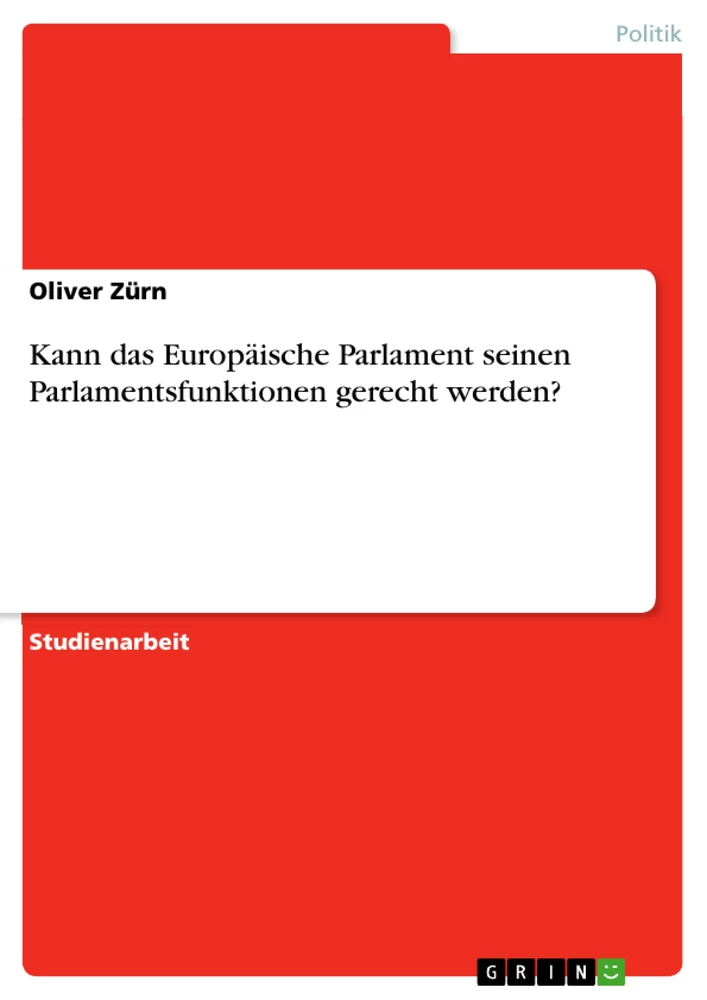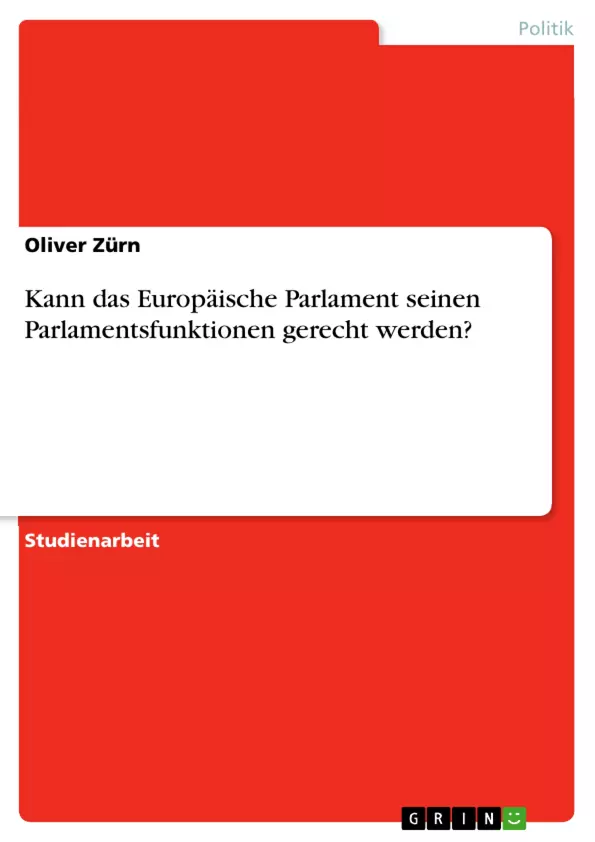Im Jahre 1999 zählt die Europäische Union, ausgehend von den fünfzehn Mitgliedstaaten, etwa 376 Millionen Menschen. Mit dem Beitritt von Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Slowenien, Malta und Zypern am 1. Mai 2004 erfolgt eine weitere größere Ausdehnung der EU auf 25 Mitgliedsstaaten. So werden auch in diesen zehn neuen Mitgliedsstaaten die Bürger dazu angehalten neben den Wahlen zu ihren nationalen Volksvertretungen auch an denen eines Europäischen Parlaments (EP) teilzunehmen. Doch was können die Menschen in den einzelnen Mitgliedstaaten von diesem Parlament erwarten hinsichtlich dessen Befugnisse und Kompetenzen, schließlich ist es die einzige von den Bürgern der EU direkt legitimierte Institution?
So meinte Elmar Brok, Vertreter des EP, 1997 auf der Amsterdamer Regierungskonferenz: „Durch die Fortentwicklung der Parlamentsrechte sei das Europäische Parlament jetzt ein entscheidender Faktor der europäischen Politik und ein vollgültiges Parlament geworden [und] keine wichtige Entscheidung könne mehr ohne Zustimmung oder Mitentscheidung des EP getroffen werden...“2.
Gegenstand dieser Arbeit soll sein zu betrachten, ob das EP auch wirklich einem „vollgültigen“ Parlament entspricht, wie man es in einer parlamentarischen Demokratie vorfindet und inwiefern es seinen Parlamentsfunktionen gerecht wird. Für eine erste Annäherung an dieses Thema empfiehlt sich Werner Weidenfeld „Europa-Handbuch“ oder Fritzler / Unser „Die Europäische Union“. Desweiteren sind auch Neuhold „Das Europäische Parlament im Rechsetzungsprozess der EU“, Saalfrank „Funktionen und Befugnisse des Europäischen Parlaments“ sowie Sebaldt „Parlamentarismus im Zeitalter der Europäischen Integration“ von Bedeutung für diese Arbeit. Die Literatur hierzu ist sehr breit gefächert und ich möchte mich aufgrund der Aktualität dieses Themas bzw. des noch immerwährenden Prozesses lediglich auf die Entwicklungen bis zum Vertrag von Nizza im Jahre 2000 beschränken.
Zuerst möchte ich mit einer kurzen Betrachtung der Geschichte und der Entwicklung des EP beginnen, bevor auf die Europäischen Parteien eingegangen werden soll. Desweiteren folgt eine allgemeine Definition der Parlamentsfunktionen, nach der sich die Analyse der Befugnisse und Funktionen des EP anschließt. Zuletzt folgen dann noch Verbesserungsmöglichkeiten zur Stärkung des EP.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1 Einführung
- 2 Allgemeine Beschreibung des Europäischen Parlaments
- 2.1 Entstehung und Entwicklung
- 2.2 Zusammensetzung und Sitz
- 2.3 Die Europäischen Parteien
- 2.4 Die Repräsentation der europäischen Bürger und der Mitgliedstaaten
- 3 Definition der Parlamentsfunktionen
- 4 Die Funktionen und Befugnisse des Europäischen Parlaments
- 4.1 Der Einfluss auf die Wahl der Regierung der EU
- 4.2 Rechtsetzungsbefugnisse
- 4.2.1 Das Verfahren der Anhörung
- 4.2.2 Das Verfahren der Zustimmung
- 4.2.3 Das Verfahren der Zusammenarbeit
- 4.2.4 Das Verfahren der Mitentscheidung
- 4.3 Kontrollrechte
- 4.4 Haushaltsbefugnisse
- 4.5 Kommunikations- und Repräsentationsfunktion
- 5 Fazit und Ausblick
- 6 Bibliographie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Frage, ob das Europäische Parlament seinen Parlamentsfunktionen gerecht werden kann. Die Arbeit analysiert die Geschichte, Zusammensetzung und Befugnisse des Europäischen Parlaments und untersucht, inwieweit es als ein „vollgültiges“ Parlament im Sinne einer parlamentarischen Demokratie betrachtet werden kann.
- Entstehung und Entwicklung des Europäischen Parlaments
- Zusammensetzung und Sitz des Europäischen Parlaments
- Die Funktionen und Befugnisse des Europäischen Parlaments
- Die Repräsentation der europäischen Bürger und der Mitgliedstaaten durch das Europäische Parlament
- Verbesserungsvorschläge zur Stärkung des Europäischen Parlaments
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel gibt einen Überblick über die Geschichte und Entwicklung des Europäischen Parlaments, beginnend mit dem Haager Kongress der Europäischen Bewegung im Jahr 1948. Der Abschnitt geht auf die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) im Jahr 1951 und die spätere Bildung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und der Europäischen Atomgemeinschaft (EAG) ein. Die Entwicklung der „Gemeinsamen Versammlung“ zum „Europäischen Parlament“ wird ebenfalls beschrieben.
Das zweite Kapitel analysiert die Zusammensetzung und den Sitz des Europäischen Parlaments. Es beleuchtet die Repräsentation der europäischen Bürger und der Mitgliedstaaten durch das Parlament und behandelt die Frage, wie die Europäischen Parteien den politischen Prozess beeinflussen.
Das dritte Kapitel bietet eine Definition der Parlamentsfunktionen, die für die Analyse der Befugnisse des Europäischen Parlaments im vierten Kapitel von Bedeutung sind. Das vierte Kapitel untersucht die verschiedenen Funktionen und Befugnisse des Europäischen Parlaments, darunter der Einfluss auf die Wahl der Regierung der EU, die Rechtsetzungsbefugnisse, die Kontrollrechte, die Haushaltsbefugnisse und die Kommunikations- und Repräsentationsfunktion.
Schlüsselwörter
Europäisches Parlament, Parlamentsfunktionen, Europäische Union, Rechtsetzung, Kontrollrechte, Haushaltsbefugnisse, Repräsentation, Europäische Parteien, Europäische Integration.
Häufig gestellte Fragen
Ist das Europäische Parlament ein 'vollgültiges' Parlament?
Die Arbeit untersucht, inwieweit das EP im Vergleich zu nationalen Parlamenten über ausreichende Gesetzgebungs- und Kontrollkompetenzen verfügt.
Welche Rechtsetzungsverfahren gibt es im EP?
Wichtige Verfahren sind die Anhörung, die Zustimmung, die Zusammenarbeit und insbesondere das Mitentscheidungsverfahren (heute ordentliches Gesetzgebungsverfahren).
Welche Kontrollrechte hat das Europäische Parlament?
Das Parlament kontrolliert die Europäische Kommission, kann ihr das Misstrauen aussprechen und ist an der Ernennung des Kommissionspräsidenten beteiligt.
Was sind die Haushaltsbefugnisse des EP?
Das EP entscheidet gemeinsam mit dem Rat über den jährlichen Haushaltsplan der EU und muss dem Gesamthaushalt zustimmen.
Wie werden die Bürger im EP repräsentiert?
Das EP ist das einzige direkt von den Bürgern der EU gewählte Organ, was ihm eine besondere demokratische Legitimation verleiht.
- Quote paper
- Oliver Zürn (Author), 2003, Kann das Europäische Parlament seinen Parlamentsfunktionen gerecht werden?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/57247