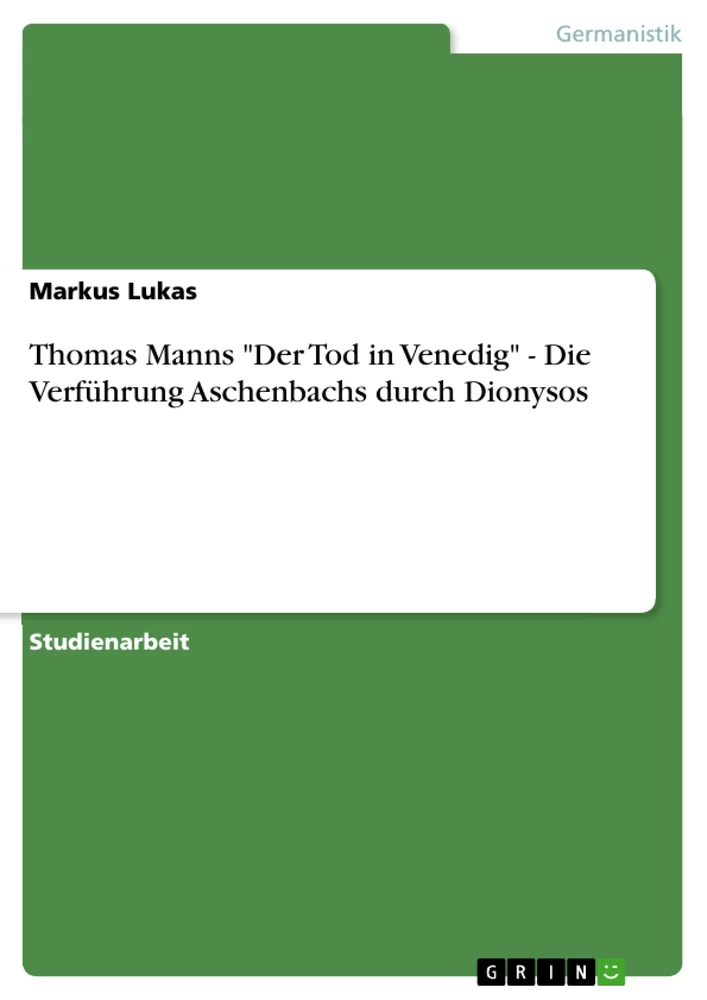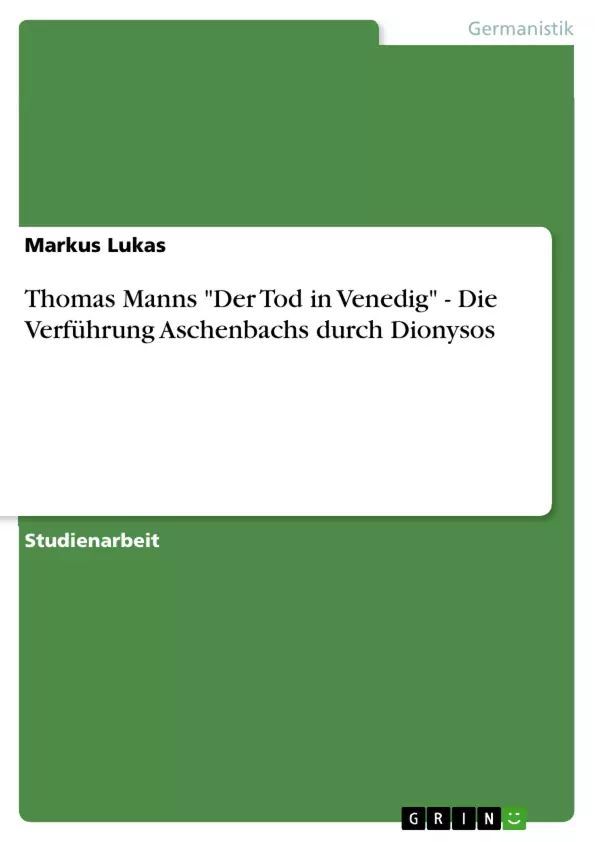Bei der folgenden Untersuchung der Verführung des Schriftstellers Aschenbach durch das Dionysische halte ich es für wichtig auch immer die Parallele zu Thomas Manns Leben zu ziehen, denn „es scheint [...], als habe Thomas Mann, nachdem er Aschenbach getötet, dessen Verirrungen erst auch selbst nachvollziehen müssen.“ In der Erzählung geht es somit auch um Thomas Mann selbst und zwar genauer gesagt, um dessen „Kunst [...] und deren
Verhältnis zu seinem Leben.“ In seiner Autobiographie „On myself“ von 1940 betonte er, dass die Erzählung „die moralisch und formal zugespitzteste und gesammeltste Gestaltung des Décadance- und Künstlerproblems“ sei, mit welchem er sich zeit seines Lebens auseinander zu setzen hatte. Doch nicht nur die zentrale Künstlerproblematik der Novelle ist aus Thomas Manns Leben gegriffen, sondern auch die äußeren Geschehnisse. In seinem „Lebensabriss“
von 1930 erwähnt er, dass „im ,Tod in Venedig' nichts erfunden [sei]: Der Wanderer [...], der greise Geck, der verdächtige Gondolier, Tadzio und die Seinen [...] - alles war gegeben [...] und erwies dabei aufs verwunderlichste seine kompositionelle Deutungsfähigkeit.“ Aus diesem Grund sollen einige autobiographische Fakten zur Entstehungsgeschichte der Erzählung der eigentlichen Analyse vorangestellt werden. Im Mai 1911 reiste Thomas Mann nach der Insel Brioni vor Istrien, wo er vom Tod des Komponisten Gustav Mahler erfuhr, dessen Bekanntschaft er gemacht hatte und der ihn wohl
sehr beeindruckt hatte. Er verlieh seinem Helden Aschenbach nicht nur dessen Vornamen, sondern auch dessen Äußeres. Nach einem relativ kurzen Aufenthalt auf Brioni ging es »«her nach Venedig, wo er im Hotel des Bains am Lido wohnte. Dort verfasste er den Aufsatz -Über die Kunst Richard Wagners“, der wie ,jene anderthalb Seiten erlesener Prosa“ (S. 55) Aschenbachs auf einem hoteleigenen Briefbogen verfasst wurde. Die Inspirationsquelle Aschenbachs, der schöne Jüngling Tadzio, war in Thomas Manns Leben der damals 14-
jährige polnische Junge Wladyslaw Baron Moes (Rufname Wladzio), der ihm am Lido begegnete. [...]
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung: Thomas Mann und Gustav von Aschenbach - Autobiographisches in der Erzählung
- Thomas Mann und Gustav von Aschenbach - Autobiographisches in der Erzählung
- B. Die Verführung Aschenbachs durch Dionysos
- Aschenbachs Hang zum Dionysischen
- Das bisherige Leben Aschenbachs
- Die ersten Anzeichen des Dionysischen
- Die Todesboten - Die Ankündigung des Verfalls
- Der Fremde vor der Aussegnungshalle
- Der falsche Jüngling
- Der Gondoliere
- Der Bänkelsänger
- Die Funktion der Todesboten
- Tadzio Der Verführer
- Die ersten Begegnungen mit Tadzio
- Der Fluchtversuch
- Versuch der Sublimierung - Die erlesene Prosa
- Tadzios Lächeln
- Tadzio als Hermes und sein Gang ins Verheißungsvoll-Ungeheure
- Der Verfall Aschenbachs
- Die Cholera und der innere Verfall
- Das Motiv der Faust und der offenen Hand
- Die dionysische Schreckensvision und der Untergang im Tode
- C-Schluss: Muss die Kunst am Dionysischen untergehen?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Verführung des Schriftstellers Aschenbach durch das Dionysische in Thomas Manns „Der Tod in Venedig“. Sie untersucht die Parallelen zwischen Aschenbachs Verirrungen und Thomas Manns Leben und beleuchtet, wie die Erzählung die „Kunst [...] und deren Verhältnis zu seinem Leben“ (Heller, 1972, S. 83) widerspiegelt. Die Arbeit konzentriert sich auf die Künstlerproblematik, die sich durch Thomas Manns Leben zieht und in der Novelle ihren Höhepunkt findet. Die Analyse untersucht, wie die Erzählung die zentrale Thematik der „Enthemmung eines zu klassischer Meisterschaft aufgestiegenen Künstlers ins Dionysische“ (Wysling, 1974, S. 171) darstellt und wie die autobiographischen Elemente zur Entstehung der Erzählung beitragen.
- Die Verführung des Künstlers Aschenbach durch das Dionysische
- Das Verhältnis zwischen Kunst und Leben bei Thomas Mann
- Die Bedeutung der autobiographischen Elemente in „Der Tod in Venedig“
- Die Künstlerproblematik und die Frage der künstlerischen Sublimierung
- Die Rolle der Todesboten und Tadzios als Verführer
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Verführung Aschenbachs durch das Dionysische ein und beleuchtet die autobiographischen Parallelen zwischen Aschenbachs Leben und dem von Thomas Mann. Das zweite Kapitel liefert eine Biographie des Protagonisten und verdeutlicht seine apollinische Lebensweise. Es beleuchtet Aschenbachs Streben nach klassischer Meisterschaft und seinen „strengen Dienst der Form“ (S. 17), der zu einer „Erstarrung in der Tradition“ (Vaget, 1990, S. 585) führt. Das dritte Kapitel untersucht die ersten Anzeichen des Dionysischen in Aschenbachs Leben und analysiert die Funktion der Todesboten, die seinen Verfall ankündigen. Es analysiert auch die Rolle Tadzios als Verführer und seine Wirkung auf Aschenbach.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe der Arbeit sind: Thomas Mann, „Der Tod in Venedig“, Gustav von Aschenbach, Dionysos, Apollon, Künstlerproblematik, Sublimierung, Verführung, Todesboten, Tadzio, Autobiographie, Enthemmung, Verfall, Kunst, Leben.
- Citation du texte
- Markus Lukas (Auteur), 2002, Thomas Manns "Der Tod in Venedig" - Die Verführung Aschenbachs durch Dionysos, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/57261