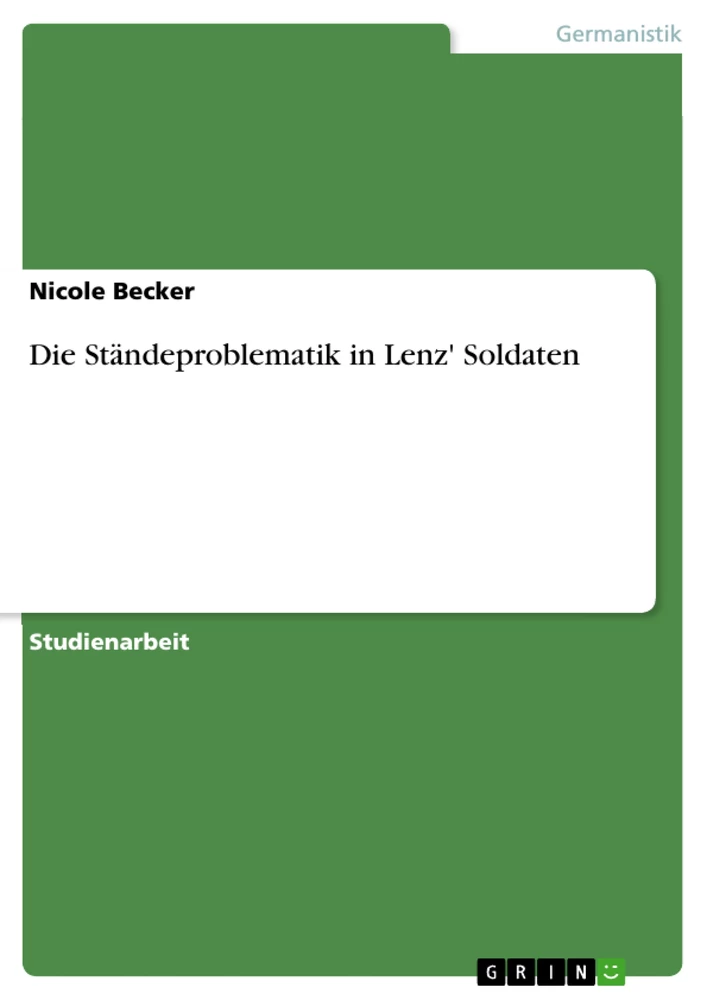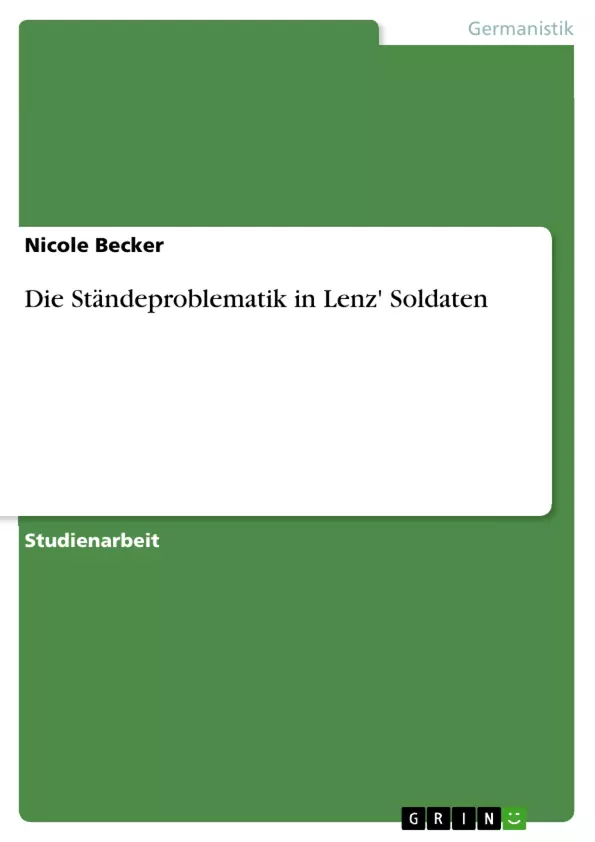Der Sturm und Drang ist eine literarische Epoche, die in der Zeit zwischen 1767-1785 stattfand. Der Name dieser Epoche ist zurückzuführen auf den Titel eines Dramas von Friedrich Maximilian Klinger (1752-1831)1. Die Aufklärung verlief zeitgleich mit dem Sturm und Drang. Die Forschung hat nach langen Untersuchungen festgestellt, dass die Aufklärung und der Sturm und Drang keine Gegenströme sind. Der Sturm und Drang ist ausgehen von der Aufklärung.
In der Aufklärung sind Vernunft und Objektivität die Leitmotive. Dies äußert sich durch die Veränderung der Welt im Hinblick auf rational zu definierende Ziele. Dabei spielt die Planmäßigkeit des Vorgehens, die Bildung durch Bücher, die Nachahmung bewährter Vorbilder, die Mäßigung des Gefühls, Vermeiden von Extremen und die Betonung des Regelhaften eine große Rolle.
Im Gegensatz zur Aufklärung sind beim Sturm und Drang das Gefühl und die Subjektivität die Leitmotive. Diese äußert sich durch das Ausleben eigener Individualität und durch den Geniegedanken. Dabei spielt das intuitive Zupacken, die Herzensbildung, das Misstrauen gegenüber Vorbildern, das Ausleben des Gefühls und die Tendenz zur Regellosigkeit eine große Rolle.
Ein weiterer Aspekt, der eine wichtige Position einnimmt ist die Natur. In der Aufklärung gilt sie als Vorbild und Gleichnis für die Vernunft. Sie wird bestimmt durch Hofferne, Abwesenheit von lasterhaftem Leben. Die Natur ist der Schauplatz von nach bürgerlichen Tugendbegriffen geprägtem Leben. Des Weiteren dient die Natur auch als Beweis für die Existenz und tätiges Wirken Gottes.
Im Gegensatz zur Aufklärung gilt die Natur im Sturm und Drang als Spiegel und Initiator des eigenen Gefühlsleben, insbesondere als Stadt- und Gesellschaftsferne, und ist somit Wegbereiter der subjektiven Entfaltung. Die Natur gilt als belebte friedvolle, aber auch bedrohliche Macht und ist Sinnbild des göttlichen Harmonieprinzips. In der Aufklärung ist das Hauptaugenmerk auf die Gesellschaft gelegt. Der Einzelne steht im Dienste der Gesellschaft. Es besteht die Möglichkeit zur Verbesserung gesellschaftlicher
Rahmenbedingungen durch individuelles, verantwortungsbewusstes Dazutun. Jedoch ist der Einzelne immer der Gesellschaft verpflichtet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sturm und Drang
- Die Gesellschafts- und Ständekritik
- Die Gesellschaftskritik
- Die Ständekritik
- Die Gesellschafts- und Ständekritik
- Jakob Michael Reinhold Lenz
- Kurzbiographie
- „Die Soldaten“
- Allgemeines zum Stück
- Inhaltsangabe
- Darstellung der Ständeproblematik
- Kritiken gegen das Bürgertum
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Ständeproblematik im Sturm und Drang, insbesondere im Kontext von Lenz' „Die Soldaten“. Sie untersucht, wie die Epoche die gesellschaftlichen Verhältnisse und die Stellung der verschiedenen Stände kritisch beleuchtet.
- Die Gesellschafts- und Ständekritik im Sturm und Drang
- Die Rolle des Einzelnen und seiner Selbstverwirklichung im Sturm und Drang
- Lenz' Darstellung der Ständeproblematik in „Die Soldaten“
- Die Kritik am Bürgertum und seinen Moralvorstellungen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den Sturm und Drang als literarische Epoche vor und beleuchtet dessen Entstehung und seine Beziehung zur Aufklärung. Sie führt wichtige Konzepte wie Vernunft, Gefühl, Subjektivität und Natur ein und zeigt, wie diese im Sturm und Drang interpretiert wurden.
- Sturm und Drang: Dieses Kapitel analysiert die zentrale Strömung des Sturm und Drang und ihre drei Hauptkritikpunkte: die absolutistische Obrigkeit, das bürgerliche Berufsleben und die überkommene Tradition. Es betont die Bedeutung des Dramas als Gattung für die Vermittlung der Ideen des Sturm und Drang.
- Jakob Michael Reinhold Lenz: Dieses Kapitel widmet sich dem Leben und Werk von Jakob Michael Reinhold Lenz, einem bedeutenden Autor des Sturm und Drang. Es beleuchtet sein Stück „Die Soldaten“ und gibt einen Überblick über das Werk, seine Inhaltsangabe und die darin dargestellte Ständeproblematik.
Schlüsselwörter
Sturm und Drang, Gesellschaftskritik, Ständekritik, Bürgertum, Individuum, Selbstverwirklichung, Lenz, „Die Soldaten“, Drama, Geniezeit, Natur, Aufklärung.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptmerkmale der Epoche des Sturm und Drang?
Der Sturm und Drang (ca. 1767–1785) stellt Gefühl, Subjektivität und Individualität in den Vordergrund. Er ist geprägt vom Geniegedanken und einem Misstrauen gegenüber starren Regeln und Vorbildern.
Wie unterscheidet sich der Sturm und Drang von der Aufklärung?
Während die Aufklärung auf Vernunft, Objektivität und Mäßigung setzt, betont der Sturm und Drang Herzensbildung und das Ausleben von Emotionen. Dennoch ist der Sturm und Drang eine Weiterentwicklung der Aufklärung, kein reiner Gegenstrom.
Welche Ständeproblematik wird in Lenz' „Die Soldaten“ thematisiert?
Das Stück kritisiert die starren Standesgrenzen zwischen dem Bürgertum und dem Adel (bzw. dem Militär) und zeigt auf, wie diese Grenzen zu moralischen Konflikten und dem sozialen Abstieg des Einzelnen führen.
Welche Rolle spielt die Natur in dieser Epoche?
Die Natur gilt als Spiegel des eigenen Gefühlslebens und als Ort der subjektiven Entfaltung, fernab von den Zwängen der städtischen Gesellschaft.
Was ist das Hauptaugenmerk der Gesellschaftskritik im Sturm und Drang?
Kritisiert werden vor allem die absolutistische Obrigkeit, das einengende bürgerliche Berufsleben und überkommene Traditionen, die die Selbstverwirklichung des Individuums behindern.
- Quote paper
- Nicole Becker (Author), 2003, Die Ständeproblematik in Lenz' Soldaten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/57283