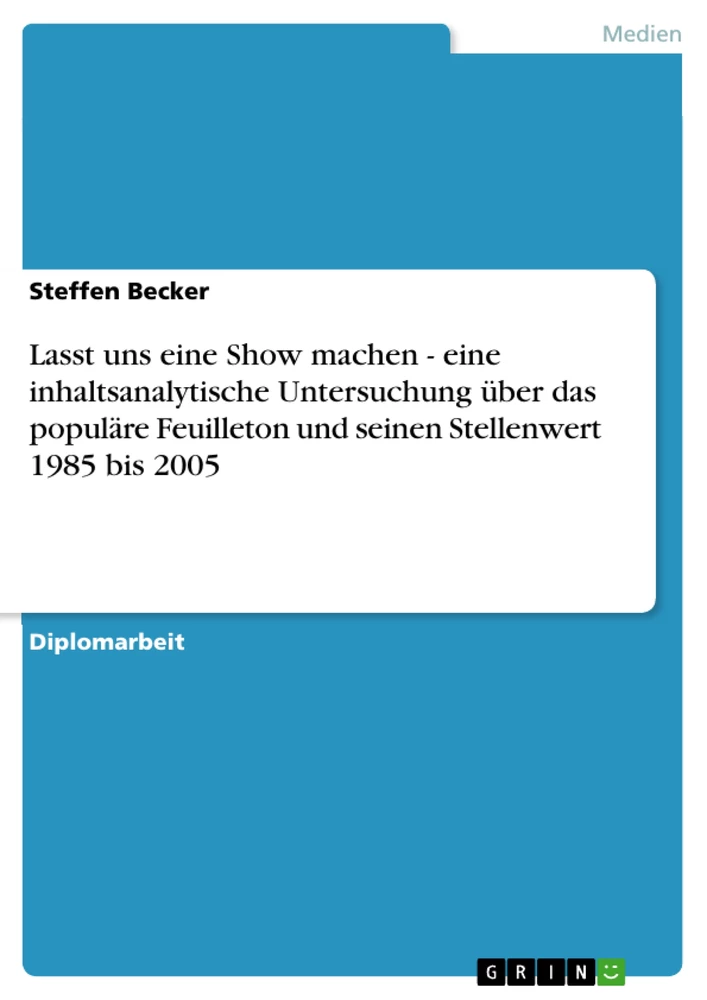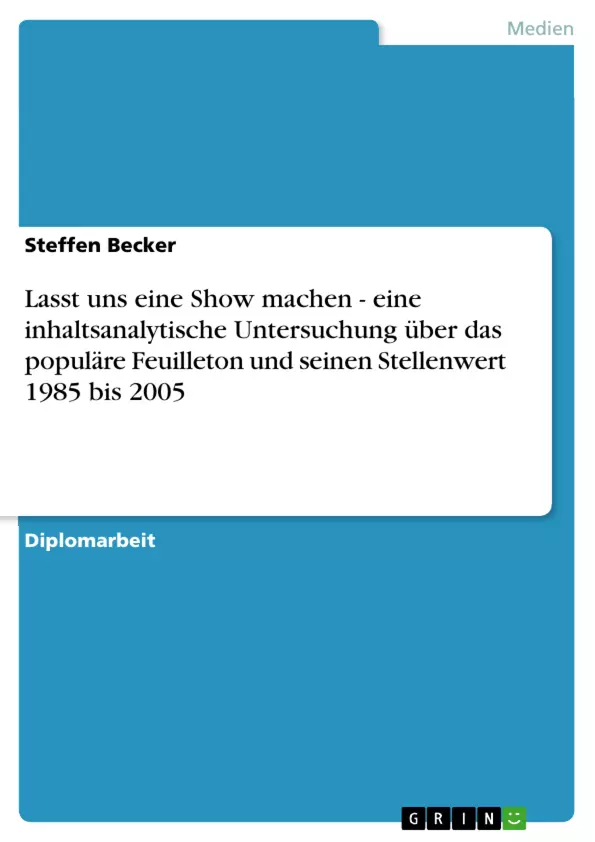Eigentlich kann man sich das Feuilleton sparen. Die paar Leser könnten die zuständigen Redakteure auch persönlich anrufen und es bliebe genug Zeit für einen ausgiebigen Plausch. Eine Meinung, die man oft zu hören bekommt, wenn die Kollegen aus anderen Ressorts gemeinsam am Mittagstisch über die blassen Feuilletonisten mit dem wirren Haar, dem Suhrkamp-Büchlein und den filterlosen Zigaretten am Nachbarstisch herziehen und deren Texte über die „fein gewebten Klangteppiche“ der Philharmoniker, über die Theaterpremiere am anderen Ende der Republik oder die Rückkehr des silbenzählenden Prinzips in die Lyrik verspotten. Diese Sicht mag eine klischeehafte sein, im Kern bestätigt die Feuilletonforschung den Be-fund jedoch. „Rezensionsfriedhöfe“, die den Leser missachteten, „trist, trocken und traurig“ lauten die wenig schmeichelhaften Urteile über das Feuilleton der Nachkriegszeit bis in die 80er Jahre. Legt man jedoch ein Feuilleton aus dem Jahre 1985 neben eines aus dem Jahr 2000, zeigt sich auf den ersten Blick, dass sich in dem Ressort radikale Veränderungen vollzogen haben müssen. Auf extrem ausgebautem Platz findet man statt reiner Kulturberichterstattung Reflexionen über die Ästhetik von Supermärkten, Verknüpfungen von Oliver Kahns Liebesleben mit dem Frauenbild in Musikvideos, cultural studies über den Erfolg von „Modern Talking“ in Osteuropa, etc. Es wirkt fast so, als könne das Feuilleton jedes Thema be-handeln, das sich nicht wehren kann. Offenbar hat das Ressort seinen Kulturbegriff stark erweitert. Auch die Palette der Darstellungsformen und Stilmittel scheint um einiges größer geworden zu sein. Den Rezensionsfriedhof hat man eingeebnet. Statt vermeintlich objektive Kritiken über ein Kunstprodukt zu schreiben, berichten Autoren von ihren Erlebnissen und Gefühlen und wagen Experimente mit Textcollagen und Kolumnen. Diese Entwicklung gilt es zu beschreiben. Was genau ist da eigentlich passiert? Denn bis jetzt hat sich keine klare Interpretation des Wandels im Feuilleton herausgebildet. Gegner sprechen von einem Verfall des Niveaus, von einer Marginalisierung der klassischen Künste. Befür-worter begrüßen eine Annäherung an die Lebenswirklichkeit der Leser, die dem Feuilleton mehr statt weniger Seriosität einbringe. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der verwendete Begriff Feuilleton
- Entstehung und Entwicklung des Feuilleton
- Entwicklung bis zum 1. Weltkrieg
- Die Zeit der Weimarer Republik
- Das Dritte Reich
- Die Nachkriegsjahre
- Zusammenfassung
- Studien aus dem Untersuchungszeitraum
- Die Kulturjournalisten
- Das Publikum
- Der Kulturbegriff
- Das Feuilleton
- Zusammenfassung
- Die Diskussion um das Feuilleton heute
- Die ökonomischen Bedingungen
- Die inhaltlichen Erweiterungen
- Die Kritik
- Niveauverlust der klassischen Kritik
- Hinwendung zur Unterhaltungskultur
- Boulevardisierung
- Selbstinszenierung
- Fixierung auf den Augenblick
- Die andere Seite
- Die Generationenfrage
- Der Leser und seine Interessen
- Die Herangehensweise
- Zusammenfassung
- Exkurs Pop
- Popliteratur → Popjournalismus → literarischer Journalismus?
- Zusammenfassung und Begriffsbestimmung
- Hypothesen
- Methodik der Untersuchung
- Die Inhaltsanalyse
- Anforderungen
- Die Grundgesamtheit
- Die Stichprobe
- Die Leitfadengespräche
- Die Inhaltsanalyse
- Der Seitenumfang des Feuilletons
- Die Bebilderung
- Die Darstellungsformen
- Besondere Stilformen
- Die Themen
- Der Fokus der Berichterstattung
- E- und U-Kultur
- Zusammenfassung der Ergebnisse und Hypothesenüberprüfung
- Empfehlungen
- Forschungsperspektive
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit setzt sich zum Ziel, die Entwicklung des Feuilletons in den letzten 20 Jahren zu untersuchen und zu beschreiben. Dabei werden die Veränderungen im Kulturbegriff, den Darstellungsformen und der Thematik analysiert, um die aktuelle Phase des Feuilletons im Jahr 2005 zu beleuchten.
- Die thematische Entgrenzung des Feuilletons
- Die Veränderung der Darstellungsformen und Gestaltungsmittel
- Die aktuelle Phase des Feuilletons im Jahr 2005
- Der Einfluss der Popkultur auf das Feuilleton
- Die ökonomischen und gesellschaftlichen Bedingungen des Feuilletons
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Relevanz des Feuilletons in der heutigen Medienlandschaft dar. Anschließend wird der Begriff Feuilleton definiert und seine historische Entwicklung von der Entstehung bis in die Nachkriegszeit beleuchtet. Kapitel 4 beschäftigt sich mit Studien aus dem Untersuchungszeitraum und beleuchtet die verschiedenen Perspektiven auf das Feuilleton. Im fünften Kapitel wird die aktuelle Diskussion um das Feuilleton analysiert und die unterschiedlichen Positionen von Kritikern und Befürwortern beleuchtet. Der Exkurs Pop befasst sich mit dem Einfluss der Popkultur auf das Feuilleton und stellt die Frage nach der Verbindung zwischen Popliteratur, Popjournalismus und literarischem Journalismus. Die Kapitel 7 bis 9 behandeln die Methodik der Untersuchung und beschreiben die verwendeten Forschungsmethoden. Die folgenden Kapitel 10 bis 16 analysieren verschiedene Aspekte des Feuilletons, wie den Seitenumfang, die Bebilderung, die Darstellungsformen, die Stilformen, die Themen und den Fokus der Berichterstattung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Feuilleton, der Kulturjournalismus, der Entwicklung des Feuilletons, der Popkultur, den ökonomischen Bedingungen, der Kritik, der Unterhaltungskultur, der Boulevardisierung, den Leitfadengesprächen und der Inhaltsanalyse. Dabei werden die wichtigsten überregionalen Zeitungen Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Welt und Frankfurter Rundschau analysiert.
Häufig gestellte Fragen
Wie hat sich das Feuilleton seit den 1980er Jahren verändert?
Es hat sich von einem reinen „Rezensionsfriedhof“ für Hochkultur zu einem Ressort entwickelt, das auch Alltagskultur, Pop und Lifestyle reflektiert.
Was bedeutet „Boulevardisierung“ des Feuilletons?
Kritiker nutzen diesen Begriff, um eine vermeintliche Senkung des Niveaus und eine stärkere Fokussierung auf Unterhaltung und Prominenz zu beklagen.
Welche Rolle spielt die Popkultur im modernen Feuilleton?
Popliteratur und Popjournalismus haben die Grenzen zwischen E- (ernster) und U- (unterhaltender) Kultur verwischt und neue Darstellungsformen etabliert.
Welche Zeitungen wurden in der Inhaltsanalyse untersucht?
Die Untersuchung umfasst die überregionalen deutschen Tageszeitungen SZ, FAZ, Die Welt und Frankfurter Rundschau.
Was sind die neuen Themen des Feuilletons?
Neben Theater und Literatur finden sich heute Themen wie die Ästhetik von Supermärkten, Musikvideos oder das Privatleben von Sportstars.
- Citar trabajo
- Steffen Becker (Autor), 2005, Lasst uns eine Show machen - eine inhaltsanalytische Untersuchung über das populäre Feuilleton und seinen Stellenwert 1985 bis 2005, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/57406