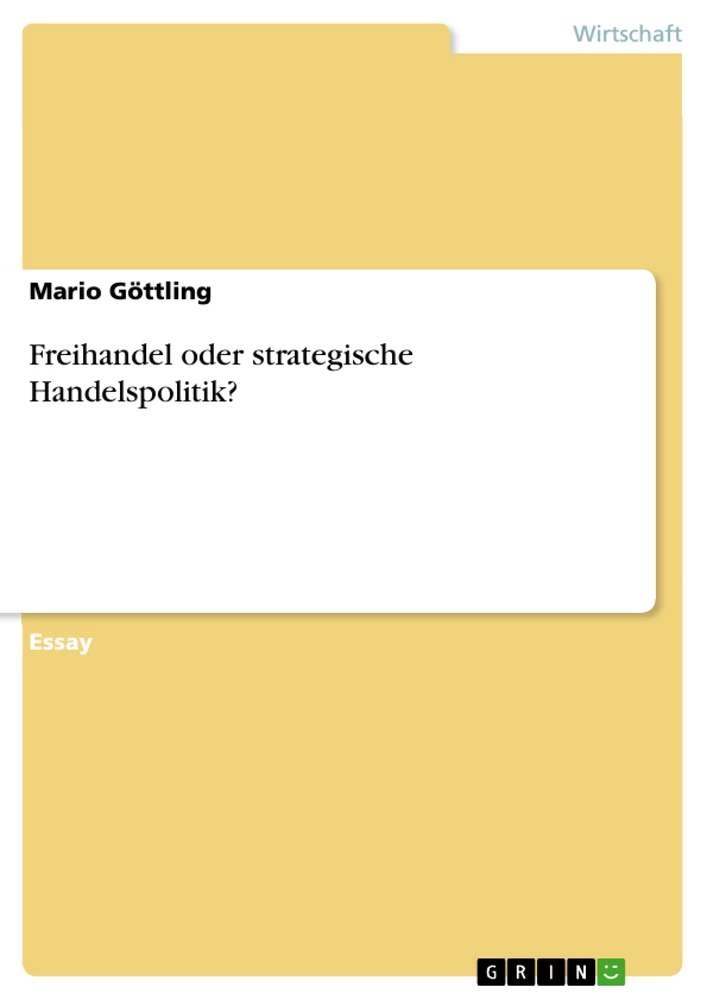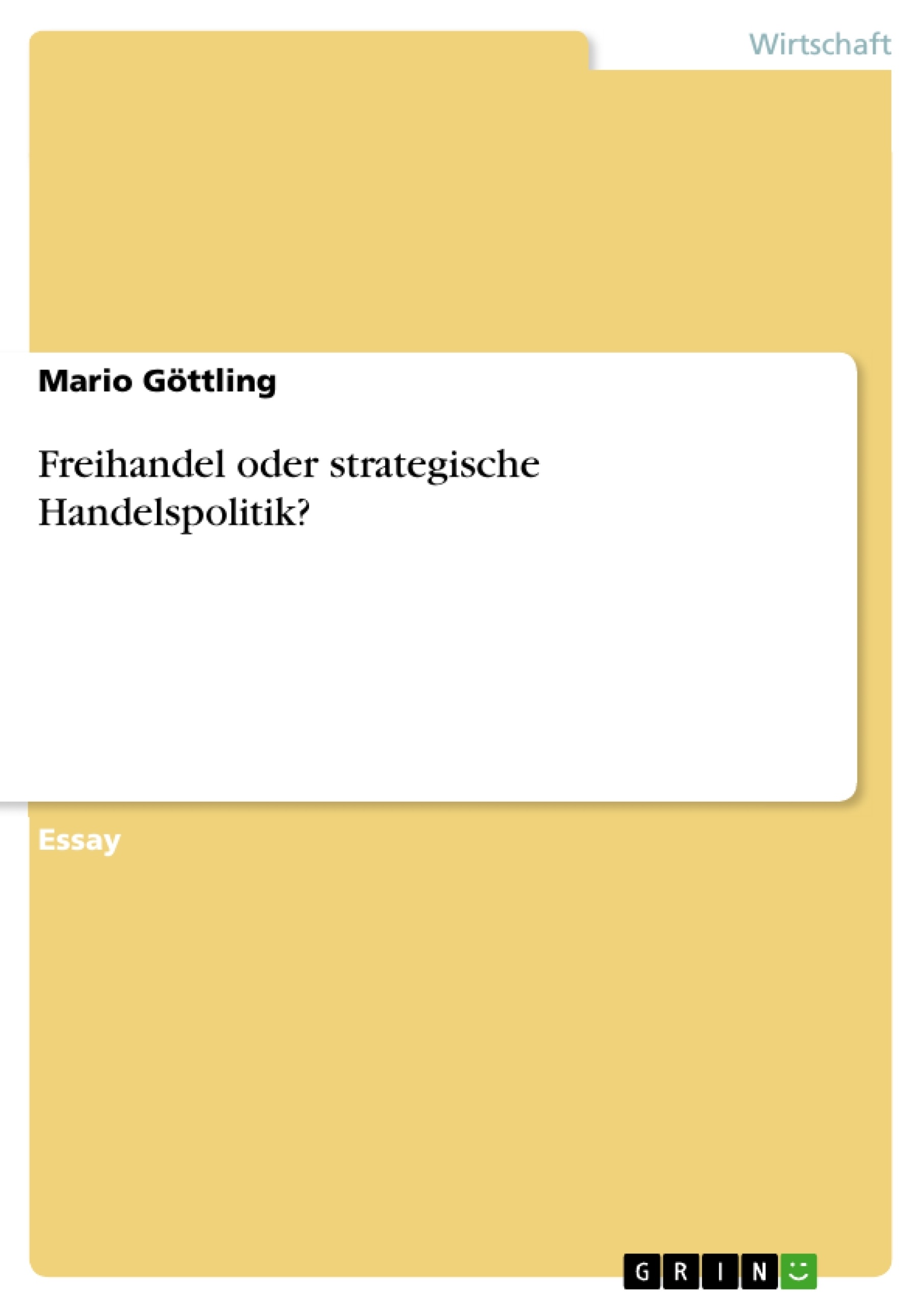In diesem Aufsatz soll die Frage behandelt werden, ob es sich für ein Land lohnen kann, strategische Handelspolitik zu betreiben und falls ja, unter welchen Bedingungen das der Fall ist. Außerdem wird erarbeitet, ob sich aus den ökonomischen Gründen für eine strategische Handelspolitik eine neue Handelstheorie ableiten lässt, die die Forderung nach allgemeinem Protektionismus beinhaltet. Zunächst muss beschreiben werden, was mit „klassischer Handelstheorie“ gemeint ist. Seit Adam Smith Werk „The Principles of Political Economy“ ist das Prinzip der komparativen Kostenvorteile in der Ökonomischen Theorie fest verankert. Dieses Prinzip besagt grob, dass sich freier Handel zwischen den Volkswirtschaften zur Steigerung der Wohlfahrt nutzen lässt. Das klassische Beispiel ist jenes von England und Portugal: Obwohl eines der Länder beide Produkte (nämlich Tuch und Wein) für sich genommen mit geringeren Kosten produzieren kann, ist ein Tausch sinnvoll, da der Unterschied in der Kosteneffizienz bei einem Produkt anders ausfällt, als bei dem anderen Produkt. Dieser Umstand wird als „Komparativer Kostenvorteil“ bezeichnet und ist seither in der Ökonomie unumstritten. Mit diesem Argument wird in der klassischen Ökonomie für denFreihandelStellung bezogen. Komparative Kosten sind einfach zu verstehen und außerdem konterkarieren sie das Vorurteil, dass Ökonomie immer nur die Interessen großer, mächtiger Lobbyisten vertritt. Nach dem Grundsatz des Freihandels würden vor allem kleine Anbieter profitieren, da für sie sonst (unter Protektionismus) die Märkte verschlossen blieben. Allerdings gerät dieses Prinzip zunehmend in die Kritik. Politisch gibt es schon länger (vermutlich schon immer) die Tendenz zum Protektionismus. Eine Regierung strebt immer danach, den inländischen Markt gegen ausländische Produkte abzuschotten, damit die heimische Wirtschaft nicht einem starken Wettbewerb ausgesetzt wird. Probate Mittel, um dies zu erreichen sind Importzölle, um ausländische Produkte teurer und damit unattraktiver zu machen; oder Exportsubventionen, damit die inländischen Produkte auf den ausländischen Märkten preiswerter verkauft werden können. Aber nicht nur politisch wird der Freihandel angegriffen. Auch Ökonomen melden sich immer wieder zu Wort, um ihre Skepsis gegenüber der bestehenden Lehrmeinung zu äußern. Diese Ökonomischen Argumente gegen vollkommenen Freihandel sollen im Folgenden Absatz aufgezeigt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Argumente für staatliche Eingriffe
- Strategisches Handeln der Politik in bestimmten Bereichen
- Externe Effekte
- Argumente gegen die neue Theorie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Aufsatz untersucht, ob es für ein Land sinnvoll ist, strategische Handelspolitik zu betreiben und unter welchen Bedingungen dies der Fall sein könnte. Er analysiert auch, ob sich aus den ökonomischen Gründen für eine strategische Handelspolitik eine neue Handelstheorie ableiten lässt, die den allgemeinen Protektionismus fordert.
- Kritik an der klassischen Handelstheorie und dem Freihandelsprinzip
- Ökonomische Argumente für staatliche Eingriffe im Handel
- Strategische Handelspolitik als Mittel zur Steigerung der Wohlfahrt
- Externe Effekte und ihre Rolle im internationalen Handel
- Kritik an der neuen Theorie und die Argumente für den Freihandel
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Der Aufsatz stellt die Problematik der strategischen Handelspolitik gegenüber dem Freihandelsprinzip dar. Er erläutert das klassische Argument der komparativen Kostenvorteile und zeigt die Kritik daran auf.
Argumente für staatliche Eingriffe
Dieser Abschnitt beleuchtet die ökonomischen Gründe für staatliche Eingriffe im Handel. Hier werden zwei Hauptargumente vorgestellt: Strategisches Handeln der Politik in bestimmten Bereichen und Externe Effekte.
Strategisches Handeln der Politik in bestimmten Bereichen
Der Autor erläutert das Konzept der strategischen Handelspolitik am Beispiel des Boing-Airbus-Problems. Er argumentiert, dass in oligopolistischen Märkten mit steigenden Skalenerträgen staatliche Interventionen, wie Exportsubventionen, die Wohlfahrt erhöhen können.
Externe Effekte
Dieser Abschnitt behandelt die positiven und negativen externen Effekte im internationalen Handel. Der Autor betont die Bedeutung von Forschung und Entwicklung (F&E) und argumentiert für die Subventionierung von F&E-Intensiven Branchen.
Argumente gegen die neue Theorie
Der letzte Abschnitt beleuchtet die Kritik an der neuen Theorie der strategischen Handelspolitik. Der Autor argumentiert, dass Interventionen in Märkten mit vollkommenem Wettbewerb negativ verzerrend wirken können. Er stellt außerdem die Herausforderungen der Informationsgewinnung und des Verhaltensvorhersages bei staatlichen Eingriffen dar.
Schlüsselwörter
Strategische Handelspolitik, Freihandel, komparative Kostenvorteile, oligopolistische Märkte, Skalenerträge, Externe Effekte, Forschung und Entwicklung (F&E), staatliche Intervention, Informationsgewinnung, Verhaltensvorhersage.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter strategischer Handelspolitik?
Es handelt sich um staatliche Eingriffe in den internationalen Handel (z. B. Subventionen), um heimischen Unternehmen in oligopolistischen Märkten Vorteile gegenüber der ausländischen Konkurrenz zu verschaffen.
Wie unterscheidet sich die strategische Handelspolitik von der klassischen Theorie?
Die klassische Theorie (Adam Smith/David Ricardo) plädiert für Freihandel durch komparative Kostenvorteile, während die strategische Politik davon ausgeht, dass staatliche Eingriffe unter bestimmten Bedingungen die nationale Wohlfahrt steigern können.
Was ist das „Boeing-Airbus-Problem“?
Es ist ein klassisches Beispiel für strategische Handelspolitik, bei dem staatliche Subventionen entscheiden können, welches Unternehmen einen Markt dominiert und hohe Gewinne erzielt.
Welche Rolle spielen externe Effekte im internationalen Handel?
Positive externe Effekte, wie technisches Wissen durch Forschung und Entwicklung (F&E), können ein Argument für die staatliche Förderung bestimmter Schlüsselindustrien sein.
Warum wird die neue Handelstheorie kritisiert?
Kritiker argumentieren, dass Regierungen oft nicht über genügend Informationen verfügen, um die „richtigen“ Branchen zu wählen, und dass Protektionismus zu ineffizienten Märkten und Gegenmaßnahmen anderer Länder führt.
Führt strategische Handelspolitik zwangsläufig zu Protektionismus?
Nicht zwingend, aber sie beinhaltet Instrumente wie Importzölle oder Exportsubventionen, die den freien Marktzugang einschränken können.
- Quote paper
- Mario Göttling (Author), 2006, Freihandel oder strategische Handelspolitik?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/57410