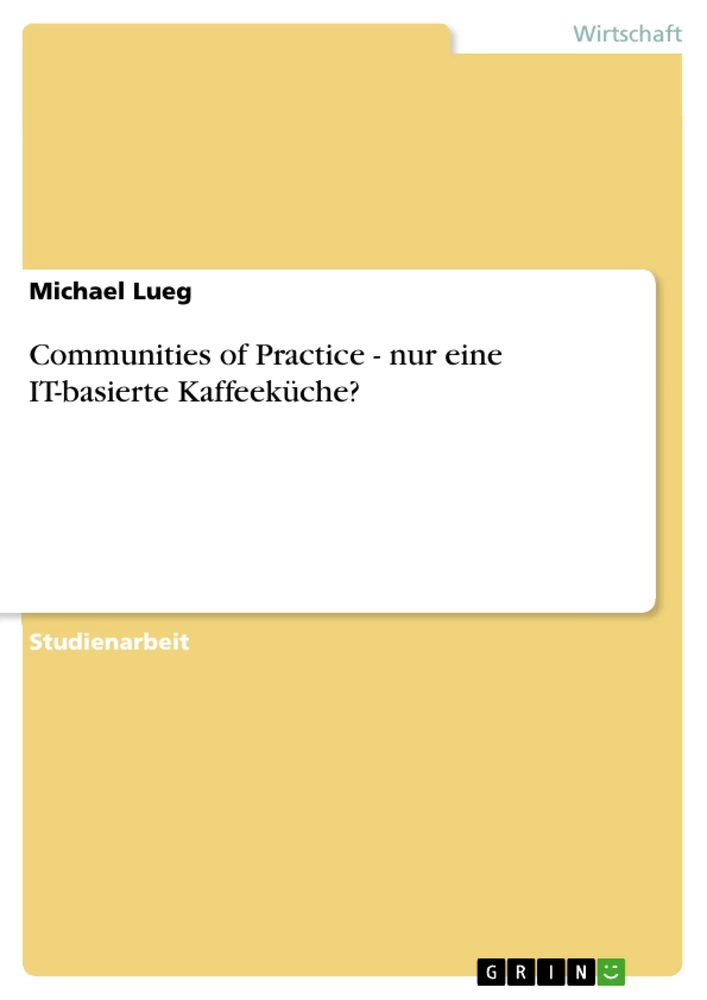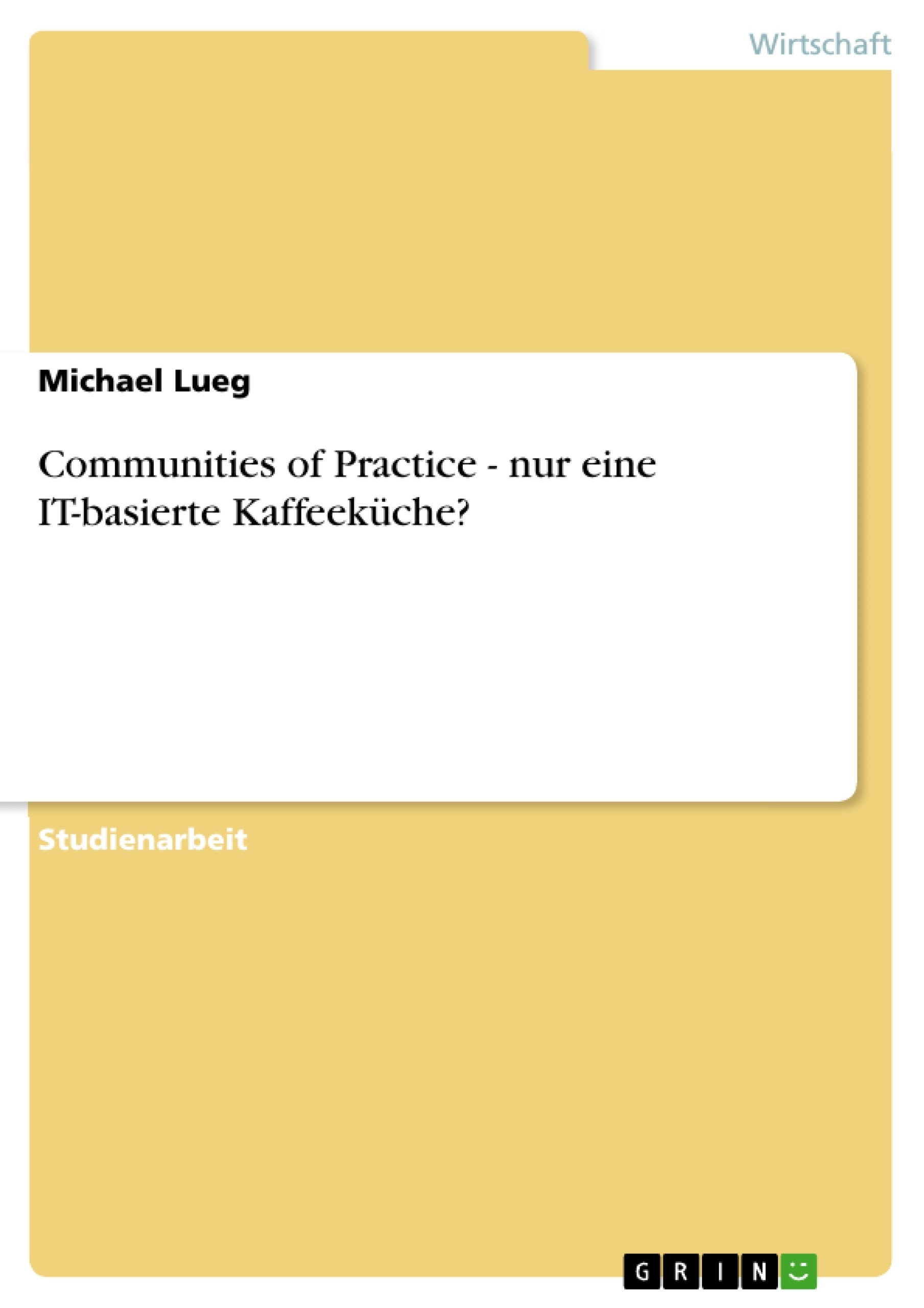In unserer heutigen Zeit, in der im Zuge der Globalisierung immer mehr Unternehmen auf den verschiedensten Märkten konkurrieren, wird es für Firmen zunehmend schwieriger Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Ein Faktor, dem in den letzten Jahren in zunehmenden Maße Aufmerksamkeit geschenkt wurde, ist das immaterielle Vermögen der Unternehmen und dabei insbesondere das Wissensreservoir der eigenen Mitarbeiter.1Aufgrund internationalisierter Arbeitsteilung und dem Wandel von arbeits- und kapitalintensiven hin zu informations- und wissensintensiven Aktivitäten im Wirtschaftsgeschehen hat die Bedeutung des Wissens in den letzten Jahren stark zugenommen. Begünstigt wurde dieser Umstand durch den rapiden Ausbau von Informations- und Kommunikationstechnologie, die einen Länderübergreifenden Wissensaustausch erst möglich machten.2 Ziel einer jeden Organisation muss es daher mittlerweile sein, durch eine verbesserte Nutzung von Wissen, Produktivitäts- und Qualitätssteigerungen zu erreichen, sowie durch einen kontinuierlichen Innovationsprozess einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil zu erzielen.3
Bei der Ressource Wissen gilt es aber zwischen dem explizitem und dem implizitem Wissen zu unterscheiden. Das explizite Wissen der Mitarbeiter ist dieses, was man in Formeln, Gleichungen und ähnlichem ausdrücken kann. Es kann dementsprechend relativ einfach verbalisiert und visualisiert werden. Implizites Wissen dagegen kann nicht ohne weiteres einfach so „abgezapft“ werden. Es ist erlerntes Wissen, dass zum Beispiel durch den täglichen Umgang mit Maschinen, Arbeitsprozessen oder durch langjährige Erfahrungen in anderen Gebieten entsteht.4 Dieses Wissen ist für Unternehmen insofern wichtig, da sich Probleme an unterschiedlichen Standorten in ähnlicher Art und Weise oft wiederholen. Somit kann eine unnötige mehrfache Erfindung des Rades vermieden werden. Die Frage die sich aufgrund dieser Unterscheidung für das Management stellt ist die, wie man das implizite Wissen des Einzelnen unternehmensweit verfügbar machen kann. Ein Konzept das seit dem Anfang der 90er Jahre rasch an Popularität gewann, ist das Modell der Communities of Practice5.
Der Begriff geht auf den Schweizer Sozialwissenschaftler Etienne Wenger6 zurück, der 1991 zum ersten Mal von solch einer Wissensgemeinschaft sprach. Im folgenden Abschnitt wird eine derartige Community dargestellt und aufgezeigt, wie sie in das Unternehmensgeschehen eingegliedert werden kann. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Communities of Practice aus Unternehmenssicht
- 2.1 Communities of Practice im Allgemeinen
- 2.2 Eingliederung in das Unternehmen
- 2.2.1 Psychologische Voraussetzungen
- 2.2.2 Organisationale Voraussetzungen
- 2.2.3 Technologische Voraussetzungen
- 2.3 Nutzen für das Unternehmen
- 3 Communities of Practice als Keimzelle des Wissensmanagements
- 3.1 Was ist Wissensmanagement?
- 3.2 Das Münchener Wissensmanagement Modell
- 3.3 Einordnung der Communities of Practice in das Münchener Modell
- 4 Kritische Würdigung
- 5 Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Konzept der Communities of Practice (CoP) und ihrer Bedeutung für das Wissensmanagement in Unternehmen. Sie analysiert die Entstehung und den Aufbau von CoP, untersucht deren Einbindung in die Unternehmensstruktur und beleuchtet den Nutzen für die Unternehmensentwicklung.
- Wissensmanagement und die Rolle von implizitem Wissen
- Communities of Practice als Plattform für Wissensaustausch
- Integration von CoP in Unternehmensprozesse
- Psychologische und organisatorische Voraussetzungen für erfolgreiche CoP
- Vorteile und Herausforderungen von CoP für Unternehmen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in das Thema ein und beleuchtet die Bedeutung von Wissen als immateriellem Vermögen in der heutigen Zeit. Es wird zwischen explizitem und implizitem Wissen unterschieden und die Bedeutung von CoP als Instrument zur Nutzung von implizitem Wissen hervorgehoben.
Kapitel 2 behandelt die Communities of Practice aus Unternehmenssicht. Es werden die Merkmale von CoP im Allgemeinen erläutert und die Integration von CoP in die Unternehmensstruktur analysiert. Dabei werden sowohl psychologische, organisatorische als auch technologische Voraussetzungen betrachtet.
Kapitel 3 widmet sich der Einordnung von CoP in das Konzept des Wissensmanagements. Es werden die zentralen Aspekte des Wissensmanagements und das Münchener Wissensmanagement Modell vorgestellt. Der Beitrag von CoP zum Wissensmanagement wird im Kontext des Münchener Modells betrachtet.
Kapitel 4 bietet eine kritische Betrachtung des CoP-Konzepts und beleuchtet mögliche Nachteile und Herausforderungen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Wissensmanagement, Communities of Practice, implizites Wissen, Unternehmenskultur, Wissensaustausch, Innovation, Motivation, und die Integration von CoP in Unternehmensprozesse.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine "Community of Practice" (CoP)?
Eine CoP ist eine Gruppe von Menschen, die ein gemeinsames Interesse oder eine Leidenschaft für ein Thema teilen und durch regelmäßige Interaktion lernen, es besser zu machen.
Warum ist implizites Wissen für Unternehmen so wichtig?
Implizites Wissen ist Erfahrungswissen, das schwer zu verbalisieren ist. Es hilft dabei, Probleme effizient zu lösen und das "Rad nicht jedes Mal neu zu erfinden".
Wer prägte den Begriff Communities of Practice?
Der Begriff geht auf den Schweizer Sozialwissenschaftler Etienne Wenger zurück, der das Modell Anfang der 90er Jahre popularisierte.
Welche Voraussetzungen braucht eine erfolgreiche CoP?
Notwendig sind psychologische (Vertrauen), organisationale (Freiräume) und technologische Voraussetzungen (Plattformen für Austausch).
Wie ordnen sich CoPs in das Münchener Wissensmanagement Modell ein?
Sie dienen als "Keimzelle" für die Identifikation, den Erwerb, die Entwicklung und die Verteilung von Wissen innerhalb einer Organisation.
Bieten CoPs einen echten Wettbewerbsvorteil?
Ja, durch verbesserte Wissensnutzung und kontinuierliche Innovationsprozesse können Unternehmen dauerhafte Vorteile gegenüber der Konkurrenz erzielen.
- Arbeit zitieren
- Michael Lueg (Autor:in), 2006, Communities of Practice - nur eine IT-basierte Kaffeeküche?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/57429