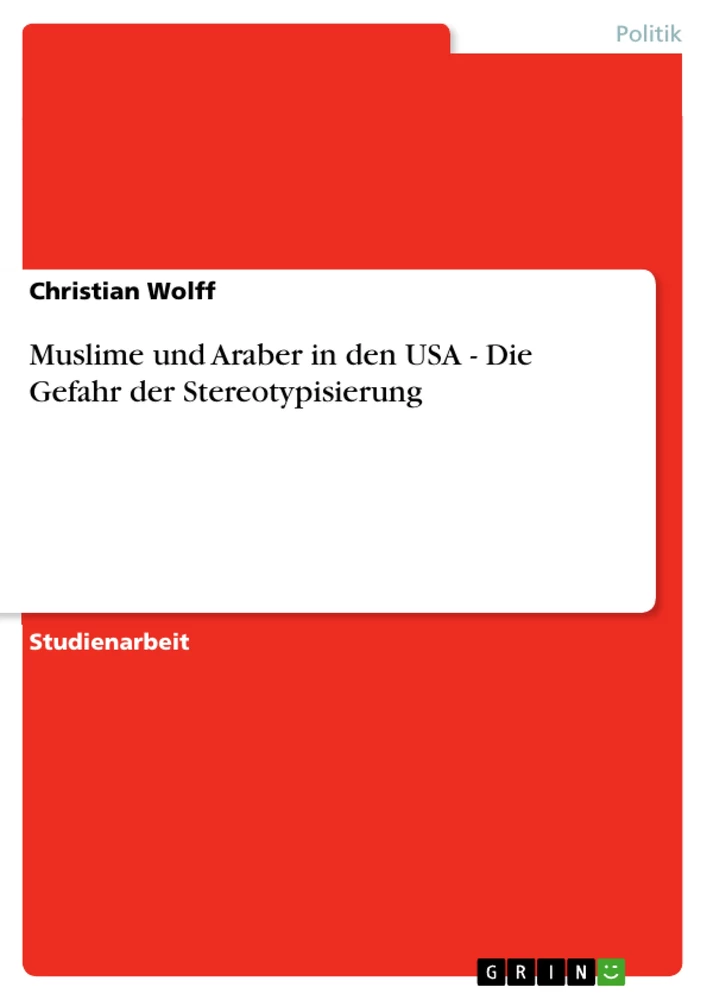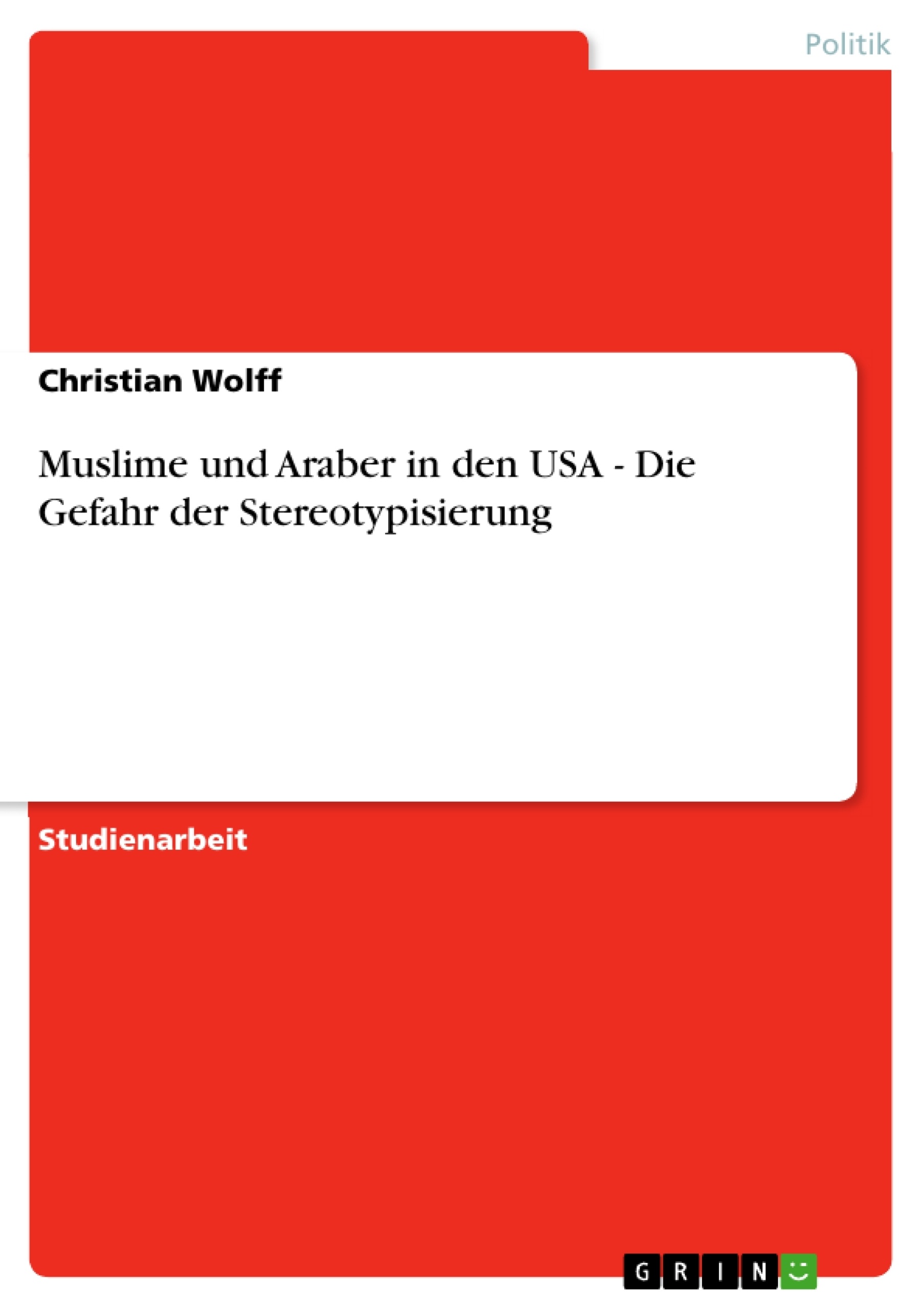Muslime und Araber sind in den USA seit dem 11.September in besonderem Maße einem gesellschaftlichen Druck ausgesetzt, der in Teilen einer Vorverurteilung gleicht. Der Prozess einer Stigmatisierung der Araber und Muslime in den USA hat jedoch nicht erst mit dem 11. September begonnen. Es lässt sich eine klare Stereotypisierung feststellen, die ihre Climax im Bild des arabischen Terroristen findet.
Bei der Beschäftigung mit diesem Thema habe ich bewusst auf die Maßnahmen des PATRIOT Act verzichtet, weil ich meinen Schwerpunkt eher auf die gesellschaftlichen, innerhalb der USA vorhandenen Sichtweisen gelegt habe. Ich halte die innenpolitischen Maßnahmen seit dem 11. September in den USA ebenso wie in Europa meist für politische Reflexe, die aufgrund geschaffener Stimmungen schnell und meist ohne größeren Widerstand eingeführt werden konnten. Zwar wird für die Durchsetzung solcher Gesetzesvorhaben immer wieder auf vorhandene Feindbilder und Stereotype zurückgegriffen. Deren Vorhandensein ist aber meiner Ansicht nach nicht von plötzlich auftretenden Ereignissen, wie Terroranschlägen, allein abhängig. Stereotype und Feindbilder sind Teil der Persönlichkeit eines jeden Individuums und wahrscheinlich auch des Empfindens von größeren (vermeintlich) homogenen Gruppen. Der Mensch, so schreibt Mathias Hildebrandt in seinem Aufsatz „Identity Formation, Prejudices, Stereotypes and Enemy Images“, ändere seine Feindbilder nicht einfach und schnell, da seine Wahrnehmung durch diese Stereotype gefestigt und gelenkt werde . Deshalb scheint es mir zwar logisch, dass Stereotype für populistische Zwecke gebraucht werden, die angesprochenen Gesetzesvorhaben und Verordnungen wie der PATRIOT Act sind jedoch Produkte einer vorhandenen Stereotypisierung und oft eben auch des Machtbewusstseins politischer Eliten. In einem Artikel für die Website www.islamfortoday.com schreibt Bassil Akel, dass negative Stereotype des Islam in der westlichen Welt nichts Neues seien und schon mit den Kreuzzügen und der Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen 1453 entstanden sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Verwendete Literatur
- Stereotypisierung - eine Definition
- Stereotypisierung in den amerikanischen Medien
- Stereotypisierung in den journalistischen Medien
- Die Experten- und Korrespondentenfrage
- Stereotypisierung und US-Amerikanische Außenpolitik
- Strömungen in der US-Außenpolitik
- Der II. Weltkrieg, Israel und der arabische Nationalismus
- Die islamische Revolution & das Ende des Kalten Krieges
- Der 2. Golfkrieg und der Kreuzzug gegen den Terror
- Christliche & jüdische Verbände und das Bild der American-Muslims
- Die israelische Lobby
- Neokonservative und christliche Einflüsse
- Internet und Stereotypisierung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht, inwieweit die Stereotypisierung des Islam und der Muslime die Außenpolitik und den gesellschaftlichen Umgang der USA mit den Muslimen beeinflusst hat. Der Fokus liegt auf der Analyse von Stereotypisierungstrends in der amerikanischen Literatur, Medien, Außenpolitik und innerhalb der christlichen Konservativen.
- Stereotypisierung des Islam und der Muslime in den USA
- Einfluss von Stereotypen auf die US-Außenpolitik
- Rollen der Medien und der christlichen Konservativen bei der Stereotypisierung
- Analyse der Entstehung und Verbreitung von Stereotypen
- Suche nach Möglichkeiten einer positiven Veränderung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Forschungsfrage nach dem Einfluss der Stereotypisierung auf die US-Außenpolitik und den gesellschaftlichen Umgang mit Muslimen. Sie erklärt die Fokussierung auf gesellschaftliche Sichtweisen und das Ausklammern des PATRIOT Act.
- Verwendete Literatur: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die wichtigsten Quellen und Werke, die für die Untersuchung der Stereotypisierung des Islam und der Muslime in den USA herangezogen wurden.
- Stereotypisierung - eine Definition: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition des Begriffs "Stereotypisierung" und untersucht die Entstehung und Verwendung von Stereotypen in der interkulturellen Kommunikation.
- Stereotypisierung in den amerikanischen Medien: Dieses Kapitel analysiert die Stereotypisierung von Muslimen und Arabern in den journalistischen Medien und beleuchtet die Rolle von Experten und Korrespondenten.
- Stereotypisierung und US-Amerikanische Außenpolitik: Dieses Kapitel untersucht die Strömungen in der US-Außenpolitik und deren Einfluss auf die Stereotypisierung des Islam und der Muslime. Es betrachtet dabei den II. Weltkrieg, die islamische Revolution, das Ende des Kalten Krieges und den 2. Golfkrieg.
- Christliche & jüdische Verbände und das Bild der American-Muslims: Dieses Kapitel untersucht den Einfluss christlicher und jüdischer Verbände auf die Stereotypisierung von Muslimen in den USA, insbesondere die Rolle der israelischen Lobby und neokonservativer und christlicher Einflüsse.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Stereotypisierung, Islam, Muslime, US-Außenpolitik, Medien, christliche und jüdische Verbände, amerikanische Gesellschaft, Feindbilder, interkulturelle Kommunikation und Vorurteile. Die Arbeit untersucht den Einfluss von Stereotypen auf die Wahrnehmung und den Umgang mit Muslimen in den USA und beleuchtet dabei die Rolle der Medien, der Außenpolitik und verschiedener gesellschaftlicher Gruppen.
Häufig gestellte Fragen
Begann die Stigmatisierung von Muslimen in den USA erst mit dem 11. September?
Nein, die Arbeit zeigt auf, dass Stereotype bereits viel früher entstanden sind, etwa durch historische Ereignisse wie die Kreuzzüge oder den arabischen Nationalismus.
Welchen Einfluss haben Medien auf das Bild der Araber?
US-Medien tragen durch einseitige Berichterstattung und die Auswahl bestimmter Experten massiv zur Festigung des Stereotyps vom „arabischen Terroristen“ bei.
Wie beeinflussen Stereotype die US-Außenpolitik?
Feindbilder dienen oft als Grundlage für politische Entscheidungen und ermöglichen die Einführung von Gesetzen wie dem PATRIOT Act ohne größeren Widerstand.
Welche Rolle spielen religiöse Verbände bei der Stereotypisierung?
Christlich-konservative und neokonservative Gruppen sowie pro-israelische Lobbys prägen das Bild der „American Muslims“ und beeinflussen die gesellschaftliche Wahrnehmung.
Warum ändern sich Feindbilder laut der Arbeit nur schwer?
Stereotype sind tief in der Persönlichkeit verankert und lenken die Wahrnehmung so, dass Informationen, die dem Feindbild entsprechen, bevorzugt aufgenommen werden.
- Citar trabajo
- Christian Wolff (Autor), 2006, Muslime und Araber in den USA - Die Gefahr der Stereotypisierung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/57447