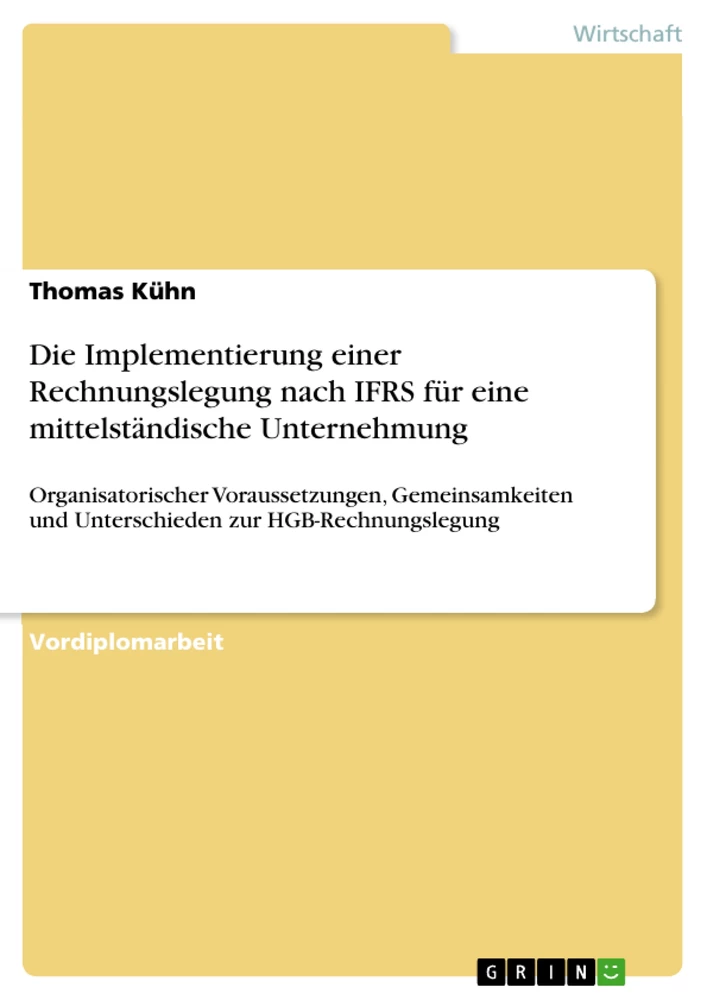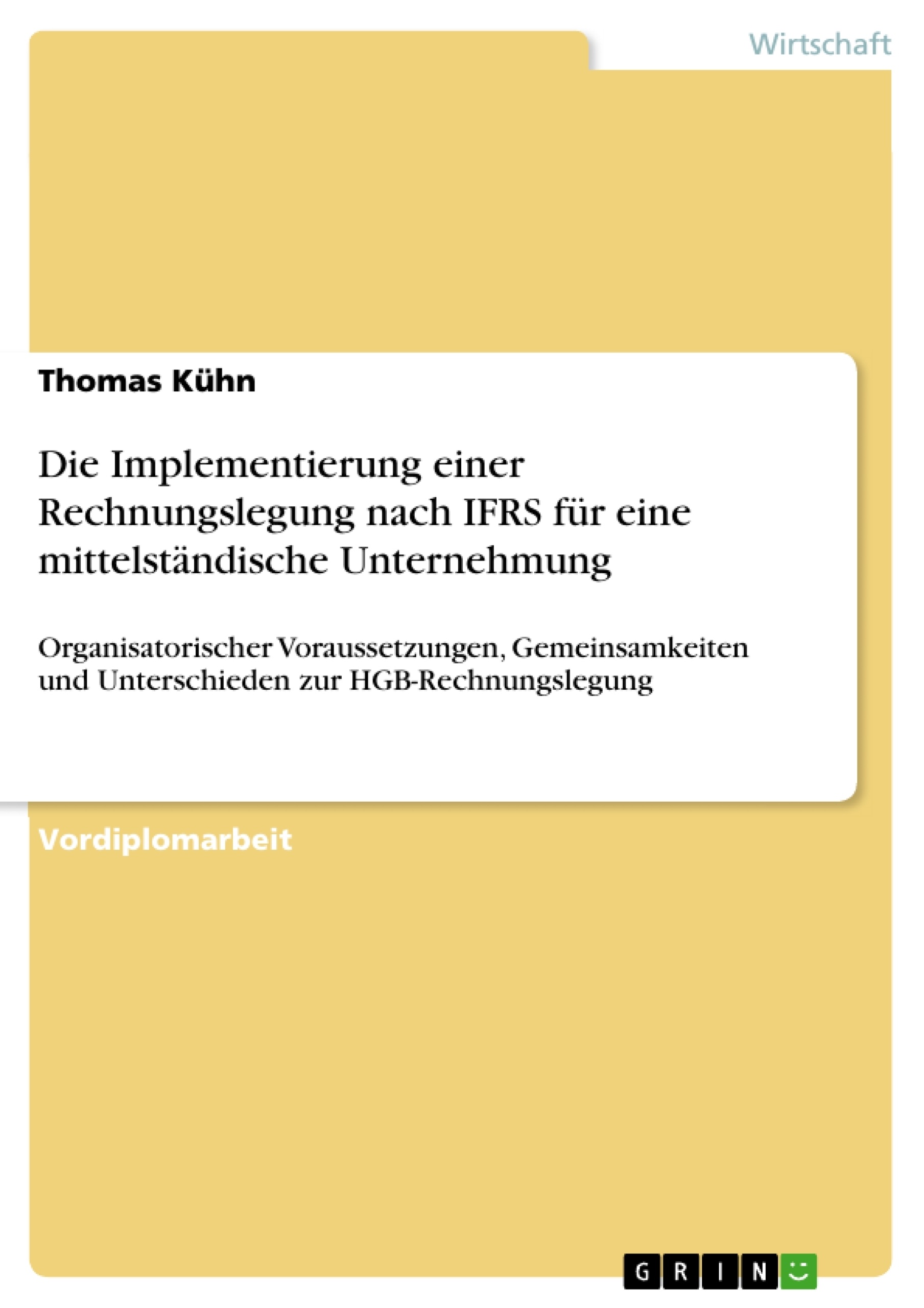Das Bilanzrecht in Deutschland befindet sich in einer rasanten Umbruchphase. Die EU-IAS-Verordnung verpflichtet kapitalmarktorientierte Unternehmen ab 2005 Konzernabschlüsse nach IFRS aufzustellen. Aber auch für andere Unternehmen gewinnen die IFRS mehr und mehr an Bedeutung: Sei es durch das Wahlrecht zur freiwilligen Aufstellung von IFRS-Abschlüssen oder aber dadurch, dass das HGB schrittweise an die internationale Rechnungslegung angepasst wird. Für viele Unternehmen stellt sich die Frage, ob sich für sie eine Umstellung der Rechnungslegung auf IFRS lohnt und was dabei berücksichtigt werden muss. Zielsetzung dieser Arbeit ist es deshalb, dem Leser vor Augen zu führen, wie ein Implementierungsprozess aussehen kann, welche Voraussetzungen dafür zu beachten sind und welche Folgen möglich sind. Als Basis dafür wird ein Überblick über die Konzeption der IFRS - auch im Vergleich zum HGB - gegeben. Es sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich ist, sämtliche Details und Unterschiede im Einzelnen darzustellen und alle Fragen zu beantworten, die sich aus der praktischen Anwendung ergeben; es soll lediglich ein Einstieg in die Thematik ermöglicht werden. Für tiefergehende Fragestellungen empfiehlt sich ein IFRS-Kommentar. Zu Beginn der Arbeit soll eine allgemeine Einführung in den Themenbereich IFRS erfolgen. Es werden an dieser Stelle historische und organisatorische Fragen in Bezug auf die International Accounting Standards Committee Foundation und das von ihr aufgestellte Regelungswerk erläutert, um so eine Grundlage für die tiefergehenden Erörterungen in den Folgeabschnitten zu schaffen. Im darauf folgenden Abschnitt dieser Arbeit werden die konzeptionellen Grundlagen der IFRS dargestellt und anschließend werden wesentliche Gemeinsamkeiten und Unterschiede zur handelsrechtlichen Rechnungslegung herausgestellt. Dabei werden die HGB-Regelungen als bekannt vorausgesetzt; es wird insofern nur sehr knapp darauf eingegangen. Diese Gegenüberstellung ist zum Themengebiet„IFRS-Implementierung“hinzuzuzählen, da in der Planung einer Rechnungslegungsumstellung solche Unterschiede aufgezeigt werden müssen, um diese dann entsprechend zu würdigen. Der nächste Gliederungspunkt im Aufbau dieser Arbeit hat die Einführung der Rechnungslegung nach IFRS als Projekt zum Thema. Es werden grundsätzliche Schritte und Phasen der Vorgehensweise hierbei im Allgemeinen erläutert und organisatorische Voraussetzungen aufgearbeitet. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit
- 1.2 Aufbau und Struktur der Arbeit
- 2 Grundlagen internationaler Rechnungslegung
- 2.1 Gründe für die internationale Harmonisierung der Rechnungslegung
- 2.2 Der IASB als Standardsetter
- 2.2.1 Organisation und institutioneller Rahmen des IASB
- 2.2.2 Ziele und Aufgaben
- 2.3 Das Regelungswerk der IFRS
- 2.3.1 Das Normensystem der IFRS
- 2.3.2 Entwicklung eines Standards – Der „due process“
- 2.3.3 Struktureller Aufbau eines Standards
- 2.4 Die IFRS in der Europäischen Union und in Deutschland
- 2.4.1 Anerkennung der IFRS durch die EU
- 2.4.2 Einfluss auf die deutsche Rechnungslegung
- 3 Darstellung der Rechnungslegung nach IAS/IFRS und Vergleich zur HGB-Rechnungslegung
- 3.1 Rechnungslegungszweck und -adressaten
- 3.1.1 Nach HGB
- 3.1.2 Nach IFRS
- 3.2 Rechnungslegungsgrundsätze
- 3.2.1 Basisannahmen
- 3.2.1.1 Grundsatz der Periodenabgrenzung
- 3.2.1.2 Grundsatz der Unternehmensfortführung
- 3.2.1.3 Vergleich zur Rechnungslegung nach HGB
- 3.2.2 Qualitative Anforderungen
- 3.2.2.1 Verständlichkeit
- 3.2.2.2 Relevanz und Wesentlichkeit
- 3.2.2.3 Verlässlichkeit
- 3.2.2.4 Vergleichbarkeit
- 3.2.2.5 Vergleich zur Rechnungslegung nach HGB
- 3.2.3 Nebenbedingungen und Beschränkungen
- 3.2.3.1 Zeitnähe
- 3.2.3.2 Abwägung von Kosten und Nutzen
- 3.2.3.3 Abwägung der qualitativen Anforderungen
- 3.2.3.4 Vergleich zur Rechnungslegung nach HGB
- 3.2.1 Basisannahmen
- 3.3 Definition, Ansatz und Bewertung von Bilanzpositionen
- 3.3.1 Bilanzierung dem Grunde nach
- 3.3.1.1 Vermögenswerte (assets)
- 3.3.1.2 Schulden (liabilities)
- 3.3.1.3 Vergleich zur Rechnungslegung nach HGB
- 3.3.2 Bilanzierung der Höhe nach
- 3.3.3 Vergleich zur Rechnungslegung nach HGB
- 3.3.1 Bilanzierung dem Grunde nach
- 3.1 Rechnungslegungszweck und -adressaten
- 4 Die Implementierung einer Rechnungslegung nach IAS/IFRS als Projekt / Erstmaliger Anwendung der IAS/IFRS
- 4.1 Die Phasen der Einführung: Ein möglicher Projektplan
- 4.1.1 Erste Phase: Problemformulierung und Grundentscheidung
- 4.1.2 Zweite Phase: Projektinitiierung und -planung
- 4.1.2.1 Allgemeine Planung
- 4.1.2.2 Sachliche Planung
- 4.1.2.3 Personelle Planung
- 4.1.2.4 Zeitliche Planung
- 4.1.2.5 Finanzielle Planung
- 4.1.3 Dritte Phase: Realisation
- 4.1.4 Vierte Phase: Validierung
- 4.1.5 Fünfte Phase: Implementierung
- 4.2 Umsetzungsmöglichkeiten in der Buchhaltung
- 4.2.1 Originäre Buchhaltung nach HGB
- 4.2.2 Originäre Buchhaltung nach IFRS
- 4.2.3 Überleitung zwischen HGB und IFRS
- 4.2.3.1 Differenzbuchungen
- 4.2.3.2 Buchung von Originalwerten
- 4.3 IFRS 1: Vorschriften für die erstmalige IFRS-Anwendung
- 4.3.1 Allgemeine Bewertungs- und Bilanzierungsregeln
- 4.3.2 Erleichterungswahlrechte
- 4.3.3 Verpflichtende Ausnahmen
- 4.1 Die Phasen der Einführung: Ein möglicher Projektplan
- 5 Die Implementierung beim Beispiel-Unternehmen
- 5.1 Vorstellung des Unternehmens
- 5.2 Durchgeführte und geplante Projektorganisation
- 5.2.1 Personelle Planung
- 5.2.2 Sachliche Planung
- 5.2.3 Zeitliche Planung
- 5.2.4 Finanzielle Planung
- 5.3 Bilanzielle Auswirkungen
- 5.3.1 Immaterielle Vermögenswerte
- 5.3.2 Sachanlagevermögen
- 5.3.3 Pensionsrückstellungen
- 5.3.4 Eigenkapital
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Implementierung einer Rechnungslegung nach IAS/IFRS für ein mittelständisches Unternehmen. Ziel ist die Aufarbeitung der organisatorischen Voraussetzungen und die Aufzeigung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden zur HGB-Rechnungslegung.
- Organisatorische Herausforderungen bei der IFRS-Implementierung
- Vergleich der Rechnungslegungsgrundsätze nach IAS/IFRS und HGB
- Bewertung und Bilanzierung von Vermögenswerten und Schulden nach IAS/IFRS
- Phasen der IFRS-Einführung und Projektplanung
- Bilanzielle Auswirkungen der IFRS-Implementierung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Arbeit ein, beschreibt die Problemstellung bezüglich der Implementierung von IAS/IFRS in mittelständischen Unternehmen und skizziert den Aufbau der Arbeit. Es legt die Zielsetzung der Arbeit dar, welche die Untersuchung der organisatorischen Voraussetzungen und den Vergleich mit der HGB-Rechnungslegung umfasst.
2 Grundlagen internationaler Rechnungslegung: Dieses Kapitel liefert die notwendigen Grundlagen der internationalen Rechnungslegung. Es beleuchtet die Gründe für die internationale Harmonisierung, die Rolle des IASB als Standardsetter, das Regelwerk der IFRS, inklusive des Normensystems, des Due-Process und des strukturellen Aufbaus eines Standards. Zudem wird die Anerkennung der IFRS in der EU und deren Einfluss auf die deutsche Rechnungslegung behandelt. Der Fokus liegt auf der Erläuterung des Kontextes und der Funktionsweise der IFRS-Standards.
3 Darstellung der Rechnungslegung nach IAS/IFRS und Vergleich zur HGB-Rechnungslegung: Das Kapitel vergleicht die Rechnungslegung nach IAS/IFRS mit der HGB-Rechnungslegung. Es werden die jeweiligen Rechnungslegungszwecke und -adressaten analysiert. Im Detail werden die Rechnungslegungsgrundsätze, inklusive der Basisannahmen (z.B. Periodenabgrenzung, Unternehmensfortführung) und der qualitativen Anforderungen (Verständlichkeit, Relevanz, Verlässlichkeit, Vergleichbarkeit), sowie die Nebenbedingungen und Beschränkungen gegenübergestellt und eingehend erläutert. Der Vergleich umfasst auch die Definition, den Ansatz und die Bewertung von Bilanzpositionen. Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten werden detailliert herausgearbeitet, um ein umfassendes Verständnis zu ermöglichen.
4 Die Implementierung einer Rechnungslegung nach IAS/IFRS als Projekt / Erstmaliger Anwendung der IAS/IFRS: Dieses Kapitel widmet sich der Implementierung von IAS/IFRS als Projekt. Es beschreibt die verschiedenen Phasen der Einführung, beginnend mit der Problemformulierung und Grundentscheidung bis hin zur Implementierung. Es werden verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten in der Buchhaltung betrachtet, inklusive originärer Buchhaltung nach HGB und IFRS sowie Überleitungsmöglichkeiten mittels Differenzbuchungen oder Buchung von Originalwerten. Das Kapitel erläutert zudem die Vorschriften des IFRS 1 für die erstmalige Anwendung, inklusive allgemeiner Bewertungs- und Bilanzierungsregeln, Erleichterungswahlrechte und verpflichtende Ausnahmen. Der Schwerpunkt liegt auf der strukturierten Vorgehensweise bei der Umsetzung und den damit verbundenen Herausforderungen.
5 Die Implementierung beim Beispiel-Unternehmen: In diesem Kapitel wird die Implementierung von IAS/IFRS in einem konkreten mittelständischen Unternehmen detailliert dargestellt. Es umfasst die Vorstellung des Unternehmens, die Beschreibung der durchgeführten und geplanten Projektorganisation (personell, sachlich, zeitlich und finanziell) und die Analyse der bilanziellen Auswirkungen auf verschiedene Bilanzpositionen (z.B. immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagevermögen, Pensionsrückstellungen, Eigenkapital). Die Darstellung dient der Veranschaulichung der zuvor beschriebenen theoretischen Konzepte und zeigt die praktische Anwendung auf ein reales Szenario.
Schlüsselwörter
IAS/IFRS, HGB, Rechnungslegung, internationale Rechnungslegung, Implementierung, Projektmanagement, Bilanzierung, Bewertung, Vermögenswerte, Schulden, mittelständische Unternehmen, Vergleich, Harmonisierung.
Häufig gestellte Fragen zur Implementierung von IAS/IFRS in mittelständischen Unternehmen
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet eine umfassende Übersicht über die Implementierung von International Financial Reporting Standards (IFRS) in einem mittelständischen Unternehmen. Es enthält ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf dem Vergleich zwischen IFRS und Handelsgesetzbuch (HGB) Rechnungslegung sowie den organisatorischen Herausforderungen der IFRS-Einführung.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt folgende Themen: die Grundlagen der internationalen Rechnungslegung (IASB, IFRS-Regelwerk), einen detaillierten Vergleich der Rechnungslegungsgrundsätze und Bilanzierungsmethoden nach IFRS und HGB, die Implementierung von IFRS als Projekt (inkl. Projektphasen und -planung), die Umsetzungsmöglichkeiten in der Buchhaltung (originäre Buchführung nach HGB und IFRS, Überleitungsmethoden) und die praktische Anwendung der IFRS-Implementierung anhand eines Beispielunternehmens, inklusive der bilanziellen Auswirkungen.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument besteht aus fünf Kapiteln: 1. Einleitung, 2. Grundlagen internationaler Rechnungslegung, 3. Darstellung der Rechnungslegung nach IAS/IFRS und Vergleich zur HGB-Rechnungslegung, 4. Die Implementierung einer Rechnungslegung nach IAS/IFRS als Projekt / Erstmaliger Anwendung der IAS/IFRS und 5. Die Implementierung beim Beispiel-Unternehmen. Jedes Kapitel wird im Dokument kurz zusammengefasst.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Zielsetzung der Arbeit ist die Untersuchung der organisatorischen Voraussetzungen für die Implementierung von IAS/IFRS in einem mittelständischen Unternehmen und die Aufzeigung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede zur HGB-Rechnungslegung. Es soll ein umfassendes Verständnis der Herausforderungen und des Vorgehens bei der IFRS-Einführung vermittelt werden.
Welche Unterschiede zwischen IFRS und HGB werden behandelt?
Der Vergleich zwischen IFRS und HGB umfasst die Rechnungslegungszwecke und -adressaten, die Rechnungslegungsgrundsätze (Basisannahmen wie Periodenabgrenzung und Unternehmensfortführung, qualitative Anforderungen wie Verständlichkeit und Verlässlichkeit), Nebenbedingungen und Beschränkungen sowie die Definition, den Ansatz und die Bewertung von Bilanzpositionen (Vermögenswerte und Schulden).
Wie wird die Implementierung von IFRS als Projekt dargestellt?
Die Implementierung von IFRS wird als mehrphasiges Projekt dargestellt, das von der Problemformulierung und Grundentscheidung über die Projektierung und Realisation bis zur Implementierung und Validierung reicht. Es werden verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten in der Buchhaltung (originäre Buchhaltung nach HGB und IFRS, Überleitung zwischen HGB und IFRS) und die Vorschriften des IFRS 1 für die erstmalige Anwendung detailliert erklärt.
Wie wird das Beispielunternehmen in die Analyse einbezogen?
Das Beispielunternehmen dient zur Veranschaulichung der theoretischen Konzepte. Es wird das Unternehmen vorgestellt und die durchgeführte und geplante Projektorganisation (personell, sachlich, zeitlich und finanziell) sowie die bilanziellen Auswirkungen der IFRS-Implementierung auf verschiedene Bilanzpositionen (z.B. immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagevermögen, Pensionsrückstellungen, Eigenkapital) analysiert.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für das Dokument?
Die Schlüsselwörter umfassen IAS/IFRS, HGB, Rechnungslegung, internationale Rechnungslegung, Implementierung, Projektmanagement, Bilanzierung, Bewertung, Vermögenswerte, Schulden, mittelständische Unternehmen, Vergleich und Harmonisierung.
- Citation du texte
- Thomas Kühn (Auteur), 2006, Die Implementierung einer Rechnungslegung nach IFRS für eine mittelständische Unternehmung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/57481