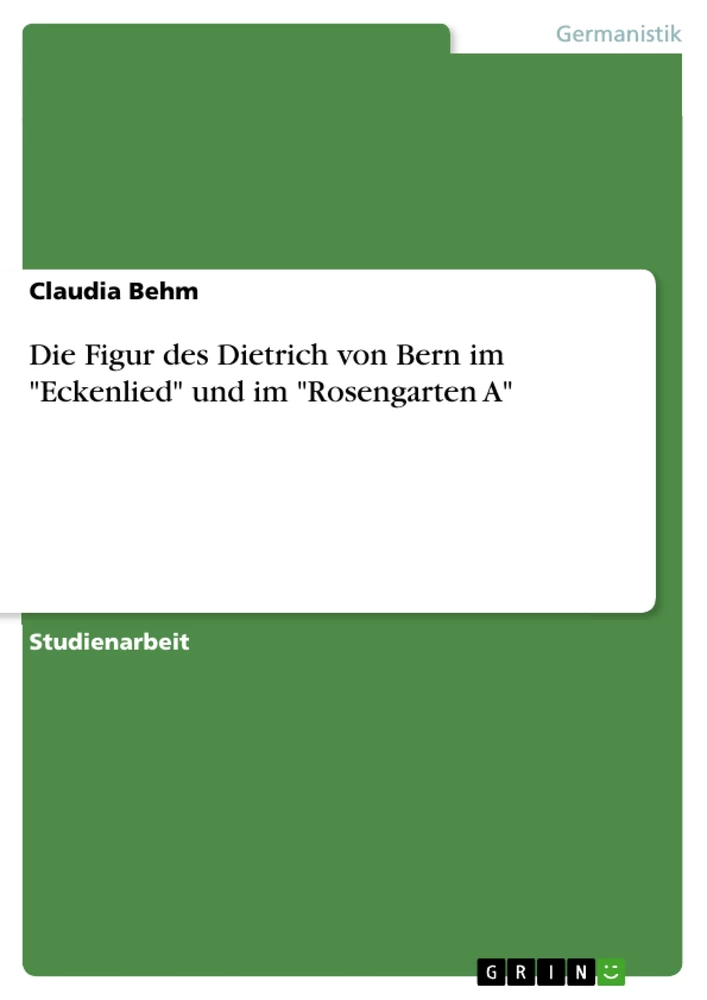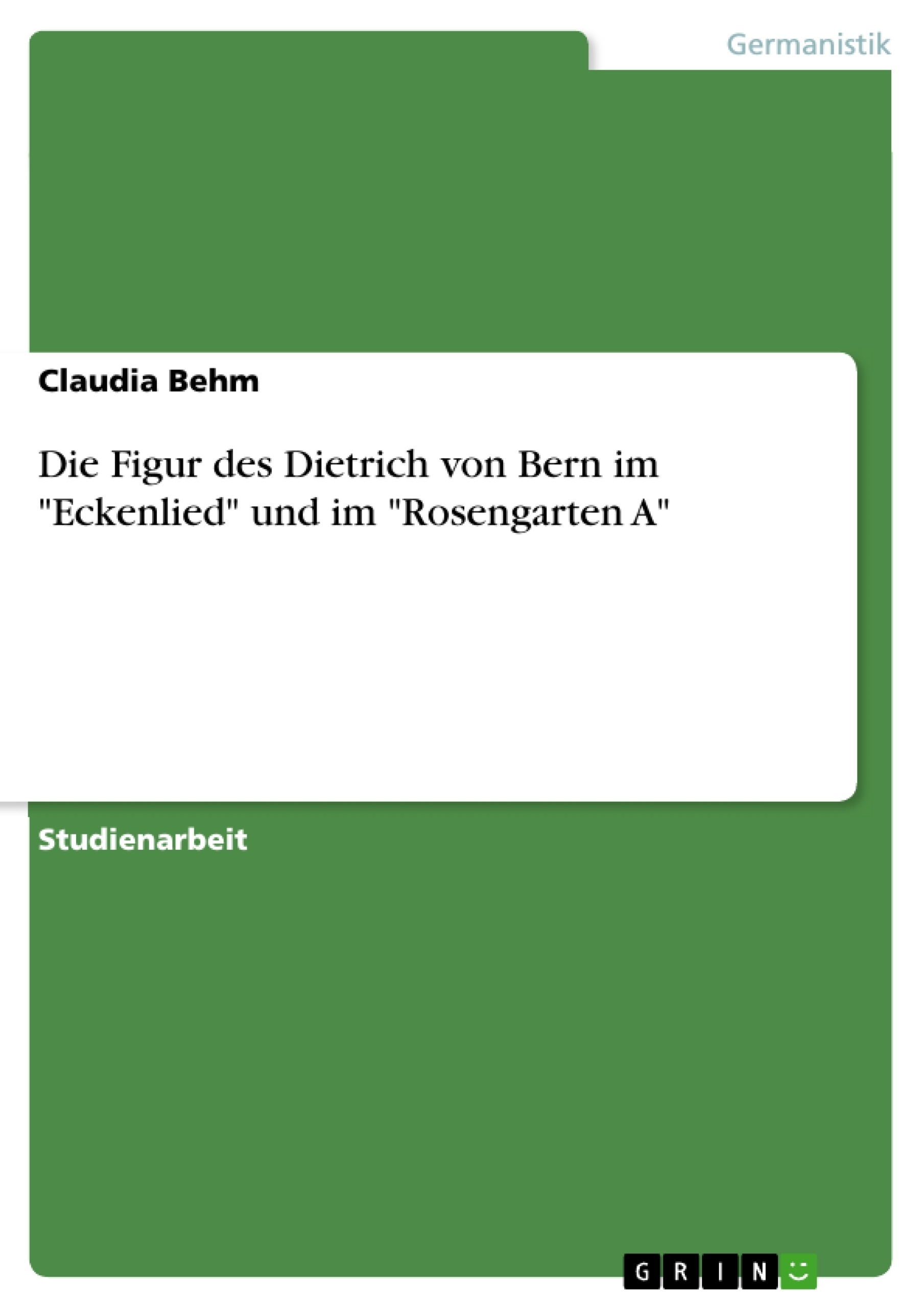Die Figur des Dietrich von Bern ist im späten Mittelalter die populärste Gestalt der germanisch-deutschen Heldensage gewesen. Über keinen anderen Helden waren dermaßen viele Erzählungen verbreitet und aus keinem anderen Stoff haben sich so viele Dichtungen so lange gehalten. Umso erstaunlicher ist es, dass die Dietrichdichtungen von der Forschung eine bisher eher stiefmütterliche Zuwendung erfuhren. In der vorliegenden Arbeit soll vor allem die Figur des Dietrich von Bern im Untersuchungsmittelpunkt stehen. Ziel ist es, zu prüfen, inwiefern der Held in verschiedenen Dichtungen unterschiedlich dargestellt wird und inwiefern sich Wesenszüge und Verhaltensweisen ähneln. Dazu ist in der Hauptsache eine inhaltliche Analyse der Texte erforderlich. Eine Formanalyse der Dichtungen soll deshalb in dieser Arbeit keine Rolle spielen. Exemplifiziert werden soll dies an zwei Texten, die zur aventiurehaften Dietrichepik zu zählen sind: Es handelt sich hierbei um das ‚Eckenlied’ und den ‚Rosengarten zu Worms’, welcher jedoch lediglich in der Fassung A herangezogen wird. Anhand der Texte soll zum einen die Zeichnung der Dietrichfigur verdeutlicht und analysiert werden und zum anderen sollen die daraus gewonnenen Ergebnisse der zu untersuchenden Dichtungen miteinander verglichen werden. Aufgrund dessen, dass die zu untersuchenden Texte ein und derselben Gruppe zuzuordnen sind, ist zu erwarten, dass die Darstellungen der Dietrichfigur eine Reihe von Gemeinsamkeiten aufweisen. Jedoch wird in besonderem Maße festzustellen sein, inwiefern und welche Unterschiede in der Darstellungsweise vorhanden sind und es muss sich dann gefragt werden, wie diese Unterschiede zustande kommen und welchen Zweck sie erfüllen. Bereits im ersten Teil der Arbeit wird festgestellt werden, dass eine Betrachtung und Analyse bestimmter Elemente in der Dietrichepik nicht möglich ist, ohne Aspekte des Artusromans vergleichend hinzu zu ziehen. Aus diesem Grunde soll im zweiten Teil der Arbeit beleuchtet werden, inwiefern höfische und nicht höfische Elemente in den jeweiligen Texten eine Rolle spielen. Des weiteren wird im letzten Kapitel auf tragische und komische Aspekte im ‚Eckenlied’ und im ‚Rosengarten’ eingegangen, denn dies sind wiederkehrende Merkmale der Dichtungen der Dietrichepik und sind ebenso in den diesen Texten feststellbar und vergleichbar.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1 Entstehung und Bedeutung der Dietrichepik
- 1.1 Überlieferung der Dietrichepik
- 1.2 Das 'Eckenlied' und der 'Rosengarten zu Worms' als aventiurehafte Dietrichepen
- 2 Die Figur des Dietrich von Bern
- 2.1 Theodorich der Große – die historische Vorlage des Dietrich von Bern
- 2.2 Dietrich von Bern als literarische Figur
- 2.2.1 Die Tugenden des Dietrich von Bern
- 2.2.2 Dietrich von Bern im Frauendienst
- 2.2.2.1 Dietrichs Frauendienst im 'Eckenlied'
- 2.2.2.2 Dietrichs Frauendienst im 'Rosengarten'
- 2.2.3 Dietrichs Zaudern als Spezifikum der aventiurehaften Dietrichepik
- 2.2.3.1 Dietrichs Zaudern im 'Eckenlied'
- 2.2.3.2 Dietrichs Zaudern im 'Rosengarten'
- 2.2.3.3 Thesen zur Entwicklung des Zagheitsmotivs als Erklärung für Dietrichs zögerliches Verhalten
- 2.2.4 Dietrichs Klage im 'Eckenlied'
- 2.2.5 Dietrich von Bern im Kampf
- 2.2.5.1 Dietrichs Kämpfe gegen Ecke und Siegfried
- 2.2.5.2 Dietrichs Kämpfe gegen Vasolt und die Eckensippe
- 2.2.6 Die Darstellung Dietrichs von Bern in den Schlussszenen des 'Eckenliedes'
- 3 Höfische und unhöfische Elemente im 'Eckenlied' und im 'Rosengarten zu Worms'
- 3.1 Unhöfische Elemente und Elemente höfischer Epik im 'Eckenlied'
- 3.2 Unhöfische und höfische Elemente im 'Rosengarten'
- 3.3 Vergleich des (Un-)Höfischen im 'Eckenlied' und im 'Rosengarten'
- 4 Tragik und Komik im 'Eckenlied' und im 'Rosengarten'
- 4.1 Aspekte von Tragik und Komik im 'Eckenlied'
- 4.2 Aspekte von Tragik und Komik im 'Rosengarten'
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Figur des Dietrich von Bern in zwei aventiurehaften Dietrichepen, dem 'Eckenlied' und dem 'Rosengarten zu Worms' (Fassung A). Ziel ist der Vergleich der Darstellung Dietrichs in beiden Texten, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzuzeigen und deren Entstehung und Funktion zu ergründen. Die Analyse konzentriert sich auf die inhaltliche Ebene, wobei formale Aspekte vernachlässigt werden.
- Die Entwicklung und Überlieferung der Dietrichepik
- Die Darstellung Dietrichs von Bern als literarische Figur: Tugenden, Rolle im Frauendienst, Zaudern, Kämpfe
- Der Vergleich höfischer und unhöfischer Elemente in beiden Texten
- Die Analyse von tragischen und komischen Elementen in der Darstellung
- Der Vergleich der Dietrich-Darstellung in den beiden Epen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit untersucht die Figur des Dietrich von Bern in den aventiurehaften Epen 'Eckenlied' und 'Rosengarten' (Fassung A), um Unterschiede und Gemeinsamkeiten in seiner Darstellung zu analysieren und zu erklären. Die Analyse konzentriert sich auf den Inhalt, während formale Aspekte vernachlässigt werden. Der Vergleich mit Elementen des Artusromans wird als notwendig erachtet.
1 Entstehung und Bedeutung der Dietrichepik: Dieses Kapitel definiert die Dietrichepik und beschreibt ihren historischen Ursprung in der Völkerwanderungszeit und ihre Verbindung zu Theodorich dem Großen. Es hebt die bisherige Forschungsnachlässigkeit im Vergleich zur Nibelungensage hervor und betont die mündliche Überlieferung der Erzählstoffe.
2 Die Figur des Dietrich von Bern: Dieses Kapitel analysiert die literarische Figur des Dietrich von Bern, indem es seine Tugenden, seine Rolle im Frauendienst (in beiden Epen), sein Zaudern als charakteristisches Merkmal der aventiurehaften Dietrichepik, seine Klage und seine Kämpfe beleuchtet. Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Darstellung in 'Eckenlied' und 'Rosengarten' werden detailliert untersucht und interpretiert.
3 Höfische und unhöfische Elemente im 'Eckenlied' und im 'Rosengarten zu Worms': Dieser Abschnitt vergleicht die Anteile höfischer und unhöfischer Elemente in beiden Epen. Die Analyse untersucht, wie diese Elemente die Darstellung Dietrichs und die Gesamtgeschichte beeinflussen und inwiefern sie sich zwischen den beiden Werken unterscheiden.
4 Tragik und Komik im 'Eckenlied' und im 'Rosengarten': Dieses Kapitel untersucht die tragischen und komischen Aspekte in beiden Epen. Es analysiert, wie diese Elemente die Charakterisierung Dietrichs und die Gesamtgestaltung der Erzählung beeinflussen und wie sie sich zwischen den beiden Werken unterscheiden.
Schlüsselwörter
Dietrichepik, Dietrich von Bern, Eckenlied, Rosengarten zu Worms, aventiurehafte Epik, Theodorich der Große, höfische Epik, unhöfische Elemente, Tragik, Komik, Heldenfigur, mittelhochdeutsche Literatur, Vergleichende Literaturanalyse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse der Dietrichepik: Eckenlied und Rosengarten
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Figur des Dietrich von Bern in zwei aventiurehaften Dietrichepen: dem „Eckenlied“ und dem „Rosengarten zu Worms“ (Fassung A). Der Fokus liegt auf dem Vergleich der Darstellung Dietrichs in beiden Texten, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzuzeigen und deren Entstehung und Funktion zu ergründen. Formale Aspekte werden dabei vernachlässigt.
Welche Aspekte der Figur Dietrich von Bern werden untersucht?
Die Analyse konzentriert sich auf verschiedene Facetten der literarischen Figur Dietrich von Bern. Dazu gehören seine Tugenden, seine Rolle im Frauendienst, sein charakteristisches Zaudern, seine Kämpfe und seine Klage. Die Untersuchung umfasst sowohl den Vergleich der Darstellung in beiden Epen als auch die Interpretation dieser Unterschiede und Gemeinsamkeiten.
Welche weiteren Themen werden in der Arbeit behandelt?
Neben der detaillierten Analyse der Figur Dietrich von Bern werden auch höfische und unhöfische Elemente in beiden Epen verglichen. Die Arbeit untersucht, wie diese Elemente die Darstellung Dietrichs und die Gesamtgeschichte beeinflussen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Analyse tragischer und komischer Aspekte in den beiden Werken und deren Einfluss auf die Charakterisierung Dietrichs und die Erzählstruktur.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, vier Hauptkapitel und ein Fazit. Kapitel 1 behandelt Entstehung und Bedeutung der Dietrichepik. Kapitel 2 analysiert die Figur des Dietrich von Bern. Kapitel 3 vergleicht höfische und unhöfische Elemente in den beiden Epen. Kapitel 4 untersucht Tragik und Komik. Die Einleitung und Zusammenfassung der Kapitel geben einen Überblick über die Forschungsfrage und die Ergebnisse.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit basiert auf einer detaillierten Analyse des „Eckenliedes“ und des „Rosengartens zu Worms“ (Fassung A). Weitere Quellen werden im Text zitiert und im Literaturverzeichnis aufgelistet (nicht explizit in diesem HTML-Auszug enthalten).
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Dietrichepik, Dietrich von Bern, Eckenlied, Rosengarten zu Worms, aventiurehafte Epik, Theodorich der Große, höfische Epik, unhöfische Elemente, Tragik, Komik, Heldenfigur, mittelhochdeutsche Literatur, Vergleichende Literaturanalyse.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, ein umfassendes Verständnis der Darstellung Dietrichs von Bern in den beiden ausgewählten Epen zu entwickeln und die Unterschiede und Gemeinsamkeiten seiner Charakterisierung zu erklären. Der Vergleich soll zu einem tieferen Einblick in die aventiurehafte Dietrichepik und ihre literarischen Besonderheiten führen.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine vergleichende Literaturanalyse, um die Darstellung Dietrichs von Bern im „Eckenlied“ und im „Rosengarten“ zu untersuchen. Der Fokus liegt auf der inhaltlichen Ebene, wobei formale Aspekte vernachlässigt werden.
- Quote paper
- Claudia Behm (Author), 2004, Die Figur des Dietrich von Bern im "Eckenlied" und im "Rosengarten A", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/57526