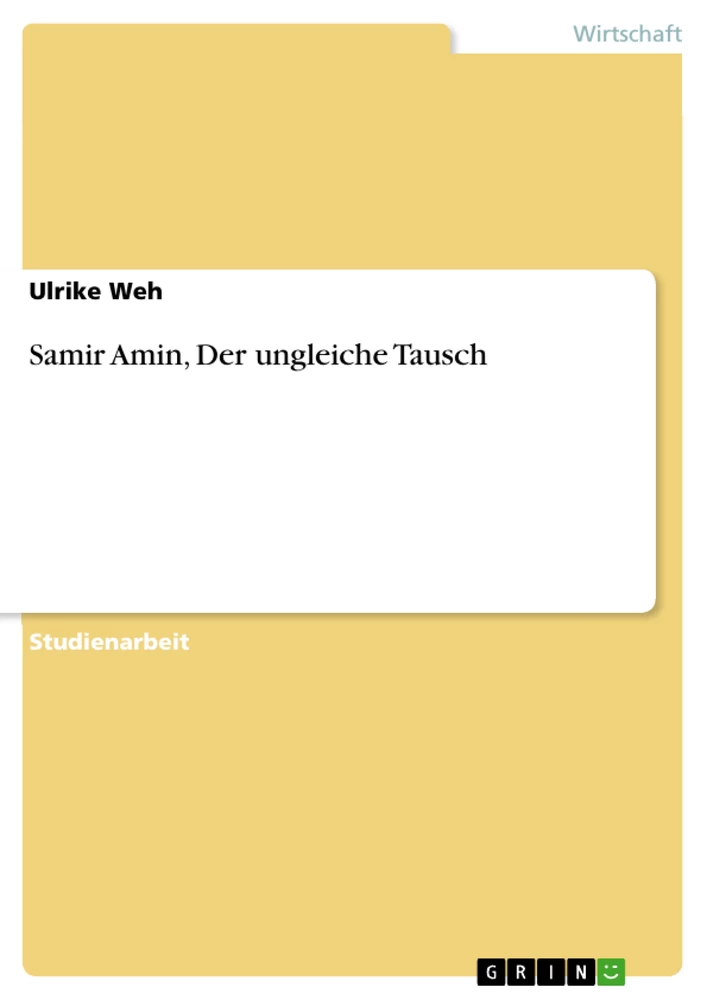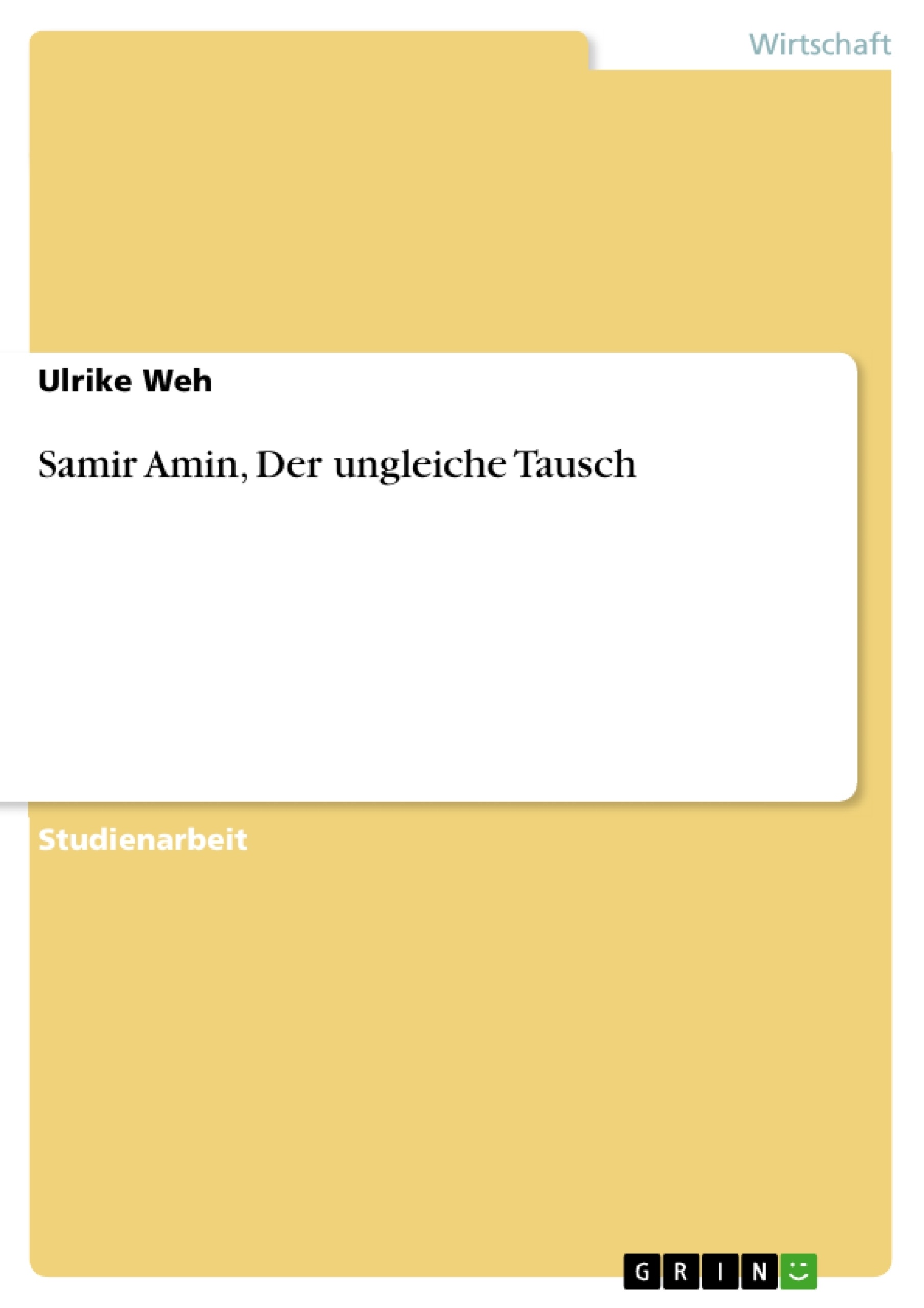Seit der Antike versuchten die Menschen durch den Austausch von Waren mit anderen Ländern die engen Grenzen ihrer Ökonomie zu erweitern und sich dadurch Konsum- und Produktivitätsalternativen zu ermöglichen. Charakteristisch bei diesem Handel war, dass er, bezogen auf die Region, den Gegenstand und den Handelspartner überwiegend freiwillig und selektiv stattfand. Nach einer langen Zeit der Kolonialisierung begann mit dem Ende des 2. Weltkrieges eine Phase der grundsätzlich freien, aber durch vielfältige wirtschaftliche und politische Interessen dennoch protektionistischen Welthandels. Durch die wachsende Bedeutung des Fertigwarenhandels und damit des Warenaustauschs zwischen den Fertigwarenproduzenten sowie die rasch zunehmende Macht multinationaler Konzerne, begannen sich die Gewichte im Welthandel noch stärker als zuvor zu den klassischen Industrieländern hin zu verschieben. Ein Geflecht bi- und multilateraler Verträge und Abkommen, geprägt von Traditionen und Erfahrungen, bildet die Grundlage der heutigen Welthandels- und Weltwirtschaftsordnung. Das Konzept des freien Welthandels basiert auf der Annahme, dass sich dadurch die weltweite Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen verbessert. Meistens wird stillschweigend davon ausgegangen, dass von den Wohlfahrtsgewinnen alle am Handel beteiligten Nationen und eventuell sogar in gleichem Umfang profitieren. Die Praxis zeigt aber, dass unterschiedliche polit-ökonomische Ausgangsbedingungen und die damit im Zusammenhang stehende ungleiche Verteilung von Macht zu ungleichen Tauschbeziehungen führen. Bisher gibt es keinen theoretischen Ansatz, der dieses Phänomen vollständig erklärt. Allerdings wurden, vor allem zwischen 1960 und 1975, verschiedene Lösungsansätze veröffentlicht. Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf den Thesen von Arghiri Emmanuel, der mit seinem Werk „L’échange inégal“ die Öffentlichkeit erstmals auf dieses Thema aufmerksam machte. Es wird zunächst erklärt, warum überhaupt internationaler Handel stattfindet. In diesem Zusammenhang wird das Theorem der komparativen Kosten erläutert. Im folgenden wird dargelegt, ob und warum Handel unfair sein kann. Wie bereits erwähnt, bietet Emmanuels Theorem hier einen Erklärungsversuch an. Nach verschiedenen Kritiken an diesem Modell, folgt die Problematik der Messung von Ungleichem Tausch und damit eine Betrachtung der Terms of Trade. Abschließende wird betrachtet, welche Rolle der Ungleiche Tausch im Welthandel spielt. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ricardo's Theorem der komparativen Kosten
- Emmanuel´s Theorie des Ungleichen Tauschs
- Prämissen
- Thesen
- Kritik an Emmanuel's Theorie
- Terms of Trade
- Busch
- Prebisch
- Samir Amin's Aspekte der Ungleichen Entwicklung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Theorie des Ungleichen Tauschs im internationalen Handel und versucht zu erklären, warum trotz freier Märkte ungleiche Tauschbeziehungen entstehen können. Sie analysiert insbesondere die Thesen von Arghiri Emmanuel, der mit seinem Werk „L'échange inégal“ auf dieses Phänomen aufmerksam machte. Darüber hinaus wird der Zusammenhang mit der „Ungleichen Entwicklung“ im Welthandel untersucht.
- Das Theorem der komparativen Kosten von David Ricardo
- Die Theorie des Ungleichen Tauschs von Arghiri Emmanuel
- Kritik an Emmanuel's Theorie
- Die Bedeutung der Terms of Trade
- Samir Amins Konzept der Ungleichen Entwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die historische Entwicklung des internationalen Handels und die wachsende Bedeutung von Fertigwaren und multinationalen Unternehmen. Sie führt in die Problematik des Ungleichen Tauschs ein und hebt die Bedeutung von Emmanuel's Theorie hervor.
- Ricardo's Theorem der komparativen Kosten: Dieses Kapitel stellt das Theorem der komparativen Kosten von David Ricardo vor, das die Grundlage für den internationalen Handel bildet. Es wird erläutert, wie sich durch Spezialisierung und Handel die Wohlfahrt aller Beteiligten steigern lässt.
- Emmanuel´s Theorie des Ungleichen Tauschs: Dieses Kapitel stellt die Kernaussagen von Emmanuel's Theorie des Ungleichen Tauschs vor. Emmanuel argumentiert, dass Unterschiede in den Lohnniveaus zu ungleichen Tauschbeziehungen führen können, die zu Ungleichheit und Unterentwicklung in ärmeren Ländern führen. Es werden die Prämissen von Emmanuel's Modell und seine zentrale These erläutert.
- Kritik an Emmanuel's Theorie: Dieses Kapitel behandelt die Kritik an Emmanuel's Theorie, die von verschiedenen Ökonomen geäußert wurde. Kritiker argumentieren, dass Emmanuel's Modell zu vereinfacht ist und wichtige Faktoren wie Kapitalmobilität und Technologietransfer nicht berücksichtigt. Es werden die wichtigsten Kritikpunkte an Emmanuel's Modell dargestellt.
- Terms of Trade: Dieses Kapitel befasst sich mit der Problematik der Messung von Ungleichem Tausch und betrachtet verschiedene Messgrößen, die als Terms of Trade bezeichnet werden. Es wird erläutert, wie die Terms of Trade die Verteilung der Vorteile im internationalen Handel beeinflussen können.
- Busch: Dieses Kapitel behandelt die Thesen von Busch, der die Bedeutung des Ungleichen Tauschs für die Entwicklung der Peripherie analysiert. Es werden die wichtigsten Argumente von Busch zusammengefasst.
- Prebisch: Dieses Kapitel befasst sich mit den Thesen von Prebisch, der die strukturelle Ungleichheit im Welthandel untersucht. Es werden die wichtigsten Argumente von Prebisch zusammengefasst.
- Samir Amin's Aspekte der Ungleichen Entwicklung: Dieses Kapitel stellt die wichtigsten Thesen von Samir Amin zur Ungleichen Entwicklung vor. Amin analysiert die Auswirkungen des Ungleichen Tauschs auf die wirtschaftliche Entwicklung von Entwicklungsländern. Es werden seine Kernaussagen und seine Kritik an der bestehenden Weltwirtschaftsordnung zusammengefasst.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Ungleicher Tausch, Internationale Beziehungen, Internationale Handelstheorie, Terms of Trade, Entwicklungstheorie, Entwicklungsländer, Periphery, Core, Arghiri Emmanuel, Samir Amin, David Ricardo, komparativer Kostenvorteil. Sie analysiert empirische Forschungsbefunde zu den Auswirkungen des Ungleichen Tauschs auf die wirtschaftliche Entwicklung und die Einkommensverteilung im Welthandel.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Theorie des ungleichen Tauschs?
Diese von Arghiri Emmanuel geprägte Theorie besagt, dass im Welthandel durch unterschiedliche Lohnniveaus ein Werttransfer von armen zu reichen Ländern stattfindet, was zu Unterentwicklung führt.
Was besagt David Ricardos Theorem der komparativen Kosten?
Ricardo argumentierte, dass internationaler Handel für alle Beteiligten vorteilhaft ist, wenn sich jedes Land auf die Produktion der Güter spezialisiert, die es relativ am effizientesten herstellen kann.
Warum kritisierte Samir Amin die bestehende Weltwirtschaftsordnung?
Amin sah in der "ungleichen Entwicklung" eine Folge des kapitalistischen Weltsystems, das die Peripherie (Entwicklungsländer) strukturell benachteiligt und vom Zentrum (Industrieländer) abhängig macht.
Was sind "Terms of Trade"?
Das reale Austauschverhältnis zwischen Export- und Importgütern. Verschlechtern sich die Terms of Trade eines Landes, muss es mehr exportieren, um die gleiche Menge an Importen zu finanzieren.
Welche Rolle spielen multinationale Konzerne beim ungleichen Tausch?
Durch ihre Macht können multinationale Konzerne Preise beeinflussen und von den niedrigen Löhnen in Entwicklungsländern profitieren, was die ungleichen Tauschbeziehungen verstärkt.
- Citation du texte
- Dipl. Verwaltungswissenschaftler Ulrike Weh (Auteur), 2002, Samir Amin, Der ungleiche Tausch, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/57636