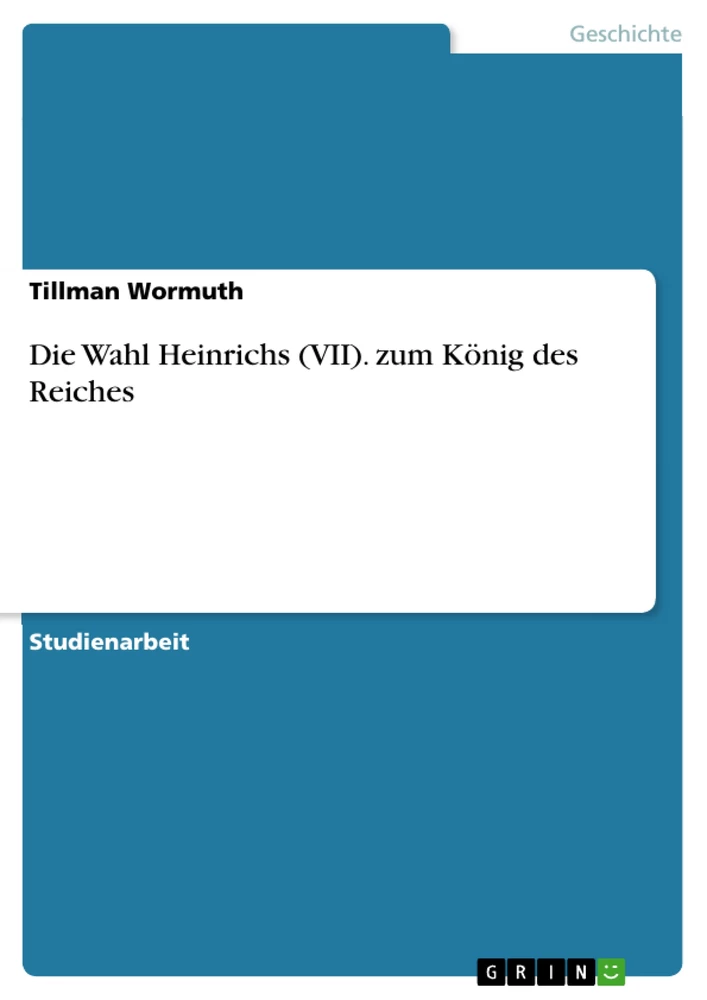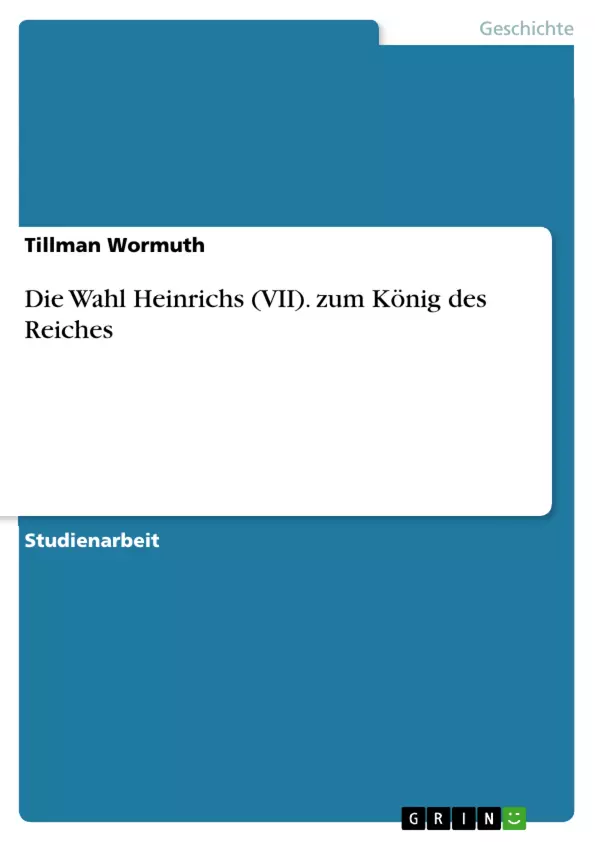Unio Regni ad Imperium – die Vereinigung des Königreiches Sizilien mit dem Reich.
Staufische Herrschaft – wider kirchliche Interessen. Der Konflikt zwischen weltlicher und kirchlicher Macht begann bereits 1059 mit dem Investiturstreit1, dem der „Gang nach Canossa“ von König Heinrich IV. 10772 folgte, und der letztlich im „Wormser Konkordat“ von 11223 einen Kompromiss fand. Die Stauferzeit bildete den Höhepunkt der Auseinandersetzung zwischen geistlicher und weltlicher Macht. Es ging nunmehr allerdings nicht mehr um geistliche Fragen, sondern um Herrschaftsrechte in Italien und die Zurückdrängung des päpstlichen Machtanspruchs.
Nach einem anfänglichen Bündnis Kaiser Friedrich Barbarossas mit Papst Eugen III., das dem Papst Schutz gegen Normannen und den römischen Adel gewähren sollte, kam es zu einem Bruch zwischen dem Kaiser und Eugens Nachfolger Hadrian IV.4
Es begann ein langer politischer und militärischer Kampf, der von wechselnden Bündnissen, Waffenstillständen und Kompromissen geprägt war. Schließlich verlobte Friedrich seinen Sohn Heinrich VI. mit Konstanze, einer Tochter des normannischen Königs Roger II.5
Nachdem Kaiser Friedrich Barbarossa am 10. April 1190, während des 3. Kreuzzuges, im Fluss Saleph ertrank, trat sein Sohn in die Nachfolge.6 Heinrich VI. wurde 1191 zum Kaiser gekrönt und trat 1194 zum Feldzug gegen das sizilianische Normannenreich an. Er zog im November in Palermo ein und ließ sich am Weihnachtstag 1194 zum König von Sizilienkrönen.
[...]
1 Schieder (hrsg.), T.: Handbuch der europäischen Geschichte. Band II, Stuttgart 1987. S.280- 286.
2 Jakobs, H.: Oldenbourg, Grundriß der Geschichte. Band VII, München 1988. S. 27.
3 Jakobs, H.: München 1988. S. 34.
4 Engels, O.: Die Staufer. Stuttgart – Berlin – Köln 1998. S. 62.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: S. 1
-
- Die Problematik der Unio Regni ad Imperium: S. 3
- Friedrichs Vorbereitungen zur Wahl seines Sohnes zum Rex Romanorum: S. 5
- Die Wahl Heinrichs (VII).: S. 9
- Schlussbetrachtung: S. 14
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Wahl Heinrichs (VII). zum Rex Romanorum im Jahr 1220 und beleuchtet die Rolle Friedrichs II. bei diesem Prozess. Die Analyse fokussiert auf die Frage, ob Friedrich die Wahl seines Sohnes aktiv betrieb oder ob sie für ihn überraschend erfolgte. Sollten die Vorbereitungen Friedrichs zur Königserhebung Heinrichs bewiesen werden, erhebt sich die weitere Frage, ob Friedrich die Vereinigung des Königreiches Sizilien mit dem Imperium anstrebte.
- Die Problematik der Unio Regni ad Imperium und die Spannung zwischen geistlicher und weltlicher Macht im 12. Jahrhundert.
- Friedrichs II. Strategien zur Sicherung seiner Herrschaft und seine Beziehungen zum Papsttum.
- Die Rolle der päpstlichen Politik im Konflikt um die Nachfolge Friedrichs II.
- Die Bedeutung der Hoftage in der mittelalterlichen Reichspolitik.
- Die Rolle von Briefen und Urkunden als Quellenmaterial für die historische Forschung.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung bietet einen historischen Überblick über den Konflikt zwischen der staufischen Herrschaft und der Kirche, beginnend mit dem Investiturstreit. Sie führt in die Problematik der Unio Regni ad Imperium ein und beleuchtet den Lebensweg von Friedrichs II. bis zum Jahr 1220.
Die Problematik der Unio Regni ad Imperium
Dieses Kapitel analysiert die Herausforderungen, die die Vereinigung des Reiches mit dem Königreich Sizilien für Friedrich II. mit sich brachte. Es diskutiert die Konflikte mit dem Papsttum und beleuchtet Friedrichs strategische Schritte zur Sicherung seiner Herrschaft, wie die Eheschließung von Heinrich (VII). mit Konstanze von Sizilien und die Einführung Heinrichs (VII). in die deutsche Politik.
Schlüsselwörter
Friedrich II., Heinrich (VII)., Unio Regni ad Imperium, Staufer, Papsttum, Konflikt, Herrschaft, Reichspolitik, Hoftage, Brief, Urkunde, Quellenforschung, Geschichte.
- Citation du texte
- Tillman Wormuth (Auteur), 2003, Die Wahl Heinrichs (VII). zum König des Reiches, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/57661