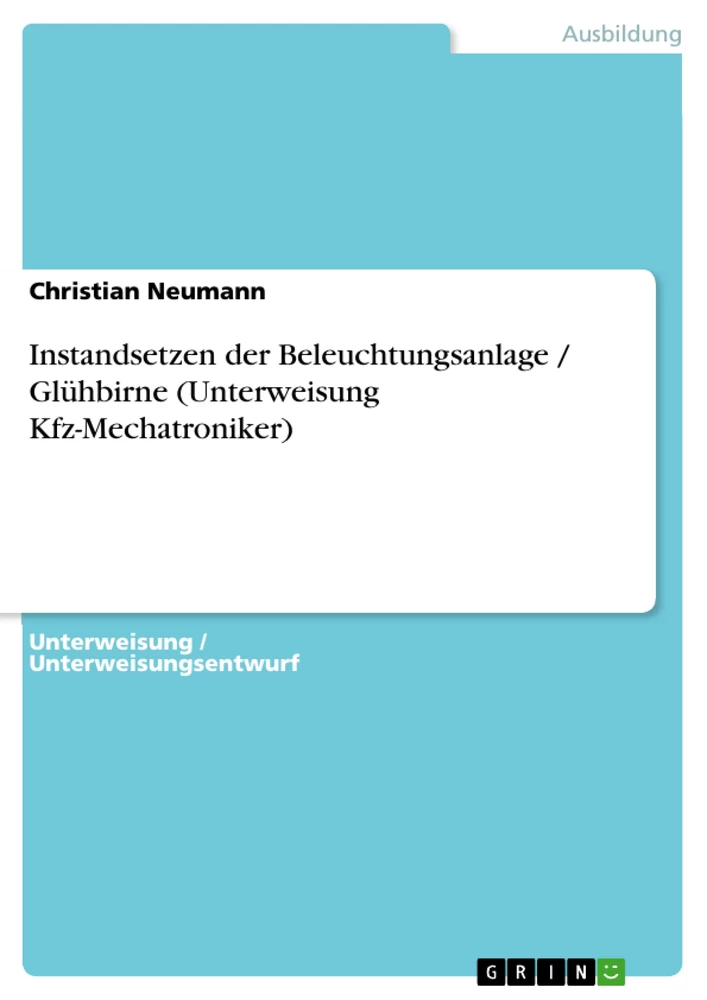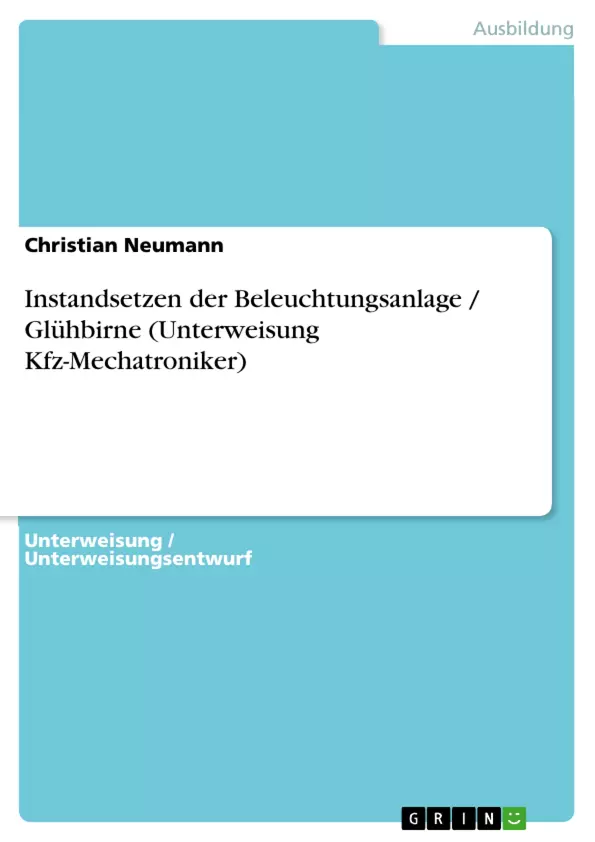Der Auszubildende Manuel B. ist 17 Jahre alt und hat letztes Jahr seine Schulausbildung mit einem durchschnittlichen Hauptschulabschluss abgeschlossen. Er ist Einzelkind und kommt aus geordneten Familienverhältnissen, in denen beide Elternteile berufstätig sind. Manuel widmet seine Freizeit komplett der Freiwilligen Feuerwehr. Er ist dort seit einigen Jahren schon „Aktives“ Mitglied und zeigt großes Interesse. Er befindet sich zum Zeitpunkt der Unterweisung in der 2. Hälfte des 1. Ausbildungsjahres. Da er das Thema „Komfortelektronik (Beleuchtungssysteme)“ bis jetzt weder in der Berufsschule, noch in der überbetrieblichen Ausbildung hatte, muss ich davon ausgehen das er von diesem komplexen Thema keine Vorkenntnisse hat. Manuel zeigt zwar großes Interesse am Arbeitsplatz und bringt bedingt durch sein Hobby Feuerwehr und dem Interesse an Kraftfahrzeugen schon ein paar Kenntnisse mit, jedoch muss man ihn immer wieder zum Erlernen neuer Arbeitstechniken und Wissen motivieren. Es gelingt ihm zwar nicht immer, die oft sehr schwierigen Arbeitsschritte auf Anhieb zu verstehen, dennoch bemüht er sich, nachdem man es ihm vorgemacht bzw. erklärt hat, es mündlich zu wiederholen und im praktischen Teil umzusetzen. Als Ort der Unterweisung wähle ich einen abgetrennten und hell beleuchteten Raum in unserer Firma. Vor der Unterweisung sind eventuell ankommende Anrufe umzuleiten. Des Weiteren ist an der Tür durch ein Hinweisschild „Bitte nicht stören“ anzubringen, damit der Lehrling in seiner Leistungsaufnahme nicht gestört wird. Ich bin darum bemüht die Unterweisung an einem Dienstag oder Mittwochmorgen zwischen 9Uhr und 11Uhr durchzuführen, da die Leistungsfähigkeit, anhand der Leistungskurve, in dieser Zeit am größten ist.
Als Dauer setze ich für die Unterweisung ca. 20min an, damit keine Störungen aufkommen, die den Auszubildenden beunruhigen und negativ beeinflussen können. Des Weiteren kann so der Auszubildende, nach einer kurzen Pause, sein gerade erlerntes Wissen, noch einmal selbst testen, um diese Arbeit sicher und ohne Fehler zu verrichten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Rahmenbedingungen
- 1.1 Adressatenanalyse
- 1.1.1 Leistungsstand
- 1.1.2 Leistungsfähigkeit
- 1.2 Ort der Unterweisung
- 1.3 Unterweisungszeitpunkt und Dauer
- 1.4 Arbeitsmittel
- 1.1 Adressatenanalyse
- 2. Didaktische Analyse
- 2.1 Thema der Unterweisung/Einordnung in den ARP
- 2.2 Formulierung der Lernziele
- 2.2.1 Richtziel
- 2.2.2 Grobziel
- 2.2.3 Feinziele
- 2.2.3.1 Kognitive Lernziele
- 2.2.3.2 Psychomotorische Lernziele
- 2.2.3.3 Affektive Lernziele
- 2.3 Erwerb von Schlüsselqualifikationen und Kompetenzen
- 2.3.1 Fachkompetenz
- 2.3.2 Methodenkompetenz
- 2.3.3 Sozialkompetenz
- 3. Methodische Analyse
- 3.1 Begründung für die angewandte(n) Unterweisungsmethode(n)
- 3.2 Angewandte Unterweisungsprinzipien
- 3.3 Medieneinsatz
- 4. Ablauf der Unterweisung
- 5. Lernerfolgskontrolle
- 6. Anlagen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Unterweisungsentwurf zielt darauf ab, dem Auszubildenden die notwendigen Fähigkeiten und Kenntnisse zum Wechseln einer Glühbirne in einer Beleuchtungsanlage zu vermitteln. Der Schwerpunkt liegt auf der praktischen Ausführung des Arbeitsschrittes unter Einhaltung der relevanten Sicherheitsvorschriften und Normen. Der Entwurf integriert zudem theoretisches Wissen über die Funktionsweise der Beleuchtungseinrichtung und die Bedeutung der entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen.
- Sicherheitsvorkehrungen und Schutzmaßnahmen
- Praktische Anwendung von Werkzeugen und Materialien
- Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Wechseln einer Glühbirne
- Qualitätskontrolle und Funktionsüberprüfung der Beleuchtungsanlage
- Übertragung des erlernten Wissens auf ähnliche Aufgaben
Zusammenfassung der Kapitel
1. Rahmenbedingungen
Dieser Abschnitt stellt den Auszubildenden Manuel B. vor, seine schulische und berufliche Vorbildung, seine Persönlichkeit und seine Interessen. Dabei werden auch seine Leistungsfähigkeit und sein Leistungsstand im Hinblick auf das Thema der Unterweisung beurteilt.
1.1 Adressatenanalyse
Es wird auf Manuels Kenntnisse und Fähigkeiten im Bereich der KFZ-Mechatronik eingegangen, wobei sein Interesse an der Freiwilligen Feuerwehr als relevantes Beispiel für seine Motivation und sein Engagement erwähnt wird.
1.2 Ort der Unterweisung
Der Abschnitt beschreibt die gewählte Umgebung für die Unterweisung und die notwendigen Vorkehrungen, um Störungen während der Ausbildung zu minimieren.
1.3 Unterweisungszeitpunkt und Dauer
Es wird auf die optimale Zeit für die Unterweisung eingegangen und die Dauer der Unterweisung festgelegt.
1.4 Arbeitsmittel
Dieser Teil listet die benötigten Werkzeuge, Materialien und Sicherheitsausrüstung auf, die für den Glühbirnenwechsel verwendet werden.
2. Didaktische Analyse
Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit den pädagogischen Aspekten der Unterweisung.
2.1 Thema der Unterweisung/Einordnung in den ARP
Es wird die Bedeutung des Themas "Wechseln einer Glühbirne" im Kontext der Ausbildung zum KFZ-Mechatroniker hervorgehoben und seine Einordnung in den Ausbildungsrahmenplan erläutert.
2.2 Formulierung der Lernziele
Dieser Teil stellt die Lernziele der Unterweisung dar, unterteilt in Richtziel, Grobziel und Feinziele, die wiederum in kognitive, psychomotorische und affektive Lernziele unterteilt werden.
2.3 Erwerb von Schlüsselqualifikationen und Kompetenzen
Es wird darauf eingegangen, welche Kompetenzen der Auszubildende im Rahmen der Unterweisung erwirbt, insbesondere im Hinblick auf Fachkompetenz, Methodenkompetenz und Sozialkompetenz.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselbegriffe in diesem Unterweisungsentwurf sind: Beleuchtungsanlage, Glühbirne, Sicherheitsvorkehrungen, UVV, KFZ-Mechatronik, Ausbildungsrahmenplan, Lernziele, Fachkompetenz, Methodenkompetenz, Sozialkompetenz, Werkzeuge, Materialien, praktische Anwendung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Unterweisung zum Wechseln einer Glühbirne?
Ziel ist es, dem Auszubildenden die praktischen Fähigkeiten und das theoretische Wissen zu vermitteln, um eine Glühbirne sicher, fehlerfrei und unter Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften (UVV) zu wechseln.
Warum wird die Unterweisung zwischen 9 und 11 Uhr durchgeführt?
In diesem Zeitraum ist die menschliche Leistungskurve am höchsten, was die Konzentrations- und Aufnahmefähigkeit des Auszubildenden optimiert.
Welche Lernziele werden unterschieden?
Es wird zwischen kognitiven (Wissen), psychomotorischen (handwerkliche Fertigkeiten) und affektiven Lernzielen (Einstellung zur Arbeit und Sicherheit) unterschieden.
Welche Kompetenzen erwirbt der Kfz-Mechatroniker-Lehrling?
Neben der Fachkompetenz (technisches Wissen) werden auch Methodenkompetenz (systematisches Vorgehen) und Sozialkompetenz (Kommunikation im Betrieb) gefördert.
Wie wird der Lernerfolg kontrolliert?
Der Lernerfolg wird durch das praktische Vormachen und anschließende selbstständige Ausführen durch den Lehrling sowie durch mündliche Wiederholungen der Arbeitsschritte kontrolliert.
- Citar trabajo
- Christian Neumann (Autor), 2006, Instandsetzen der Beleuchtungsanlage / Glühbirne (Unterweisung Kfz-Mechatroniker), Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/57668