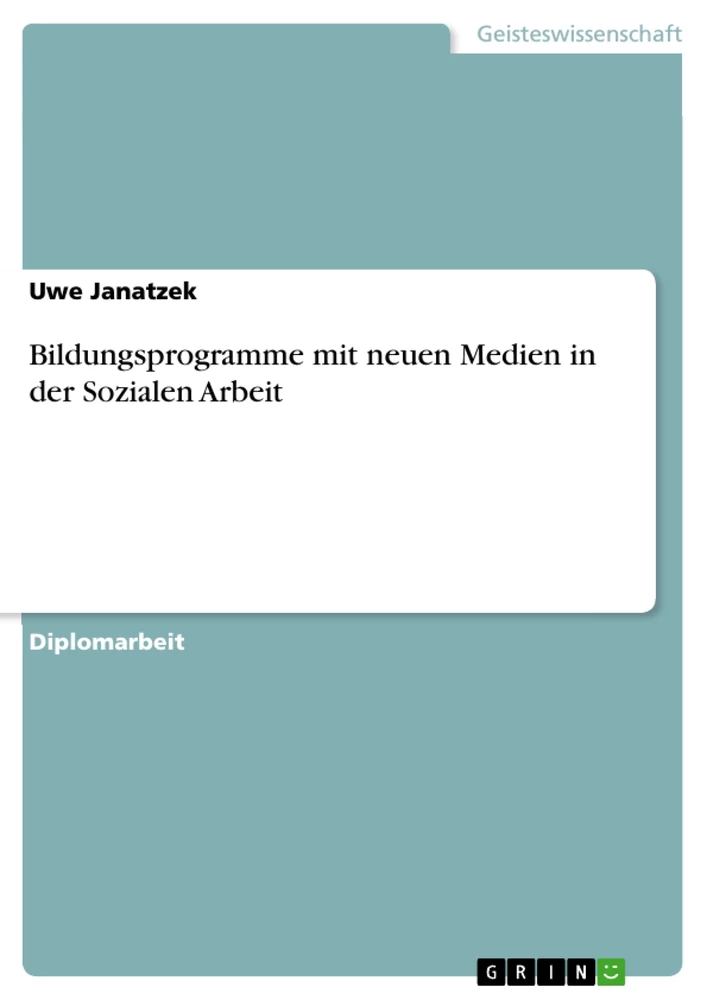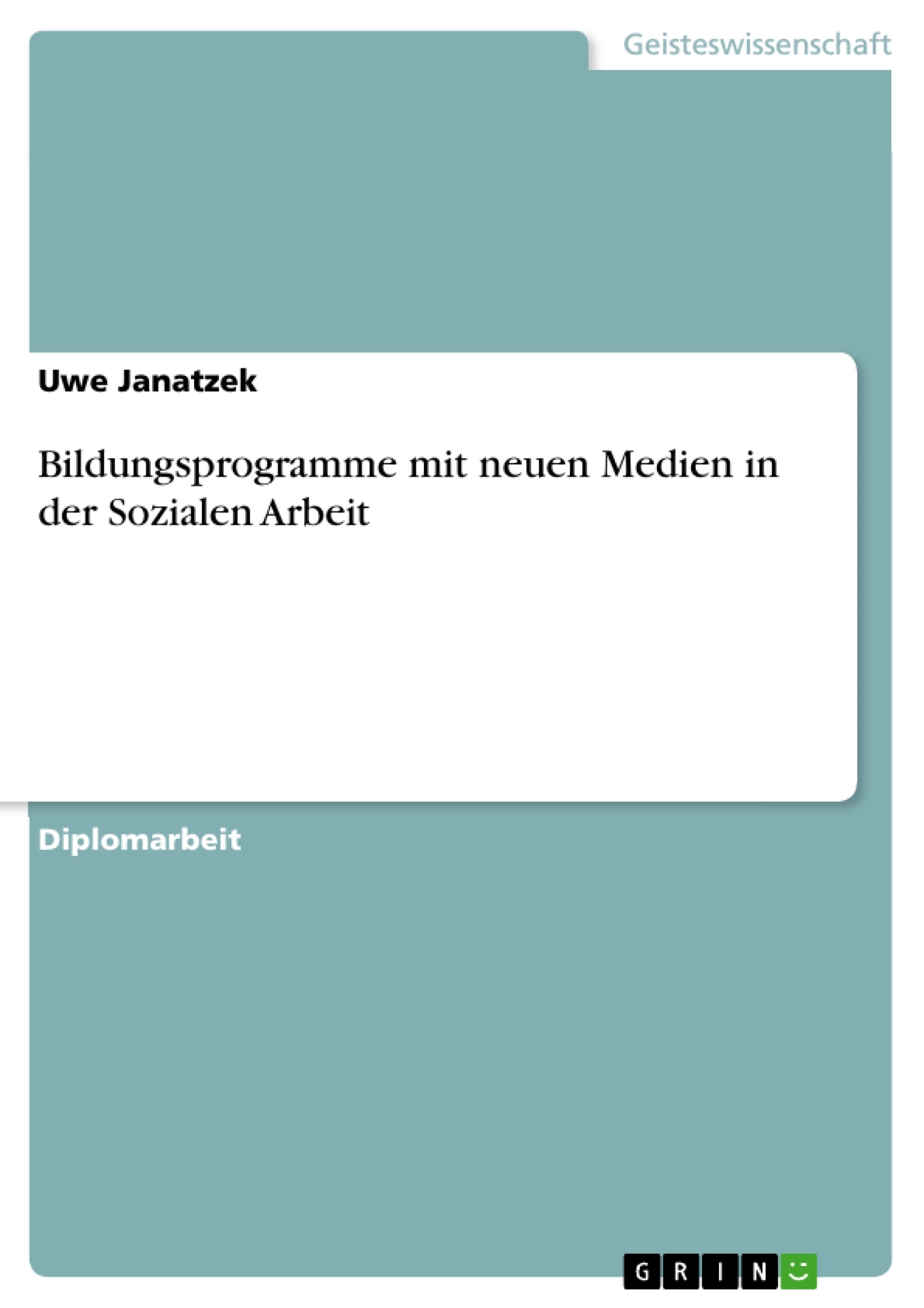Der vorliegende Text befasst sich mit den technischen und pädagogischen Aspekten von E-Learning und Blended-Learning und wie diese im Rahmen der Sozialen Arbeit nutzbringend eingesetzt werden können.
Nach einem historischen Abriß zur Entstehung und zum theoretischen Hintergrund des E- und Blended-Learning erfolgt eine Betrachtung der technischen Voraussetzungen und Möglichkeiten bzw. der Instrumente dieser Lernformen sowie ein Vergleich mit den "klassischen" Sozialformen des Unterrichts. Ein wesentlicher Punkt dabei ist, auch die Grenzen der medial gestützten und ortsunabhängigen "elektronischen" Lernformen aufzuzeigen und übertriebene Erwartungen zu relativieren.
Im weiteren Verlauf werden konkrete Blended-Learning-Veranstaltungen mit Modellcharakter, wie sie an deutschen Hochschulen durchgeführt wurden, analysiert und Vor- und Nachteile diskutiert sowie die Relevanz dieser Modelle für die Soziale Arbeit besprochen. Auf dieser Grundlage wird ein eigenes modular aufgebautes Modell auf gruppenpädagogischer Grundlage entwickelt, dessen Schwerpunkt auf der didaktisch-methodischen Planung von Blended-Learning-Seminaren für Zielgruppen der Sozialen Arbeit liegt. Dabei wird auch auf grundsätzliche Problematiken wie die der Gruppenzusammensetzung, der computerbezogenen Interaktion und Interaktivität, möglicher negativer innerer und äußerer Einflußgrößen sowie auf die Problematik der Zielsetzung eingegangen. Weiterhin wird auch die gerade in gruppenpädagogischen Zusammenhängen sehr wichtige Rolle des Anleiters bzw. Gruppenpädagogen besprochen. In diese Betrachtungen fließen auch politische, erkenntnistheoretische, berufsethische und sozialinformatische Aspekte mit ein.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung, Begriffsdefinitionen und Themenbeschreibung:
- Begriff des E-Learning:
- E-Learning - Erwartungen und Realität:
- Unattraktive Zielgruppen für kommerzielle Produkte:
- Keine Berücksichtigung von Problemstellungen, Beding Jungen und Methoden der Sozialen Arbeit:
- Bevorzugte Ausrichtung auf Know-How:
- Mangelnde Erfolge und nicht erfüllte Erwartungen beim Einsatz von E-Learning:
- Unzureichende didaktische und methodische Vorüberlegungen hinsichtlich psychosozialer Hemmnisse auf Seiten des Lernenden:
- Gestalterische und kommunikative Defizite:
- Mangelnde computer literacy auf Seiten der Lehrende 1:
- Rechtliche Hindernisse und Aspekte:
- Zeitaufwand auf Seiten der Lehrenden:
- Fehlende Datengrundlage und Zielorientierung:
- Zusammenfassung und Kritik:
- Folgerungen:
- Instrumente des E-Learning als integraler Bestandteil c es "virtual class-room":
- Kommunikationsbezogene Instrumente:
- Foren:
- Chats und PM:
- Videokonferenz / einseitige videogestützte Vorlesung:
- E-Mail:
- Kooperationsbezogene Instrumente:
- File-Sharing und File-Upload, Application Sharing:
- White-Boards:
- Blogs:
- Foren:
- Instrumente zur Bereitstellung von Daten- bzw. Lernma terial:
- Multiple-Choice:
- Quiz:
- Ausgabe schriftlicher Aufgabenstellungen:
- Linklisten:
- Literaturlisten:
- Slide-Show-Funktionen:
- Blogs und Foren:
- Lexika und Glossare:
- Umfragen und Abstimmungen:
- Instrumente zur Aufgabenerstellung:
- CMS/Content-Management-Systeme:
- Zusammenfassung und Kritik:
- Blended-Learning:
- Der Begriff des Blended-Learning:
- Darstellung beispielhafter Handlungsmodelle:
- Modell 1 ("semivirtuelle" Vorlesung, Hochschule):
- Verlauf:
- Anmerkungen:
- Modell 2 (Weiterbildung im Hochschulrahmen):
- Verlauf und Inhalte:
- Anmerkungen:
- Relevanz der Modelle für die Soziale Arbeit:
- Vorschlag zu einem angepaßten Blended-Learnin 3 im Rahmen der Sozialen Arbeit:
- Grundsätzliche Problematiken:
- Zur Problematik der Gruppenzusammensetzung:
- Zur Problematik der Begriffe der computerbezogenen Interaktion und Interaktivität:
- Problematik möglicher negativer innerer und äußerer Einflußgrößen:
- Problematik der Zielsetzung:
- Grundbedingungen zur Anwendung:
- Inklusionsansatz und Realkonzept:
- Datenerhebung und Auswertung:
- Mehrschichtige Zielsetzung - Lernziel und klientenzenti ierte Zielsetzung:
- Ausrichtung an den Grundlagen der Gruppenarbeit:
- Zu berücksichtigende Wissenserwerbsmethoden und - ansätze:
- Akzeptanz der sich verändernden Rolle des Lehrender:
- Konkrete Anwendung - Phasenabläufe und Ablaufmodiile:
- Modularisierung:
- Modulklassifikation:
- Module zur Gruppenprozeßsteuerung (MG):
- Lernsystembezogene Module (LM):
- Befähigungsmodule (BM):
- Themenbezogene Module (TM):
- Module für allgemeine Zwecke (ZM):
- Aufgaben des Lernprozeßbegleiters während der Onlir e-Phasen:
- Beispielhafte Anwendung des modularisierten und angepaẞten Blended-Learning:
- Abschließende Bemerkungen:
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit der Integration von neuen Medien in Bildungsprogramme der Sozialen Arbeit. Ziel ist es, die Herausforderungen und Möglichkeiten des E-Learnings und des Blended-Learnings im Kontext der Sozialen Arbeit zu analysieren und ein angepasstes Modell für die praktische Anwendung zu entwickeln.
- Analyse der Eignung und Effektivität von E-Learning in der Sozialen Arbeit
- Untersuchung von Instrumenten und Methoden des E-Learnings
- Entwicklung und Validierung eines Blended-Learning-Modells für die Soziale Arbeit
- Berücksichtigung von spezifischen Herausforderungen und Bedürfnissen der Zielgruppe
- Konkrete Umsetzungsmöglichkeiten in der Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition und Abgrenzung des Begriffs "E-Learning". Es werden die Erwartungen und die Realität des E-Learnings im Allgemeinen beleuchtet und die spezifischen Herausforderungen und Möglichkeiten des E-Learnings in der Sozialen Arbeit dargestellt.
- Kapitel 2: Hier werden verschiedene Instrumente des E-Learnings, die sich für den Aufbau eines "virtual class-room" eignen, vorgestellt und analysiert. Der Fokus liegt auf den kommunikativen, kooperativen und datenbezogenen Instrumenten, die im Rahmen der Sozialen Arbeit relevant sind.
- Kapitel 3: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Blended-Learning" und stellt verschiedene Handlungsmodelle vor. Die Relevanz dieser Modelle für die Soziale Arbeit wird diskutiert, und es werden die spezifischen Herausforderungen und Chancen des Blended-Learnings im sozialen Kontext betrachtet.
- Kapitel 4: Der vierte Teil der Arbeit widmet sich der Entwicklung eines angepassten Blended-Learning-Modells, das speziell für die Soziale Arbeit konzipiert ist. Es werden grundsätzliche Problematiken und notwendige Grundbedingungen für die Anwendung dieses Modells diskutiert.
Schlüsselwörter
E-Learning, Blended-Learning, Soziale Arbeit, Bildungsprogramme, Neue Medien, virtuelle Klassenräume, Inklusion, Gruppenarbeit, Lernprozesse, Modulsystem, Lernsystembezogene Module, Befähigungsmodule, Themenbezogene Module, Module für allgemeine Zwecke, Lernprozeßbegleiter
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen E-Learning und Blended-Learning?
E-Learning ist rein elektronisches Lernen, während Blended-Learning eine Kombination aus Präsenzveranstaltungen und computergestützten Lernphasen darstellt.
Warum ist E-Learning in der Sozialen Arbeit eine besondere Herausforderung?
Oft fehlen didaktische Konzepte für psychosoziale Hemmnisse, es mangelt an "computer literacy" bei Lehrenden oder die Zielgruppen sind für kommerzielle Anbieter unattraktiv.
Welche Instrumente werden im "virtual classroom" genutzt?
Dazu gehören kommunikationsbezogene Tools (Foren, Chats, Videokonferenzen) sowie kooperationsbezogene Instrumente (File-Sharing, Blogs, Wikis).
Was ist das Ziel des in der Arbeit entwickelten Modells?
Es wurde ein modular aufgebautes Blended-Learning-Modell auf gruppenpädagogischer Grundlage entwickelt, das speziell auf die Bedürfnisse der Sozialen Arbeit zugeschnitten ist.
Welche Rolle spielt der Lernprozessbegleiter?
In gruppenpädagogischen Zusammenhängen ist der Anleiter entscheidend für die Steuerung der Online-Phasen und die Unterstützung der Interaktion zwischen den Teilnehmern.
- Quote paper
- Uwe Janatzek (Author), 2006, Bildungsprogramme mit neuen Medien in der Sozialen Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/57798