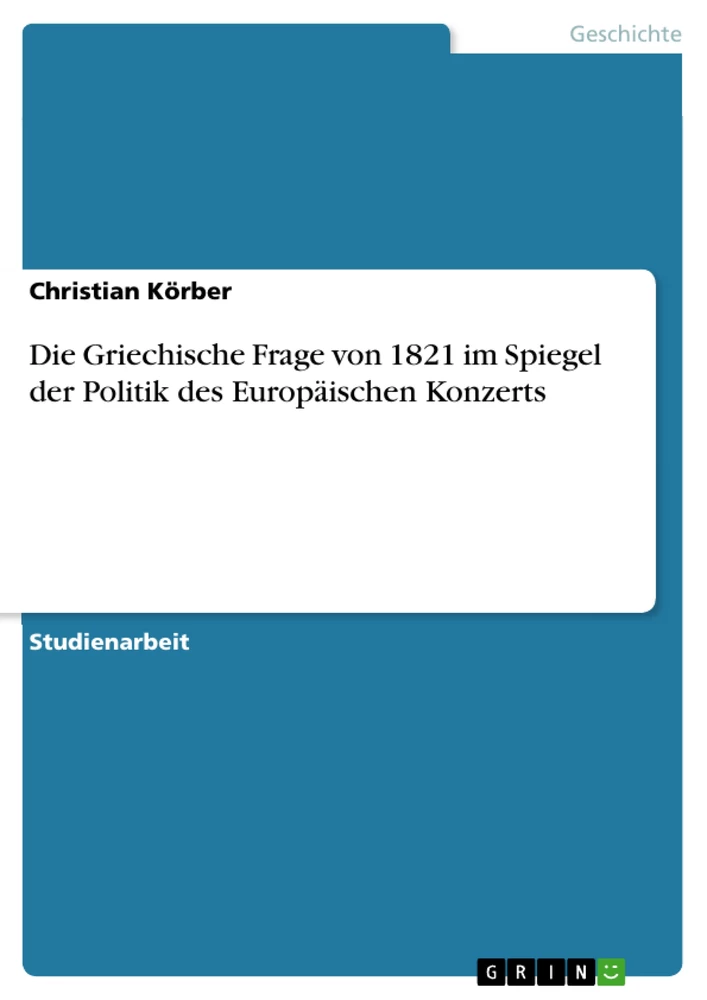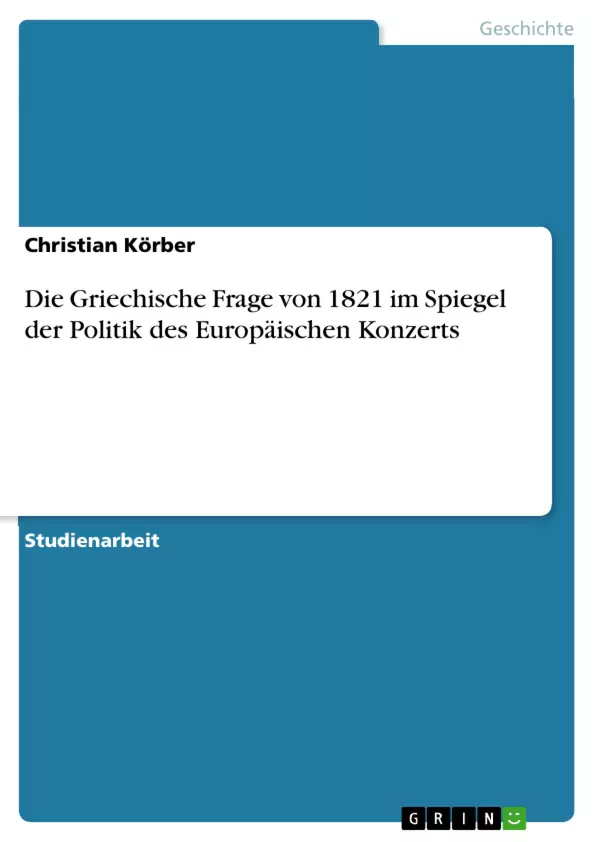Im Juli 1821, wenige Monate nachdem in der Ägäis und auf der Peloponnes der griechische Aufstand begonnen hatte im Versuch, die Separation vom Osmanischen Reich und damit die Erlangung der staatlichen Unabhängigkeit zu unternehmen, konstatierte die im Königreich Bayern ansässige Erlanger Realzeitung, ein offenes Sprachrohr für die damals im europäischen Raum weit verbreiteten philhellenistischen Strömungen, dass „der Aufstand der Griechen […] das wichtigste Ereignis dieses Jahrhunderts werden […] kann. Sein Einfluß auf die europäische Politik ist nicht zu verkennen.“. Auch wenn die Griechische Frage des dritten Jahrzehnts des 19. Jahrhunderts zweifelsohne nicht zum wichtigsten europäischen Ereignis jenes Jahrhunderts avancierte, so kann dennoch davon ausgegangen werden, dass sie für die weiteren politischen Entwicklungen in Europa folgenreich war. Als ein Jahrzehnt später ein formal souveräner griechischer Nationalstaat etabliert worden war, hatte sich die politische Landkarte Europas verändert. Ein, wenn auch territorial eng gefasster, griechischer Staat hatte einen Riss in das ohnehin fragile Herrschaftskorsett des Osmanischen Reiches gezogen. Doch nicht nur für die Politik der Hohen Pforte bedeutete die Loslösung Griechenlands eine folgenschwere Veränderung. Vielmehr war Südosteuropa in das Zentrum der Aufmerksamkeit der europäischen Großmächte gerückt, sahen sie sich doch in der Folgezeit als Mediatoren der politischen Verhältnisse an dieser europäischen geographischen Peripherie, einem Raum, der über Jahrhunderte unter der Herrschaft des Sultanats und unter muslimischer Kulturprägung gestanden hatte und immer noch stand. Doch dieser territorial weit gefasste Reichsverbund mit absolutistischem, theologisch abgeleitetem Herrschaftsanspruch war den Herausforderungen der Zeit nicht mehr gewachsen und befand sich bereits seit Mitte des 18. Jahrhunderts in einem schleichenden, kontinuierlichen Niedergang. Das sich langsam daraus entwickelnde politische Vakuum trat im Laufe des folgenden Jahrhunderts immer offener zutage und wurde von verschiedenen politischen Akteuren ausgefüllt, sowohl seitens gesellschaftlich-kulturell erwachsender und sich politisch manifestierender Kräfte, wie sie die aufkommende Strömung des Nationalismus am treffendsten und signifikantesten repräsentiert, als auch von etablierten politischen Akteuren, denen in dominanter Weise die Mächte des Europäischen Konzertes vorstanden. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ursachen, Ausbruch und Verlauf des griechischen Aufstandes von 1821
- Das Europäische Konzert und dessen Konfliktpotentiale — Außenpolitik unter dem Zeichen der Wiener Ordnung
- Die außenpolitischen Entwicklungen zwischen Wien und Verona
- Die geostrategischen Interessen der Mächte
- Großbritannien: Europäisches Gleichgewicht und Handel
- Russland: Territoriale Expansion
- Frankreich: Revision der Wiener Ordnung
- Österreich: Aufrechterhaltung des Metternich'schen Systems
- Preußen: Peripheres Interesse
- Das Osmanische Reich: Im Ringen um den Machterhalt
- Zwischen Staatsräson und Solidarität – Das außenpolitische Vorgehen der europäischen Großmächte in der Griechischen Frage
- Fazit: Das „Resultat Griechenland“: Die Auswirkungen der Konfliktlösung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Griechische Frage des Jahres 1821 im Kontext der europäischen Großmachtdiplomatie. Ziel ist es, die Auswirkungen des griechischen Unabhängigkeitskampfes auf die Beziehungen der europäischen Mächte und die Veränderungen der europäischen Ordnung aufzuzeigen. Dabei soll insbesondere geklärt werden, inwiefern die Griechische Frage die Bestimmungen des Wiener Kongresses beeinflusste und ob es zu einer ideologischen Blockbildung zwischen liberalen und konservativen Politiken kam.
- Die Ursachen und der Verlauf des griechischen Aufstandes von 1821
- Die geostrategischen Interessen der europäischen Großmächte im südosteuropäischen Raum
- Das Zusammenwirken der Großmächte in der Griechischen Frage
- Die Auswirkungen der Konfliktlösung auf die politische Landkarte Europas
- Das Verhältnis von interessenorientierter Machtpolitik und ideologischen Handlungsvorgaben in der europäischen Großmachtdiplomatie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Darstellung der Ereignisse des griechischen Unabhängigkeitskampfes und beleuchtet die Ursachen, die zum Ausbruch des Aufstandes führten. Im Anschluss werden die Interessen und Machtkonstellationen der Großmächte Großbritannien, Russland, Frankreich, Österreich, Preußen und dem Osmanischen Reich im südosteuropäischen Raum herausgearbeitet und im Kontext der Wiener Ordnung analysiert. Hierbei werden die geostrategischen Interessen der einzelnen Mächte sowie die Auswirkungen der Wiener Ordnung auf die internationale Politik in den Vordergrund gestellt. Die Arbeit setzt sich sodann mit dem direkten Einfluss der Großmächte auf die Griechische Frage auseinander und untersucht, wie die europäischen Mächte auf den Konflikt reagierten und ihre Interessen in diesem Kontext durchsetzten. Dabei werden die verschiedenen Akteure in ihrer Handlungsweise beleuchtet, um die Auswirkungen ihrer Politik auf die Entwicklungen in Griechenland aufzuzeigen.
Schlüsselwörter
Die Griechische Frage, Europäisches Konzert, Wiener Ordnung, Großmachtdiplomatie, geostrategische Interessen, Nationalismus, Philhellenismus, Unabhängigkeitskampf, Osmanisches Reich, Südosteuropa, Staatsräson, Solidarität, Interessenpolitik, Ideologie, Machtpolitik, Konfliktlösung, Einfluss, Veränderungen, Politik, Geschichte.
- Quote paper
- Christian Körber (Author), 2005, Die Griechische Frage von 1821 im Spiegel der Politik des Europäischen Konzerts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/57851