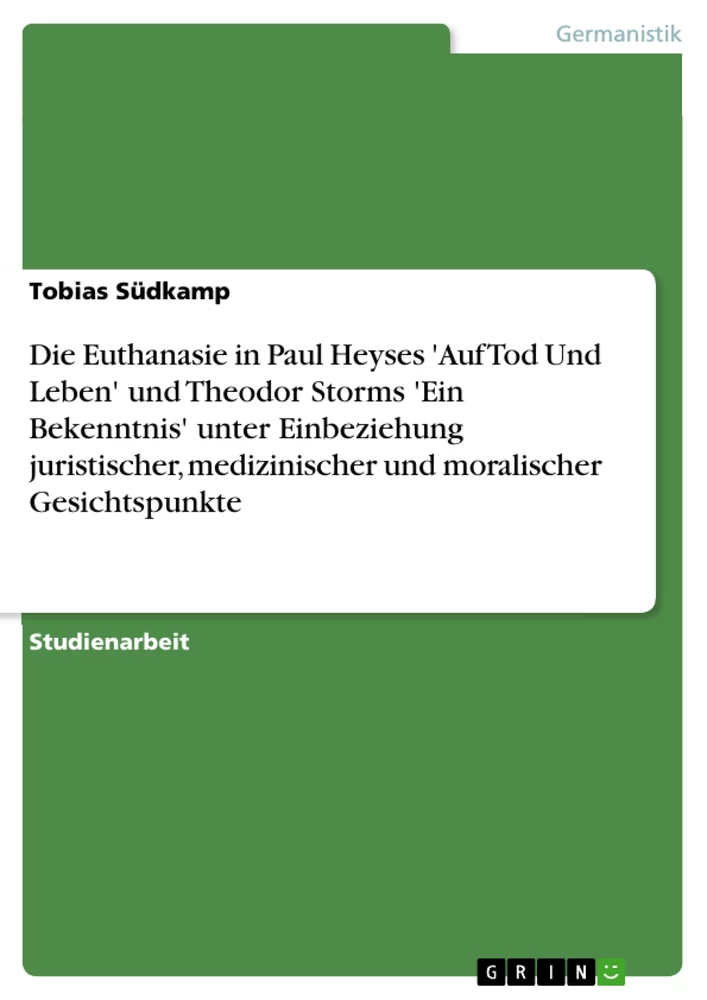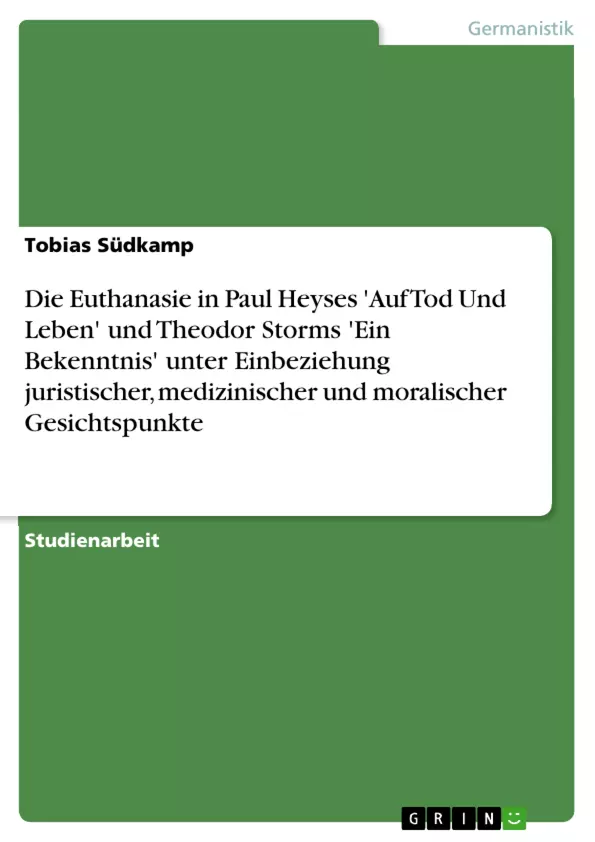Eine unheilbare Erkrankung dieses Menschen, - des Lebenspartners - ist es, die den Liebenden zu einer scheinbar widersinnigen Verhaltensweise treibt. Den überaus qualvollen Tod vor Augen, hat der Leidende nur noch den einen Wunsch der Erlösung von seinen Schmerzen im Sinn. Als "Tötungauf Verlangen"wird dieser Sachverhalt in der Fachsprache der Jurisdiktion nüchtern bezeichnet. -Doch welche emotionalen Gegensätze tun sich für den um die Tötung angeflehten Partner auf, gesetzt dem Fall, er verwirklicht den an ihn herangetragenen Wunsch nach Tötung? - Auf den ersten Blick wohl ein Anspruch, der überfordernd zu sein scheint. Betrachtet man die Sache jedoch aus dem Blickwinkel der leidenden Person, ergibt sich ein gänzlich anderes Bild, welches sich nachvollziehen läßt. Der den Tod wünschende Mensch wird sicherlich -solange im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte- diese Überlegung wohl durchdacht haben. Er wird vor dem Hintergrund des Todes abgewägt haben, was ihm noch bevorsteht, welche Schmerzen noch zu erleiden sein werden, ob man jemals wieder ein vollständiges Mitglied innerhalb der Familie oder der Gesellschaft sein kann, ob in der Zukunft noch Perspektiven zu finden sind, oder ob noch Hoffnung auf Heilung, oder bestenfalls auf Linderung der Krankheit besteht? - Kurzum: Welchen Nutzen hat das Dasein in der derzeitigen, aussichtslosen Form für die Menschen, insbesondere für die, die man liebt und nicht zuletzt auch für sich selbst? Um Sterbehilfe handelt es sich in den Fällen der beiden zur Untersuchung stehenden Novellen von Paul Heyse und Theodor Storm. ("Auf Tod und Leben" 1886 & "Ein Bekenntnis" 1887) In Heyses Novelle "Auf Tod und Leben" verlangt die unheilbar erkrankte Ehefrau eines Offiziers die Tötung durch ihren Gatten mittels einer Überdosis Morphium, die sie , bereitgestellt von ihrem Mann, selbstständig einnimmt.
In Storms Novelle "Ein Bekenntnis" ist es ein Gynäkologe, der nach eindeutiger Diagnose eines Gebärmutterkarzinoms seine unheilbar krank erscheinende Gattin auf deren Verlangen hin mit der erlösenden Dosis Gift versieht und somit vor unsäglichen Schmerzen bewahren will. Aus juristischer Sicht muß der Straftatbestand der "Tötung auf Verlangen" (§ 216 Reichstrafgesetzbuch) geprüft werden. Medizinisch muß vor allen Dingen sichergestellt sein, daß eine Heilung der Krankheiten nach dem aktuellen Wissenstand der Forschung zum Zeitpunkt der Tat ausgeschlossen werden konnte. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Definitionen für EUTHANASIE
- 2. Hinführung
- 3. Juristische Beurteilung
- 3.1. Darstellung der Sachverhalte aus den Novellen
- 3.1.1. Paul Heyse: Auf Tod und Leben. 1886
- 3.1.2. Theodor Storm: Ein Bekenntnis. 1887
- 3.2. Entwicklung des § 216 Tötung auf Verlangen
- 3.3. Juristische Interpretation
- 3.3.1. Die Tathandlung des Offiziers Rüdiger (Heyse, 1886)
- 3.3.2. Die Tathandlung des Dr. med. Franz Jebe (Storm, 1887)
- 3.1. Darstellung der Sachverhalte aus den Novellen
- 4. Die Krankheitsbilder der Opfer
- 4.1. Das rheumatische Fieber der Marie (Heyse)
- 4.2. Die bewußte Wahl der unheilbaren Krankheit in "Auf Tod und Leben"
- 4.3. Das Uteruskarzinom der Elsi (Storm)
- 4.4. Die Funktion der Krebserkrankung in "Ein Bekenntnis"
- 5. Die moralische Betrachtung der Novellen
- 5.1. Die Schuldfrage aus Sicht des Täters und die Wahl der Buße bei Rüdiger
- 5.2. Die Schuld und die Wahl der Buße des Dr. Jebe
- 6. Schlußbetrachtung und aktueller zeitlicher Bezug
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den interdisziplinären Diskurs um Euthanasie anhand der Novellen "Auf Tod und Leben" von Paul Heyse und "Ein Bekenntnis" von Theodor Storm. Ziel ist es, die juristischen, medizinischen und moralischen Aspekte der in den Novellen dargestellten Tötungsdelikte zu analysieren und in einen zeitgenössischen Kontext zu stellen.
- Juristische Bewertung der Handlungsweisen in den Novellen im Kontext des § 216 StGB.
- Analyse der Krankheitsbilder der Opfer und deren Bedeutung für die Handlung.
- Moralische Betrachtung der Schuldfrage und der Wahl der Buße der Täter.
- Interdisziplinäre Auseinandersetzung mit dem Thema Euthanasie.
- Vergleich der beiden Novellen und deren unterschiedlicher Schwerpunktsetzung.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Definitionen für EUTHANASIE: Dieses Kapitel liefert eine präzise Definition des Begriffs Euthanasie, unterscheidet zwischen aktiver und passiver Sterbehilfe und beleuchtet die juristischen Implikationen im Kontext des Tötungsdelikts (§ 216 StGB). Es verweist auf unterschiedliche fachsprachliche Definitionen und betont die Ambivalenz des Begriffs im historischen Kontext.
2. Hinführung: Die Hinführung stellt die zentrale Frage nach den Beweggründen für Euthanasie in den Mittelpunkt. Sie skizziert die emotionale Belastung der Beteiligten und betont die Perspektive des leidenden Menschen, der angesichts einer unheilbaren Erkrankung eine bewusste Entscheidung für den Tod trifft. Die Überlegungen des Sterbenden bezüglich Schmerz, Zukunftsperspektiven und gesellschaftlicher Integration bilden den Fokus dieses Kapitels.
3. Juristische Beurteilung: Dieses Kapitel analysiert die juristischen Aspekte der in den Novellen dargestellten Fälle. Es untersucht die Tathandlungen des Offiziers Rüdiger (Heyse) und Dr. Jebe (Storm) im Lichte des § 216 StGB, beleuchtet die historische Entwicklung des Paragraphen und diskutiert die juristische Interpretation der jeweiligen Fälle. Der Fokus liegt auf der Unterscheidung zwischen Tötung auf Verlangen und Beihilfe zur Selbsttötung sowie den damit verbundenen rechtlichen Schwierigkeiten.
4. Die Krankheitsbilder der Opfer: Hier werden die Krankheiten der Opfer – das rheumatische Fieber von Marie (Heyse) und das Uteruskarzinom von Elsi (Storm) – detailliert beschrieben und ihre Bedeutung für die Handlung der jeweiligen Novellen herausgearbeitet. Das Kapitel untersucht, wie die spezifischen Krankheitsbilder die Entscheidungen der Protagonisten beeinflussen und die moralische und juristische Bewertung der Handlungen kontextualisieren. Es beleuchtet die Frage nach der „bewussten Wahl“ einer unheilbaren Krankheit.
5. Die moralische Betrachtung der Novellen: Der Schwerpunkt liegt auf der ethischen Bewertung der Handlungen der Täter. Das Kapitel untersucht die Schuldfrage aus der Perspektive von Rüdiger und Dr. Jebe, analysiert ihre Motive und die von ihnen gewählten Wege der Buße. Es hinterfragt die moralischen Konflikte und die Ambivalenz der Entscheidungen vor dem Hintergrund der damaligen gesellschaftlichen Normen.
Schlüsselwörter
Euthanasie, Sterbehilfe, Tötung auf Verlangen, § 216 StGB, Paul Heyse, Theodor Storm, "Auf Tod und Leben", "Ein Bekenntnis", Juristische Beurteilung, Medizinische Aspekte, Moralische Bewertung, Schuld, Buße, unheilbare Krankheit.
Häufig gestellte Fragen zu "Euthanasie in den Novellen von Heyse und Storm"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den interdisziplinären Diskurs um Euthanasie anhand der Novellen "Auf Tod und Leben" von Paul Heyse und "Ein Bekenntnis" von Theodor Storm. Sie analysiert die juristischen, medizinischen und moralischen Aspekte der dargestellten Tötungsdelikte und setzt diese in einen zeitgenössischen Kontext.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt die juristische Bewertung der Handlungen im Kontext des § 216 StGB, analysiert die Krankheitsbilder der Opfer und deren Bedeutung für die Handlung, betrachtet die moralische Schuldfrage und die Buße der Täter, setzt sich interdisziplinär mit dem Thema Euthanasie auseinander und vergleicht die beiden Novellen und deren unterschiedliche Schwerpunkte.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: 1. Definitionen für EUTHANASIE (präzise Definition von Euthanasie, Unterscheidung aktiver/passiver Sterbehilfe, juristische Implikationen); 2. Hinführung (Beweggründe für Euthanasie, emotionale Belastung, Perspektive des Leidenden); 3. Juristische Beurteilung (Analyse der Tathandlungen in den Novellen im Lichte des § 216 StGB, historische Entwicklung des Paragraphen, juristische Interpretation); 4. Die Krankheitsbilder der Opfer (detaillierte Beschreibung der Krankheiten, deren Bedeutung für die Handlung, Einfluss auf Entscheidungen und Bewertung); 5. Die moralische Betrachtung der Novellen (ethische Bewertung der Handlungen, Schuldfrage, Motive und Buße der Täter, moralische Konflikte); 6. Schlußbetrachtung und aktueller zeitlicher Bezug (Zusammenfassung und Einordnung in den aktuellen Kontext).
Welche Novellen werden untersucht?
Die Arbeit analysiert die Novellen "Auf Tod und Leben" von Paul Heyse (1886) und "Ein Bekenntnis" von Theodor Storm (1887).
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Euthanasie, Sterbehilfe, Tötung auf Verlangen, § 216 StGB, Paul Heyse, Theodor Storm, "Auf Tod und Leben", "Ein Bekenntnis", Juristische Beurteilung, Medizinische Aspekte, Moralische Bewertung, Schuld, Buße, unheilbare Krankheit.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die juristischen, medizinischen und moralischen Aspekte der in den Novellen dargestellten Tötungsdelikte zu analysieren und in einen zeitgenössischen Kontext zu stellen. Sie untersucht den interdisziplinären Diskurs um Euthanasie anhand literarischer Beispiele.
- Citation du texte
- Tobias Südkamp (Auteur), 2002, Die Euthanasie in Paul Heyses 'Auf Tod Und Leben' und Theodor Storms 'Ein Bekenntnis' unter Einbeziehung juristischer, medizinischer und moralischer Gesichtspunkte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/57957