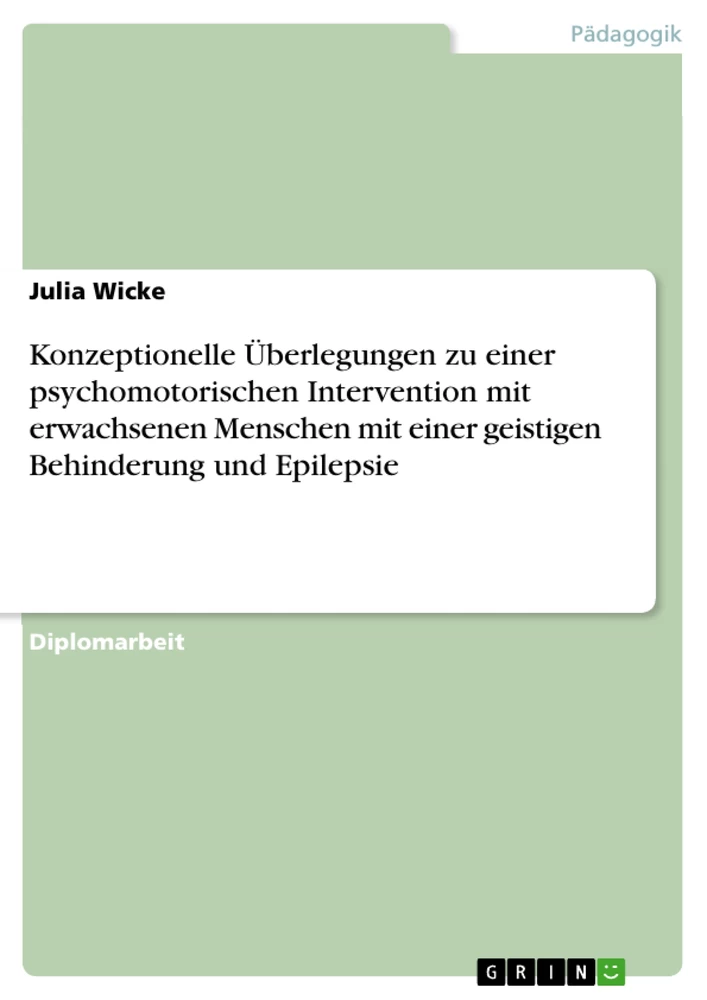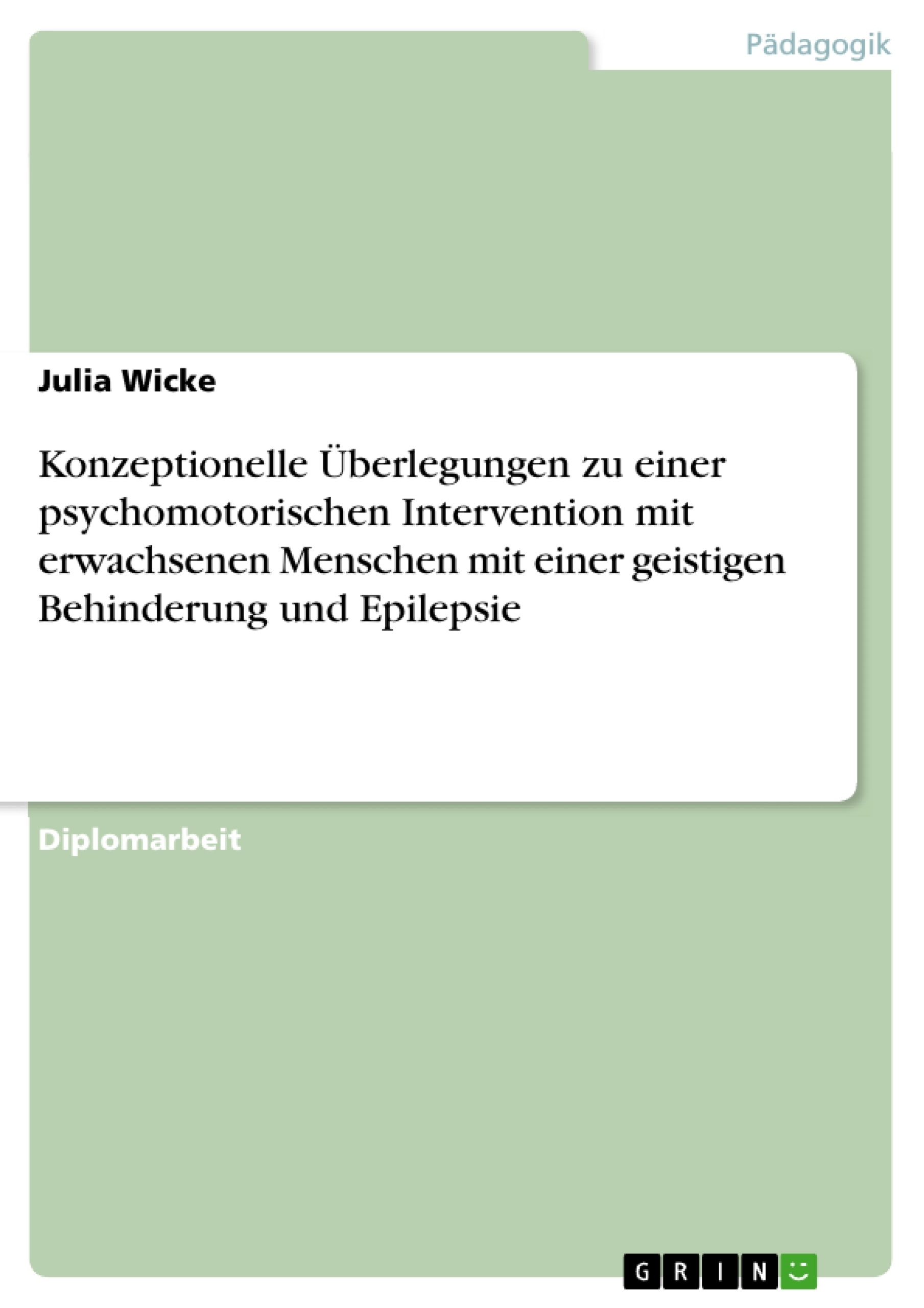Die Krankheit Epilepsie in ihren verschiedenen Ausprägungen gehört in unserer Gesellschaft zu den sozial diskriminierten Krankheiten. In der heutigen Zeit wird Epileptikern zwar keine dämonische Besessenheit mehr nachgesagt,es wird ihnen jedoch noch immer mit Unsicherheit und vielen Vorurteilen begegnet.
Auch Menschen mit einer geistigen Behinderung wird oft mit Diskriminierung oder Ablehnung begegnet.Eine geistige Behinderung stellt trotz zahlreicher Aufklärungsversuche durch Selbsthilfeorganisationen und Interessenvertretungen noch immer eine Abweichung von den Erwartungen der Gesellschaft dar, der ein negativer Wert zugeschrieben wird. So werden vor allem Menschen mit schwerer Behinderung in vielfacher Hinsicht in der Gestaltung ihres Lebens benachteiligt.Sie sind aufgrund ihrer geistigen Behinderung meist lebenslang in der Verwirklichung ihrer Wünsche und Lebensziele auf Unterstützung angewiesen.Für viele erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung sind die Möglichkeiten zur Weiterentwicklung ihrer Fähigkeiten sehr eingeschränkt.Sie sind auf Angebote spezieller Einrichtungen und bei deren Wahrnehmung auf Unterstützung, Assistenz, bzw. Begleitung angewiesen.Menschen mit geistiger Behinderung sind häufiger als Menschen ohne Behinderung von einer Epilepsie betroffen.Eine Epilepsie bedeutet für einen Menschen mit geistiger Behinderung zusätzliche Einschränkungen und Probleme.Neben dem Unterstützungsbedarf durch die geistige Behinderung und der damit einhergehenden sozialen Abwertung wird er durch die Epilepsie im Alltag und gesundheitlich eingeschränkt sowie mit verschiedenen psychosozialen Problemen konfrontiert.Sogar Fachkräfte aus dem Bereich der Heil- bzw. Geistigbehindertenpädagogik stehen Menschen mit Epilepsie häufig unsicher oder mit Vorurteilen gegenüber, was den Betroffenen die Teilnahme an speziellen Angeboten noch zusätzlich erschwert.
Auch erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung müssen Möglichkeiten zur Weiterentwicklung ihrer Kompetenzen geboten werden. Eine Epilepsie sollte hierbei keine zusätzliche Einschränkung bedeuten. In der vorliegenden Arbeit soll aufgezeigt werden, dass im Konzept der Psychomotorik auch diesem Personenkreis verschiedene Möglichkeiten geboten werden können. Vor dem Hintergrund der Lebensrealität der Menschen mit Epilepsie und geistiger Behinderung soll geklärt werden, ob ihre Teilnahme an einer psychomotorischen Intervention besondere Rahmenbedingungen erfordert und was zu deren Umsetzung erforderlich ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Einführung in die Thematik
- 1.2 Gang der Arbeit
- 1.3 Anmerkungen
- 2. Die Psychomotorik
- 2.1 Erläuterung der verschiedenen Begrifflichkeiten
- 2.1.1 Die Anfänge der Psychomotorik in Deutschland - die psychomotorische Übungsbehandlung
- 2.1.2 Das Konzept der Motologie und die Abgrenzung der Motopädagogik zur Mototherapie
- 2.2 Das Menschenbild in der Psychomotorik
- 2.2.1 Das humanistische Menschenbild der Psychomotorik
- 2.2.2 Das Konzept des Konstruktivismus und dessen Relevanz für die Psychomotorik
- 2.2.3 Das Konzept der Salutogenese in der Psychomotorik
- 2.2.3.1 Gesundheit und Krankheit in der Salutogenese
- 2.2.3.2 Die Widerstandsressourcen des Menschen
- 2.2.3.3 Das Kohärenzgefühl
- 2.2.3.4 Kritik am Modell der Salutogenese
- 2.3 Das Selbstkonzept
- 2.3.1 Das Selbstkonzept nach Zimmer
- 2.3.2 Die Selbstwirksamkeit nach Bandura
- 2.3.3 Die erlernte Hilflosigkeit nach Seligmann
- 2.3.4 Die Entwicklung des Selbstkonzepts nach Epstein
- 2.3.5 Körpererfahrung als Teil des Selbstkonzepts
- 2.4 Ziele und Inhalte der Psychomotorik
- 2.4.1 Die Ich-Kompetenz
- 2.4.2 Die Sach-Kompetenz
- 2.4.3 Die Sozial-Kompetenz
- 2.5 Möglichkeiten der Gestaltung von Psychomotorikangeboten
- 2.6 Psychomotorik für erwachsene Menschen
- 2.6.1 Entwicklungstheorien in der Psychomotorik für erwachsene Menschen
- 2.6.2 Die Life-Span-Perspektive
- 2.6.3 Die Angewandte Motologie des Erwachsenenalters
- 2.6.3.1 Entwicklung mit und im Kontext - die Development Systems Theory nach Ford / Lerner
- 2.6.3.2 Entwicklung zwischen Identität und Sozialität nach Kegan
- 2.6.3.3 Der Kontrolltheoretische Ansatz nach Flammer
- 2.6.3.4 Die Entwicklungsthemen nach Havighurst und Thomae
- 2.6.3.5 Die Planung der Intervention und ihre Ziele
- 2.6.4 Der systemisch-ökologische Ansatz nach Bronfenbrenner in der Psychomotorik
- 2.1 Erläuterung der verschiedenen Begrifflichkeiten
- 3. Epilepsie
- 3.1 Der Begriff der Epilepsie von der Antike bis heute
- 3.2 Die Abgrenzung der Epilepsie vom epileptischen Anfall
- 3.3 Die Klassifikation von Epilepsien
- 3.3.1 Die Unterscheidung der Epilepsien nach ihrer Ursache
- 3.3.2 Die Unterscheidung der Epilepsien nach Anfallsbildern
- 3.3.2.1 Die generalisierten epileptischen Anfallsformen
- 3.3.2.2 Die fokalen epileptischen Anfallsformen
- 3.3.2.3 Die Aura
- 3.4 Der Status epilepticus
- 3.5 Anfallsauslösende Faktoren
- 3.6 Die Behandlungsmethoden bei Epilepsie
- 3.6.1 Die Pharmakotherapie
- 3.6.1.1 Die Mono- und die Kombinationstherapie
- 3.6.1.2 Die Antiepileptika
- 3.6.2 Alternative Therapiemethoden
- 3.6.2.1 Die chirurgische Epilepsietherapie
- 3.6.2.2 Die Vagus-Nerv-Stimulation
- 3.6.2.3 Die ketogene Diät
- 3.6.1 Die Pharmakotherapie
- 3.7 Die (psycho-)soziale Situation von Menschen mit Epilepsien
- 3.7.1 Überbehütung als Auslöser psychosozialer Probleme
- 3.7.2 Überforderung als Auslöser psychosozialer Probleme
- 3.8 Kognitive Beeinträchtigungen bei Epilepsie
- 3.9 Psychische Störungen bei Epilepsie
- 3.10 Epilepsie und Bewegung
- 4. Geistige Behinderung
- 4.1 Die Bedeutung der Heilpädagogik für die Psychomotorik
- 4.2 Das Verständnis von Behinderung
- 4.3 Die Entstehung der geistigen Behinderung in der Interaktion nach Speck
- 4.4 Psychomotorik mit erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung
- 4.4.1 Das Empowerment - Konzept und dessen Bedeutung für die Psychomotorik
- 4.4.2 Das Konzept der Selbstbestimmung und der Normalisierung sowie deren Bedeutung für die Psychomotorik
- 4.5 Die Veränderung der Entwicklungstheorien bei Menschen mit geistiger Behinderung
- 4.6 Schwerpunkte und Ziele der Psychomotorik für erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung
- 4.7 Empfehlungen zur Methodik in der Psychomotorik für erwachsene Menschen mit einer geistigen Behinderung
- 5. Fallbeispiel und konzeptionelle Überlegungen
- 5.1 Die Wohnsituation erwachsener Menschen mit geistiger Behinderung
- 5.2 Die Einrichtung
- 5.3 Rahmenbedingungen für Psychomotorik im Wohnhaus
- 5.3.1 Die Personalbedingungen
- 5.3.2 Die zeitliche Rahmengestaltung
- 5.3.3 Weitere Rahmenbedingungen für die Psychomotorik mit erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung in einer Wohneinrichtung
- 5.4 Fallbeispiel Herr K.
- 5.4.1 Biographische Hintergründe
- 5.4.2 Medizinische Hintergründe
- 5.4.3 Anfallsfrequenz
- 5.4.4 Weitere Informationen zur Person
- 5.4.5 Feststellung des Förderbedarfs von Herrn K.
- 5.4.6 Konkrete Vorschläge zur Förderung von Herrn K.
- 5.5 Fallbeispiel Frau S.
- 5.5.1 Biographische Hintergründe
- 5.5.2 Medizinische Hintergründe
- 5.5.3 Anfallsfrequenz
- 5.5.2 Weitere Informationen zur Person
- 5.5.5 Feststellung des Förderbedarfs von Frau S.
- 5.5.6 Konkrete Vorschläge für die Förderung von Frau S.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Konzeption einer psychomotorischen Intervention für erwachsene Menschen mit einer geistigen Behinderung und Epilepsie. Sie untersucht die spezifischen Herausforderungen, die diese Gruppe von Menschen im Kontext von Bewegung und Entwicklung besitzt.
- Das Menschenbild in der Psychomotorik und dessen Relevanz für die Zielgruppe
- Entwicklungstheorien im Kontext von geistiger Behinderung und Epilepsie
- Spezifische Ziele und Inhalte der Psychomotorik für die Zielgruppe
- Mögliche Rahmenbedingungen für eine psychomotorische Intervention in Wohneinrichtungen
- Die Entwicklung von konkreten Interventionsvorschlägen auf Basis von Fallbeispielen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die Einleitung führt in die Thematik ein und erläutert den Hintergrund der Arbeit. Sie skizziert die soziale Diskriminierung, der Menschen mit Epilepsie und geistiger Behinderung oft begegnen, sowie die besonderen Herausforderungen, die sich aus der Kombination dieser beiden Beeinträchtigungen ergeben.
- Kapitel 2: Dieses Kapitel behandelt das Feld der Psychomotorik und erläutert verschiedene Konzepte und Theorien, die für die Intervention relevant sind. Es beleuchtet das Menschenbild der Psychomotorik, das Selbstkonzept sowie verschiedene Entwicklungstheorien, die im Kontext des Erwachsenenalters bedeutsam sind.
- Kapitel 3: Das Kapitel widmet sich der Epilepsie und beschreibt die verschiedenen Ausprägungen und Erscheinungsformen der Krankheit. Es erläutert die Klassifikation von Epilepsien, die Behandlungsmethoden sowie die psycho-soziale Situation von Menschen mit Epilepsie.
- Kapitel 4: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Thema der geistigen Behinderung. Es betrachtet das Verständnis von Behinderung im Allgemeinen sowie die Entstehung geistiger Behinderung in der Interaktion. Darüber hinaus beleuchtet es das Empowerment-Konzept sowie die Bedeutung von Selbstbestimmung und Normalisierung für Menschen mit geistiger Behinderung.
- Kapitel 5: Das Kapitel präsentiert zwei Fallbeispiele und entwickelt auf dieser Grundlage konzeptionelle Überlegungen für eine psychomotorische Intervention. Es analysiert die individuellen Bedürfnisse der Probanden und entwickelt konkrete Vorschläge zur Förderung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen der Psychomotorik, geistigen Behinderung, Epilepsie, Entwicklungstheorien, Empowerment, Selbstbestimmung, Normalisierung und die Konzeption einer Intervention.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Psychomotorik im Kontext von Behinderung?
Ein ganzheitliches Konzept, das Bewegung und Psyche verbindet, um die Ich-, Sach- und Sozialkompetenz von Menschen zu fördern.
Welche Besonderheiten ergeben sich bei Menschen mit geistiger Behinderung und Epilepsie?
Betroffene leiden oft unter doppelter Diskriminierung, sozialer Abwertung und zusätzlichen gesundheitlichen Einschränkungen im Alltag.
Welche Rolle spielt das Empowerment-Konzept?
Es zielt darauf ab, die Selbstbestimmung und die eigenen Stärken der Betroffenen zu fördern, damit sie ihr Leben unabhängiger gestalten können.
Was ist das Modell der Salutogenese?
Ein Ansatz, der sich darauf konzentriert, was den Menschen gesund hält (Kohärenzgefühl und Widerstandsressourcen), anstatt nur die Krankheit zu betrachten.
Können Menschen mit Epilepsie an Sportangeboten teilnehmen?
Ja, unter Berücksichtigung spezifischer Rahmenbedingungen und anfallsauslösender Faktoren bietet die Psychomotorik hier wertvolle Möglichkeiten.
- Citation du texte
- Julia Wicke (Auteur), 2006, Konzeptionelle Überlegungen zu einer psychomotorischen Intervention mit erwachsenen Menschen mit einer geistigen Behinderung und Epilepsie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/57985