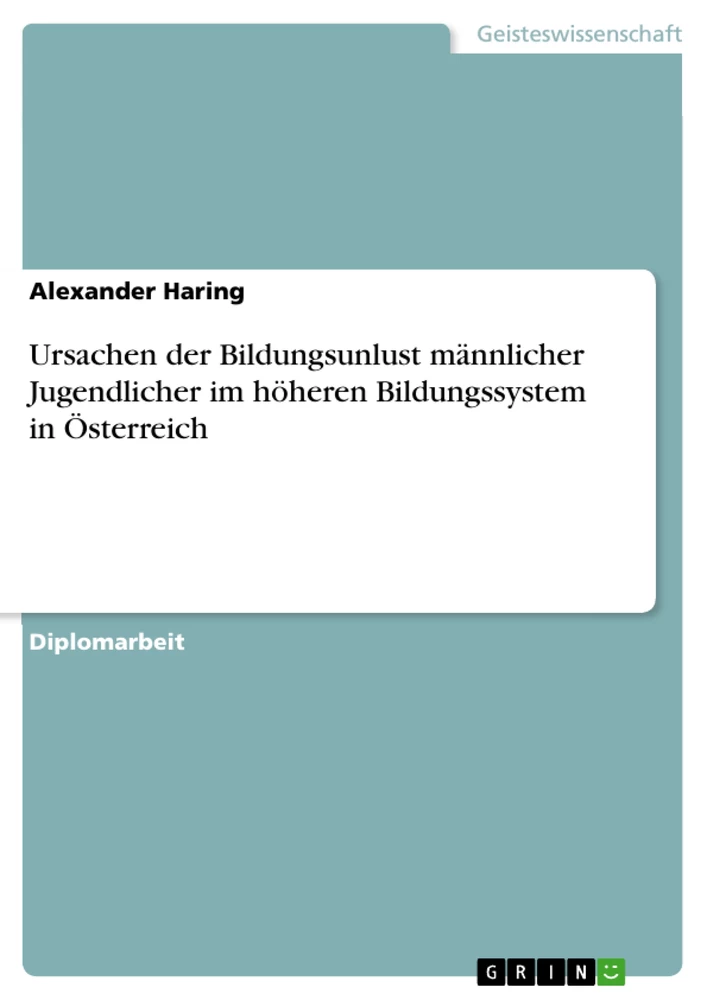Die vorliegende Diplomarbeit setzt sich mit dem Wandel der Geschlechterproportion an höheren österreichischen Schulen auseinander. Das Bildungsniveau der Frauen ist seit der Bildungsreform 1975 kontinuierlich gestiegen, im Gegensatz dazu ist das der Männer kontinuierlich gesunken. Seit Anfang der 1990er Jahre beträgt der Anteil männlicher Maturanten weniger als 50% und nimmt immer weiter ab. Im Jahr 2001 gab es überhaupt nur mehr 43% männliche Absolventen und das bei einer durchschnittlichen Bevölkerungsverteilung von ca. 48,7% weiblich und 51,3% männlich1. Im ersten Moment könnte angenommen werden, dass diese Entwicklung nur mit dem veränderten Bildungsverhalten der weiblichen Bevölkerung zusammenhängt. Selbstverständlich ist dies ein Aspekt der weit reichende Veränderungen in der österreichischen Bildungslandschaft mit sich gebracht hat, aber der sinkende Anteil der Buben kann nur zum Teil auf die wachsende Anzahl der Mädchen in den höheren Schulen zurückgeführt werden. Vielmehr steckt eine unterschiedliche Entwicklung des Bildungsverhaltens der Geschlechter dahinter. Entscheidungen, die ein solches Ergebnis hervorrufen, werden bereits in der Volksschule getroffen. So sind in den Hauptschulen deutlich weniger Mädchen als Burschen anzutreffen und in der AHS – Unterstufe ist es genau umgekehrt.
Inhaltsverzeichnis
- I. ABKÜRZUNGEN
- II. EINLEITUNG: PROBLEMSTELLUNG.
- III. THEORIEN UND STUDIEN.
- IV. HYPOTHESEN ÜBER DIE DETERMINANTEN DER UNTERREPRÄSENTATION VON JUNGEN
- A. HYPOTHESE 1: ZUNEHMENDER MANGEL AN MÄNNLICHEN BEZUGSPERSONEN
- B. HYPOTHESE 2: NEGATIVE EFFEKTE DER KOEDUKATION
- C. HYPOTHESE 3: UNABHÄNGIGKEIT.
- D. HYPOTHESE 4: BEFINDLICHKEIT.
- V. DAS ÖSTERREICHISCHE BILDUNGSSYSTEM.
- A. PRIMARBEREICH (ISCED 1)
- B. SEKUNDARBEREICH I (ISCED 2)
- C. SEKUNDARBEREICH II (ISCED 3).
- D. TERTIÄRBEREICH (ISCED 5 – 7).
- VI. STATISTISCHE DARSTELLUNG DER GESCHLECHTERPROPORTION IM ÖSTERREICHISCHEN SCHULSYSTEM...
- A. ZU DEN STATISTISCHEN DATEN
- B. NEGATIVE SCHULABSCHLÜSSE..
- C. GESCHLECHTERVERTEILUNG NACH SCHULFORMEN
- 1. Entwicklung von 1923 – 2002..
- 2. Beobachtung der AHS – Oberstufe.
- 3. Entwicklung der Geschlechterverteilung an Universitäten.
- D. ZEHNTE SCHULSTUFE
- E. ZWISCHENRESÜMEE.
- VII. SOZIOLOGISCHE UNTERSUCHUNG IN GRAZER SCHULEN
- A. FORSCHUNGSFELD
- B. METHODEN.
- 1. Fragebogen...
- C. DATENAUSWERTUNG..
- 1. Darstellung der Stichprobe.
- 2. Soziometrie
- 3. Faktorenanalyse -,,Zufriedenheit“.
- 4. Schulleistungen.......
- 5. Einfluss der elterlichen Berufe auf die schulische Bildung ihrer Kinder.
- 6. Hypothese 1: Zunehmender Mangel an männlichen Bezugspersonen.
- 7. Hypothese 2: Negative Effekte der Koedukation.
- 8. Hypothese 3: Unabhängigkeit von den Eltern.
- 9. Hypothese 4: Befindlichkeit....
- VIII. GESCHLECHTSSENSIBLER UNTERRICHT IN THEORIE UND PRAXIS....
- A. JUNGENARBEIT
- B. SCHULPROJEKTE.
- 1. Die KoKoKo Stunden im Wiener Gymnasium,,Bertha von Suttner\".
- 2. Hauptschulprojekt PAIS.
- 3. Projekt,, Mittelschule\", Schulverbund Anton-Krieger-Gasse.
- 4. Resümee.
- IX. ZUSAMMENFASSUNG UND DISKUSSION DER ERGEBNISSE
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit den Ursachen der Bildungs-Unlust männlicher Jugendlicher im österreichischen Bildungssystem. Ziel der Arbeit ist es, die Faktoren zu identifizieren, die zur Unterrepräsentation von Jungen im höheren Bildungssystem beitragen, und mögliche Lösungsansätze aufzuzeigen.
- Analyse der soziokulturellen und familiären Faktoren, die die Bildungsentscheidungen von Jungen beeinflussen
- Untersuchung der Auswirkungen des österreichischen Bildungssystems auf die Motivation und den Erfolg männlicher Schüler
- Bewertung von geschlechtersensiblen pädagogischen Ansätzen und Interventionsprogrammen zur Förderung der Bildungsbeteiligung von Jungen
- Diskussion der Rolle von Lehrkräften und Eltern bei der Unterstützung der Bildungsambitionen männlicher Jugendlicher
- Entwicklung von Empfehlungen für die Weiterentwicklung des österreichischen Bildungssystems im Hinblick auf eine geschlechtergerechtere Bildungslandschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Problemstellung und die Relevanz des Themas erläutert. Kapitel III widmet sich der theoretischen Einordnung der Thematik und präsentiert verschiedene Studien und Theorien zur Bildungsungleichheit und der Unterrepräsentation von Jungen im höheren Bildungssystem. Kapitel IV stellt Hypothesen über die Determinanten der Bildungs-Unlust männlicher Jugendlicher vor, wobei insbesondere die Rolle von männlichen Bezugspersonen, die Auswirkungen der Koedukation, die Bedeutung von Unabhängigkeit und die Befindlichkeit der Jugendlichen beleuchtet werden. Kapitel V gibt einen Überblick über das österreichische Bildungssystem, wobei die verschiedenen Bildungsstufen und Schulformen beschrieben werden. Kapitel VI präsentiert statistische Daten zur Geschlechterverteilung im österreichischen Schulsystem und analysiert die Entwicklung der Geschlechterproportion in den verschiedenen Schulformen. Kapitel VII beschreibt eine soziologische Untersuchung, die in Grazer Schulen durchgeführt wurde, und präsentiert die Ergebnisse der Datenauswertung, die den Einfluss verschiedener Faktoren auf die Bildungs-Unlust männlicher Jugendlicher untersucht. Kapitel VIII beschäftigt sich mit geschlechtersensiblen Unterrichtsformen in Theorie und Praxis und stellt verschiedene Schulprojekte und Interventionsprogramme vor, die die Bildungsbeteiligung von Jungen fördern sollen. Die Arbeit endet mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse und einer Diskussion der Schlussfolgerungen.
Schlüsselwörter
Bildungsungleichheit, Bildungs-Unlust, männliche Jugendlicher, österreichisches Bildungssystem, Koedukation, geschlechterssensibler Unterricht, Motivation, Schulsystem, soziokulturelle Faktoren, familiäre Faktoren, Interventionsprogramme, Forschungsergebnisse, empirische Daten.
Häufig gestellte Fragen
Warum gibt es eine Unterrepräsentation von Jungen in höheren Schulen?
Ursachen sind vielfältig, darunter der Mangel an männlichen Bezugspersonen, negative Effekte der Koedukation für Jungen und unterschiedliche Sozialisationsmuster.
Wie hat sich die Geschlechterproportion bei der Matura verändert?
Seit den 1990er Jahren liegt der Anteil männlicher Maturanten in Österreich unter 50% und sank bis 2001 auf etwa 43%.
Welchen Einfluss hat die Koedukation auf Jungen?
Einige Hypothesen besagen, dass Jungen in koedukativen Systemen eher zu Bildungsunlust neigen, da der Unterricht oft stärker auf weibliche Lernstile ausgerichtet ist.
Spielt der Mangel an männlichen Lehrkräften eine Rolle?
Ja, das Fehlen männlicher Rollenvorbilder im Primar- und Sekundarbereich wird als ein Faktor für die geringere Bildungsmotivation von Jungen diskutiert.
Was kann geschlechtersensibler Unterricht bewirken?
Er zielt darauf ab, sowohl Jungen als auch Mädchen in ihren spezifischen Bedürfnissen abzuholen und so die Bildungsbeteiligung und den Erfolg zu steigern.
- Citation du texte
- Mag. Alexander Haring (Auteur), 2005, Ursachen der Bildungsunlust männlicher Jugendlicher im höheren Bildungssystem in Österreich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/58015