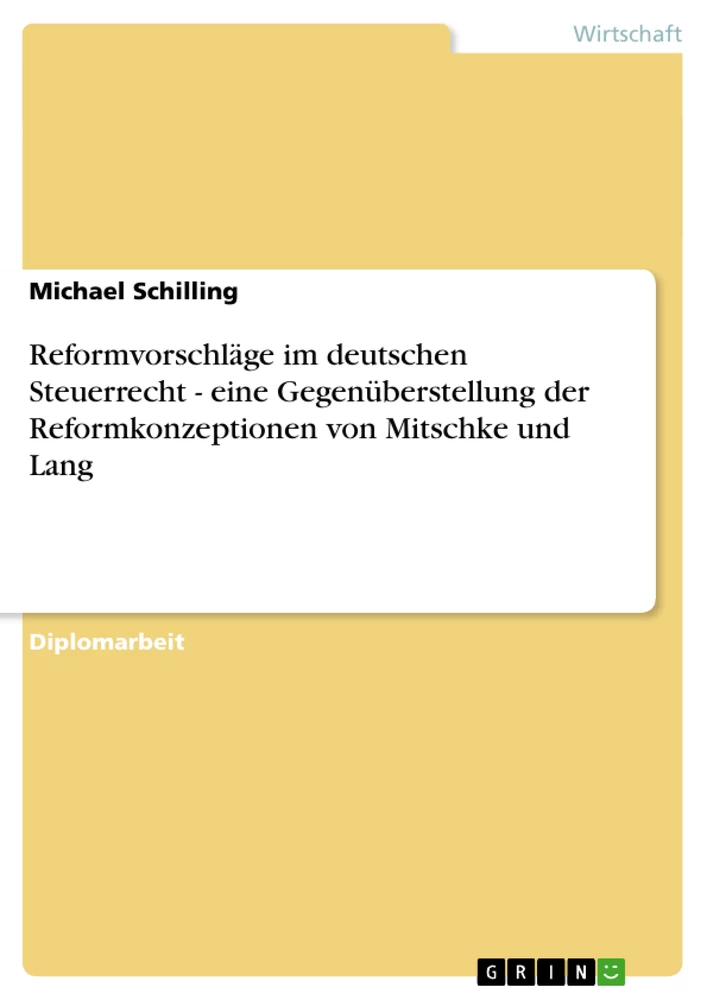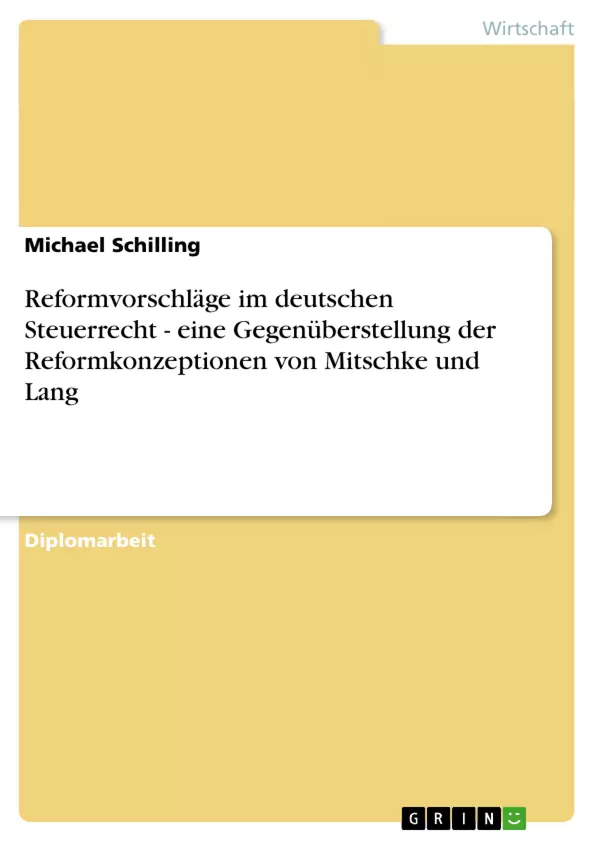Der Unmut über das deutsche Einkommensteuerrecht ist groß. Dies ist zum gewissen Maße vollkommen berechtigt. Die Hauptkritikpunkte an dem deutschen Steuersystem sind die komplexen Vorschriften, die fehlende Gerechtigkeit und der Anteil der Steuerpolitik an fehlendem Wachstum sowie der schlechten Arbeitsmarktsituation. Letzterer Kritikpunkt ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass Deutschland im internationalen Vergleich als ein Hochsteuerland gilt. Dass sich das deutsche Steuerrecht zu einem komplexen System entwickelt hat, ist unter anderem auf die Entstehungsgeschichte Deutschlands zurückzuführen. Nach Beendigung des zweiten Weltkrieges drängten die Alliierten auf hohe Steuersätze. So war der Gesetzgeber von Anfang an gezwungen, die Steuerbemessungs-grundlagen durch Ausnahmetatbestände zu verringern, um die Abgabenlast nicht ausufern zu lassen. Die Komplexität erhöhte sich zudem durch Lobbyismusaktivitäten. Lobbyisten versuchen durch Bündelung der Interessen eine wirkungsvolle Vertretung ihrer Mitglieder in der Öffentlichkeit bzw. gegenüber den Repräsentanten der Exekutive und Legislative zu erreichen. Dadurch wurden weitere Ausnahmetatbestände geschaffen, die dazu führten, dass das gleichheitsgerechte Belastungsprinzip der Besteuerung nach dem Leistungsfähigkeitsprinzip umgangen wurde. Weiterhin fiel der Einkommensteuer im Laufe der Zeit die Aufgabe zu, ungerechte Marktergebnisse durch Lenkungs- und Befreiungstatbestände zu korrigieren. Als Instrumente fungierten eine Vielzahl von Abzugsmöglichkeiten, sowie eine steile Progression. Durch die Vielzahl von Einzelbestimmungen, es existieren im deutschen Steuerrecht über 100 Gesetze, 96.000 Verwaltungsvorschriften, 5.000 BMF-Schreiben und 185 verschiedene Steuerformulare, ist das System der Besteuerung unübersichtlich geworden, so dass die anvisierte Gerechtigkeit nicht erreicht werden kann. Als dritter Hauptkritikpunkt am deutschen Steuersystem ist aufzuführen, dass Deutschland im internationalen Steuerwettbewerb als Verlierer aus diesem hervorgeht. Sowohl für inländische, als auch ausländische Investoren ist der Standort Deutschland bei der Betrachtung der steuerlichen Belastung von Erträgen unattraktiv. So steht der Standort Deutschland mit seinen Körperschaftssteuersatz von 25 %, vor allem mit Blick Richtung Osten, unter Zugzwang, da die dortigen Körperschaftssteuersätze weit unter denen der deutschen Belastung liegen. So hat z. B. Litauen ebenso wie Lettland einen Körperschaftsteuersatz von 15 %.
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Anhangsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Gang der Untersuchung
- 2. Neuordnung der Einkommensbesteuerung
- 2.1 Leitsätze für eine Steuerreform
- 2.1.1 Gleichmäßigkeit der Besteuerung
- 2.1.2 Einfachheit und Transparenz
- 2.1.3 Investitionsförderung
- 2.1.4 Rechtsformneutralität
- 2.1.5 Finanzierbarkeit
- 2.2 Grundkonzeptionen von Steuerreformmodellen
- 2.2.1 Duale Einkommensteuer
- 2.2.2 Flat Tax
- 2.2.3 Modifizierung des Ist-Zustandes
- 2.2.4 Einmal-Steuer
- 2.1 Leitsätze für eine Steuerreform
- 3. Kölner Entwurf eines Einkommensteuergesetzes
- 3.1 Ziele des Kölner Entwurfes
- 3.2 Konzeption des Kölner Entwurfes
- 3.2.1 Steuerpflichtige, Bemessungsgrundlage und Einkommensteuertarif
- 3.2.2 Einkunftsarten
- 3.2.2.1 Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit
- 3.2.2.2 Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit
- 3.2.2.3 Einkünfte aus Finanzkapital
- 3.2.2.4 Einkünfte aus der Veräußerung von Wirtschaftsgütern, Unternehmen, Unternehmensteilen und Anteilen an Erwerbsgemeinschaften
- 3.2.2.5 Einkünfte aus Zukunftssicherung
- 3.2.3 Ermittlung der Einkünfte
- 3.2.3.1 Überschussrechnung
- 3.2.3.2 Bestandsvergleich
- 3.2.4 Verlustabzug
- 3.2.5 Steuerentstehung, Steuerabzüge, Steuerfestsetzung und Steuererhebung
- 3.3 Einordnung des Kölner Entwurfes in die Grundkonzeptionen
- 4. Der Frankfurter Entwurf eines deutschen Einkommensteuerrechts
- 4.1 Ziele des Frankfurter Entwurfes
- 4.2 Konzeption des Frankfurter Entwurfes
- 4.2.1 Steuerpflichtige, Bemessungsgrundlage und Einkommensteuertarif
- 4.2.2 Einkunftsarten
- 4.2.2.1 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft
- 4.2.2.2 Einkünfte aus Gewerbebetrieb
- 4.2.2.3 Einkünfte aus selbständiger Arbeit
- 4.2.2.4 Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit
- 4.2.2.5 Einkünfte aus Kapitalvermögen
- 4.2.2.6 Einkünfte aus Grund- und sonstigen Sachvermögen
- 4.2.2.7 Einkünfte aus Versicherungen und Unterhaltsansprüchen
- 4.2.3 Ermittlung der Einkünfte
- 4.2.3.1 Ermittlung der Einkünfte aus Unternehmen
- 4.2.3.2 Einkünfteermittlung bei den restlichen Einkunftsarten
- 4.2.4 Verlustabzug
- 4.2.5 Steuererhebung
- 4.2.6 Wechselwirkungen der Neuordnung mit anderen Direktsteuern
- 4.3 Einordnung des Frankfurter Entwurfes in die Grundkonzeptionen
- 4.4 Modifikation der Neuordnung durch steuerfinanzierte Sozialtransfers
- 5. Beurteilung der Reformvorschläge
- 5.1 Beurteilung des Kölner Entwurfes
- 5.1.1 Gleichmäßigkeit der Besteuerung
- 5.1.2 Einfachheit und Transparenz
- 5.1.3 Investitionsförderung
- 5.1.4 Rechtsformneutralität
- 5.1.5 Finanzierbarkeit
- 5.2 Beurteilung des Frankfurter Entwurfes
- 5.2.1 Gleichmäßigkeit der Besteuerung
- 5.2.2 Einfachheit und Transparenz
- 5.2.3 Investitionsförderung
- 5.2.4 Rechtsformneutralität
- 5.2.5 Finanzierbarkeit
- 5.3 Gegenüberstellung der beiden Konzeptionen
- 5.4 Abschließende Bewertung der beiden Reformkonzepte
- 5.1 Beurteilung des Kölner Entwurfes
- 6. Thesenförmige Zusammenfassung
- Anhang
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit Reformvorschlägen im deutschen Steuerrecht und analysiert die Reformkonzeptionen von Mitschke und Lang. Das Ziel der Arbeit ist es, die beiden Konzeptionen im Detail darzustellen, zu vergleichen und abschließend zu bewerten.
- Gleichmäßigkeit der Besteuerung
- Einfachheit und Transparenz des Steuerrechts
- Investitionsförderung durch das Steuerrecht
- Rechtsformneutralität im Steuerrecht
- Finanzierbarkeit von Steuerreformen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 dient der Einleitung, die die Problemstellung der Arbeit definiert und den Gang der Untersuchung skizziert. Kapitel 2 beschäftigt sich mit der Neuordnung der Einkommensbesteuerung, wobei Leitsätze für eine Steuerreform und die Grundkonzeptionen von Steuerreformmodellen analysiert werden. Kapitel 3 stellt den Kölner Entwurf eines Einkommensteuergesetzes vor, der die Ziele, die Konzeption und die Einordnung des Entwurfs in die Grundkonzeptionen erläutert. Kapitel 4 behandelt den Frankfurter Entwurf eines deutschen Einkommensteuerrechts und widmet sich ebenfalls den Zielen, der Konzeption und der Einordnung des Entwurfs. Kapitel 5 widmet sich der Beurteilung der Reformvorschläge, die Gleichmäßigkeit der Besteuerung, Einfachheit und Transparenz, Investitionsförderung, Rechtsformneutralität und Finanzierbarkeit der beiden Entwürfe untersucht. Abschließend werden die beiden Konzeptionen gegenübergestellt und bewertet.
Schlüsselwörter
Die Diplomarbeit fokussiert auf die Themen Steuerreform, Einkommensteuer, Kölner Entwurf, Frankfurter Entwurf, Gleichmäßigkeit der Besteuerung, Einfachheit, Transparenz, Investitionsförderung, Rechtsformneutralität und Finanzierbarkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptkritikpunkte am deutschen Einkommensteuerrecht?
Kritisiert werden vor allem die hohe Komplexität, mangelnde Gerechtigkeit durch zu viele Ausnahmetatbestände und die negative Auswirkung auf das Wirtschaftswachstum.
Was unterscheidet den Kölner vom Frankfurter Entwurf?
Die Arbeit vergleicht die Reformkonzepte von Mitschke und Lang hinsichtlich ihrer Ziele wie Einfachheit, Transparenz und Rechtsformneutralität.
Was bedeutet das Leistungsfähigkeitsprinzip?
Es besagt, dass jeder Bürger entsprechend seiner finanziellen Kraft zur Steuerlast beitragen soll. Durch Lobbyismus und Sonderregeln wird dieses Prinzip oft umgangen.
Ist Deutschland ein Hochsteuerland?
Im internationalen Vergleich, besonders gegenüber osteuropäischen Staaten mit niedrigen Körperschaftssteuersätzen (z.B. Litauen 15%), gilt Deutschland als steuerlich unattraktiver Standort.
Welche Rolle spielt die „Flat Tax“ in der Debatte?
Die Arbeit untersucht die Flat Tax als mögliches Reformmodell, das durch einen einheitlichen Steuersatz für mehr Einfachheit und Transparenz sorgen könnte.
- Quote paper
- Michael Schilling (Author), 2005, Reformvorschläge im deutschen Steuerrecht - eine Gegenüberstellung der Reformkonzeptionen von Mitschke und Lang, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/58023