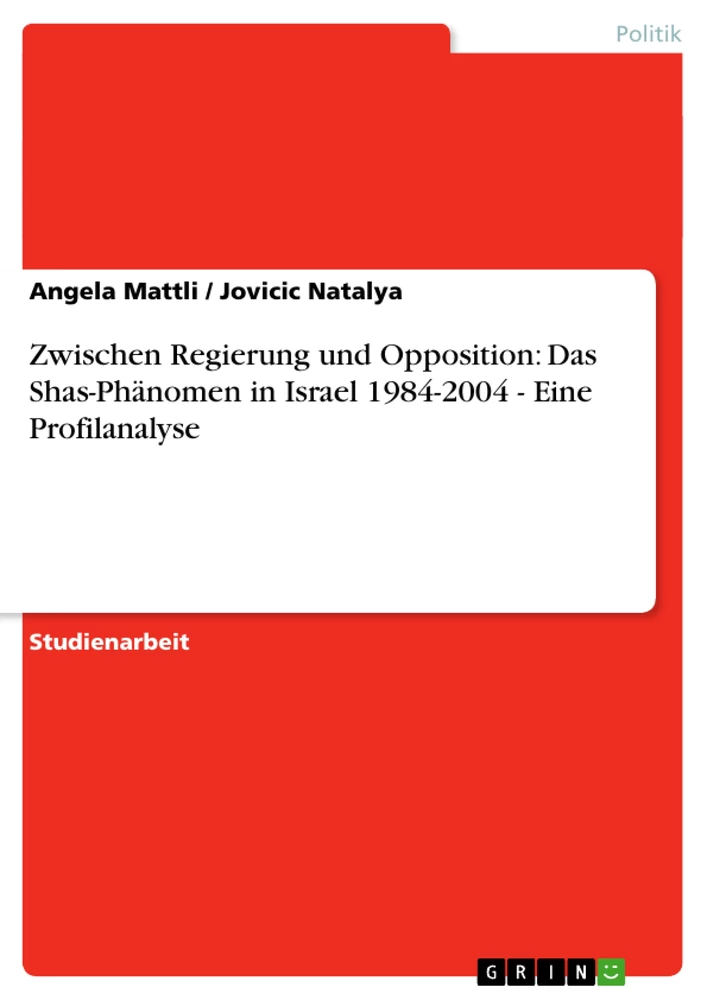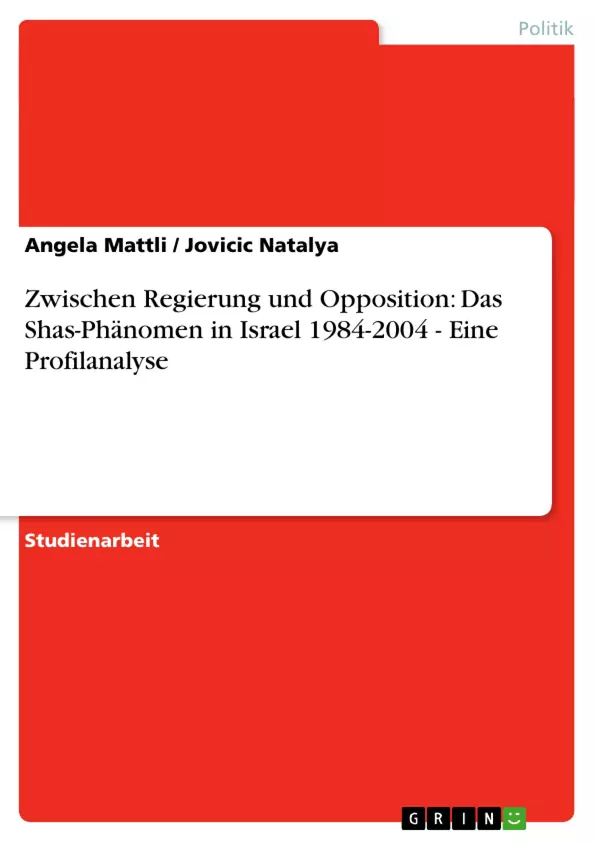Zum vorherrschenden säkular-zionistischen Modell schlägt Shas eine alternative israelische Identität vor. In diesem Sinne ist Shas eine eigentliche Antithese zum ursprünglichen Zionismus, der die jüdischen, religiösen Werte durch liberal-sozialistische ersetzten wollte. Ein wichtiger Faktor für den Aufstieg von Shas ist die Identitätskrise, in der sich Israel seit dem Osloer Abkommen von 1993 befindet. Ab diesem Zeitpunkt begannen viele Israelis den säkularen Zionismus in Frage zustellen, da er den Besitz von Territorien nicht rechtfertigt, die nur von der Tora als jüdisches Siedlungsgebiete beurkundet werden. Der Fokus der Identitätssuche beginnt sich nun stärker auf das „Jüdische“ selbst zu richten, in dem die Religion notwendigerweise den integralen Teil beansprucht. Die israelische Identität wird also von der jüdischen Identität zunehmend verdrängt und der Wahlerfolge von Shas 1999 können somit in den Kontext des von Tom Segev (2002) beschriebenen Phänomens des Post-Zionismus gesetzt werden, das die politische Befindlichkeit der 1990er Jahre signifikant bezeichnet.
Die religiösen Parteien gewannen in den Knessetwahlen von 1999 mehr Sitze als je zuvor in Israels Wahlgeschichte und verfügten über 22.5% der Knesset. Shas war zweifellos der grosse Gewinner unter den religiösen Parteien und konnte ihre Repräsentation in der Knesset von 10 auf 17 Sitzen steigern. Sie wurde somit zur drittgrössten Partei Israels. Wie ist nun das Shas-Phänomen zu erklären? Wurde die ethnische Identifikation nach 50 jähriger Staatsgründung plötzlich politisch signifikant? Oder ist die wachsende Unterstützung für Shas als Ausdruck einer ethnischen Politik und sozialer Unzufriedenheit zu bewerten? Nähert sich Israel immer stärker einem Kulturkampf zwischen religiösen Parteien auf der einen und der sogenannten säkularen Linken auf der anderen Seite?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung.
- Begriffserklärung, Ansatz, Methode.
- Politische Opposition als politikwissenschaftlicher Forschungsgegenstand.
- Angewandte Methode.
- Die sozioökonomischen Variablen
- Unterschied zwischen homogenen und heterogenen gesellschaftlich-politischen Ordnungen: Politische Generationen und Einwanderungswellen (Alijot)
- Grundlegende kulturelle Einstellungen: Das „zweite Israel“.
- Die innerjüdische Polarisierung.
- Kulturelle Diskriminierung
- Religiöse Diskriminierung.
- Die Besiedlung der Peripherie..
- Die sozioökonomische Kluft.
- Fazit..
- Die institutionellen Variablen.
- Erstes Operationalisierungskriterium : strukturelle Änderungen im politischen System und Führungstransformation.
- Das politische System des Staates Israel.
- Strukturelle Änderung im politischen System und Führungstransformation
- Operrationalisierungskriterium: Status Quo..
- Religiöse Staatsorgane.
- Status Quo.....
- Operationalisierungskriterium: Parteiensystem..
- Das Grundmuster der Parteienlandschaft Israels.
- Operationalisierungskriterium: Koalition……..\li>
- Operationalisierungskriterium Wahlsystem ..
- Fazit...
- Die Shas-Partei.
- Identifizierbarkeit...
- Geschichte der Shas-Partei 1984-1999.
- Ideologische Verortung.
- Persönlichkeiten.
- Ziele und Strategien
- Das parteipolitische Programm.
- Erziehungssystem...
- WählerInnen.
- Finanzierung..
- Wettbewerbsfähigkeit.
- Innerparteiliche Strukturen.
- Wahlkampf 1999.
- Wahlkampf 2003.
- Regierungskrise Frühsommer 2004.
- Konklusion des Oppositionsverhaltens der Shas-Partei.
- Das Oppositionsprofil der Shas-Partei
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert das Oppositionsprofil der Shas-Partei in Israel zwischen 1984 und 2004. Ziel ist es, die Rahmenbedingungen zu untersuchen, die das Oppositionsprofil der Partei prägen. Die Arbeit fokussiert auf die sozioökonomischen und institutionellen Variablen, die den Aufstieg und die politische Rolle von Shas beeinflussen.
- Der Aufstieg der Shas-Partei als Ausdruck von ethnischen und sozialen Spannungen in Israel.
- Die sozioökonomischen Unterschiede zwischen Aschkenasim und Mizrachim und deren Einfluss auf das Oppositionsverhalten von Shas.
- Die Rolle des politischen Systems Israels und seine institutionellen Rahmenbedingungen für die Oppositionstätigkeit von Shas.
- Die Analyse der Identifizierbarkeit, Ziele, Strategien und Wettbewerbsfähigkeit der Shas-Partei.
- Die Kombination von sozioökonomischen und institutionellen Variablen zur Erklärung des Oppositionsverhaltens von Shas.
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel stellt die angewandte Methode für die Oppositionsprofilanalyse vor und definiert wichtige Begriffe. Die Methode kombiniert Ansätze von Blondel und Steffani.
- Das zweite Kapitel widmet sich den sozioökonomischen Variablen, insbesondere den Cleavages zwischen Aschkenasim und Mizrachim. Es analysiert den Ursprung und die Auswirkungen dieser Unterschiede.
- Das dritte Kapitel untersucht die institutionellen Variablen des politischen Systems Israels, ausgehend von fünf Operationalisierungskriterien. Es werden die institutionellen Mechanismen analysiert, die das Oppositionsverhalten von Shas beeinflussen.
- Das vierte Kapitel entwickelt aus den sozioökonomischen und institutionellen Variablen das Grundmuster des Oppositionsverhaltens der Shas-Partei. Dabei wird der Ansatz von Blondel angewendet, der das Grundmuster der Opposition aus den Faktoren Identifikation, Ziel und Strategie und Wettbewerbsfähigkeit zusammensetzt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen politische Opposition, Shas-Partei, Israel, sozioökonomische Unterschiede, Aschkenasim, Mizrachim, ethnische Politik, religiöse Politik, institutionelle Rahmenbedingungen, Identifizierbarkeit, Ziele, Strategien, Wettbewerbsfähigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Shas-Partei in Israel?
Shas ist eine ultraorthodoxe politische Partei in Israel, die primär die Interessen der sephardischen und mizrachischen Juden vertritt.
Warum war das Jahr 1999 für Shas so bedeutend?
In diesem Jahr erzielte Shas ihr bestes Wahlergebnis mit 17 Sitzen in der Knesset und wurde zur drittgrößten Partei des Landes.
Was bedeutet der Begriff "Post-Zionismus" in diesem Kontext?
Nach Tom Segev beschreibt er eine Phase, in der die traditionelle säkular-zionistische Identität Israels zugunsten religiöser oder ethnischer Identitäten in Frage gestellt wird.
Was ist der Unterschied zwischen Aschkenasim und Mizrachim?
Aschkenasim sind Juden europäischer Herkunft, während Mizrachim aus dem Nahen Osten und Nordafrika stammen. Shas thematisiert die historische Diskriminierung der Mizrachim durch die aschkenasische Elite.
Welche Rolle spielt das Erziehungssystem für Shas?
Shas betreibt ein eigenes, staatlich gefördertes Schulnetzwerk ("El HaMa'ayan"), das ein zentrales Instrument zur Bindung ihrer Wählerbasis und zur Vermittlung religiöser Werte darstellt.
- Citation du texte
- Master Angela Mattli (Auteur), Jovicic Natalya (Auteur), 2004, Zwischen Regierung und Opposition: Das Shas-Phänomen in Israel 1984-2004 - Eine Profilanalyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/58275