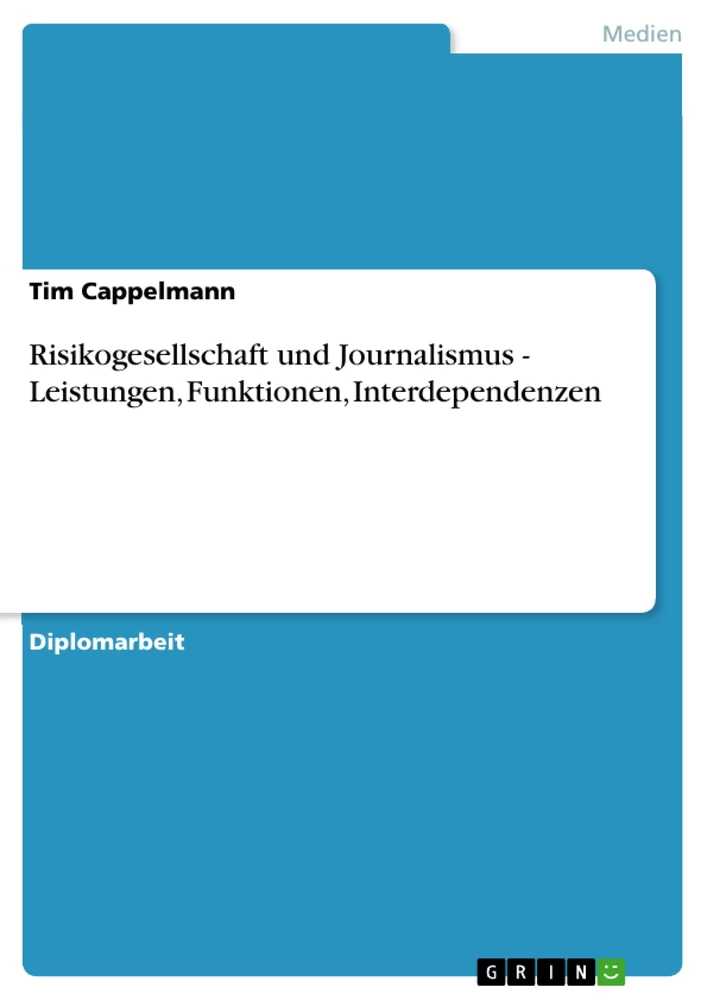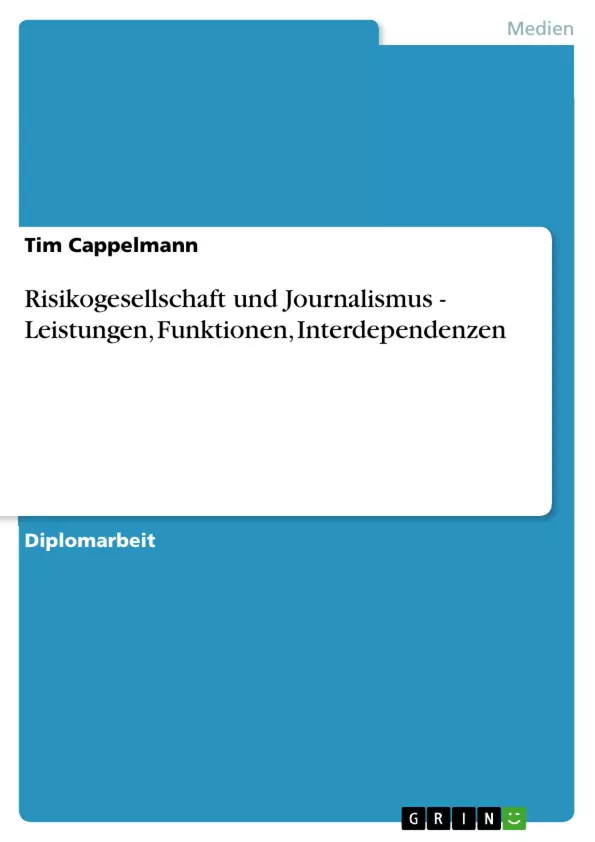Die moderne Gesellschaft wandelt sich. Sie wird komplexer, Entscheidungen auf politischer, wirtschaftlicher und sozialer Ebene undurchsichtiger. Der Fortschritt der westlichen Welt bringt nicht nur Erleichterungen mit sich, sondern auch Risiken. Die möglichen Gefahren gerade technischer Entwicklungen sind in den letzten Jahrzehnten stark ins öffentliche Interesse gerückt und ein vorrangiges Thema gesellschaftlicher Kommunikation geworden. Menschen in entwickelten Industrienationen wird stärker bewusst, dass sie in einer Welt leben, die nicht nur von Sicherheit, Wohlstand und Überfluss geprägt ist, sondern zunehmend von Risiken und Gefahren. Die Gesellschaft entwickelt ein Bewusstsein dafür, „dass die Zukunft von Entscheidungen abhängt, die in der Gegenwart getroffen werden müssen, deren Folgen man aber weder im Guten noch im Schlechten überblicken, geschweige denn steuern kann“ (Bechmann 1993: 7). Jedes System unserer Gesellschaft basiert darauf, Entscheidungen zu treffen. Jede Entscheidung beinhaltet ein Risiko. Und auch eine Nicht-Entscheidung ist eine Entscheidung. In der Risikokommunikation gibt es verschiedene Ansätze, wie Risiko kommuniziert werden sollte und mit welchen Medien. Dabei ist es der Risikoforschung bislang noch nicht gelungen, einen einheitlichen Risikobegriff oder eine zusammenhängende Risikotheorie zu entwickeln. Jede Risikotheorie hat ihren Ausgangspunkt in einer Reihe von Ansätzen und Versuchen unsere Gesellschaft zu beschreiben. Wir leben je nach Beobachterperspektive in einer Risikogesellschaft (Beck 1986), einer Katastrophengesellschaft (Sloterdijk 1989), einer Informationsgesellschaft (Tauss/ Kollbeck/Mönikes 1996), einer Erlebnisgesellschaft (Schulze 1992), einer Möglichkeitsgesellschaft (Beck 1994), einer Sinngesellschaft (Bolz 1997) und mit zunehmender Entwicklung und Verbreitung neuer Medien auch in einer virtuellen Gesellschaft (Bühl 1996). Alle Gesellschaften verbindet bei genauerer Betrachtung die Gemeinsamkeit, Risiken zu bergen; jedes Modell beinhaltet eine Konstante: Risiko. Die Risikogesellschaft beansprucht die Nachfolge der Industriegesellschaft, da sie in „erster Linie nicht durch technologische und industrielle Innovation, sondern durch die Produktion von technologischen Risiken irreversibel geprägt ist“ (Görke, 1994: 16). [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: die Risikogesellschaft
- These
- Methode
- Risiko
- Leitdifferenz von Risiko
- Riskanter Konflikt: Entscheider vs. Betroffener
- Risiko: ein paradoxes Instrument
- Sicherheit: die sichere Illusion
- Entscheidungsdruck und Sicherheit
- Selbstreferenz des Risikos
- Ansätze in der Risikoforschung: R= W x S ?
- Formal-normativer Ansatz
- Psychologisch-kognitiver Ansatz
- Kulturell-soziologischer Ansatz
- Risiko als soziales Konstrukt
- Risikojournalismus als System
- Grundlagen der Systemtheorie
- Exkurs: Beck vs. Luhmann
- Autopoietische Systeme
- Umwelt und Sinngrenzen
- Kommunikation
- Strukturelle Kopplung
- Funktionen von Journalismus und Risikojournalismus
- Binärer Code
- Primärfunktion und Leistungen
- Kritik an den Funktionen
- Struktur von (Risiko)-Journalismus
- Organisationen
- Programme
- Rollen
- Zwischenresümee
- Risiko und Moral
- Risiko und Angst
- Risiko und Politik
- Risiko und Protestbewegungen
- Neue soziale Bewegungen
- Risiko und Wissenschaft
- Risiko und Wirtschaft
- Risikotransformator Bank
- Informationen sind Geld
- Riskante Abhängigkeit: Journalismus und Wirtschaft
- Marktchancen von Risikojournalismus
- Individualisierung in der Risikogesellschaft
- Folgen von Individualisierung
- Inklusion
- Chancen von Individualisierung
- Individualisierung, Lebensplanung, Arbeit
- Riskante Freiheiten
- Risikojournalismus: neue Aufgaben
- Familie in der Risikogesellschaft
- Funktionen und Leistungen
- Riskante Rollen: Kampf der Geschlechter
- Zwischenresümee
- Gewalt in der Risikogesellschaft
- Formen von Gewalt
- Reflexive Gewalt
- Expressive Gewalt
- Instrumentelle und regressive Gewalt
- Risikojournalismus und Gewalt
- Zersplitterte Gesellschaft? Risiko und Virtualisierung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit von Tim Cappelmann untersucht die Interdependenzen zwischen Risikogesellschaft und Journalismus. Sie analysiert die Rolle des Journalismus in der modernen Gesellschaft, die geprägt ist von Unsicherheit, Komplexität und dem Bewusstsein für Risiken. Der Fokus liegt auf der Frage, wie der Journalismus mit diesen Herausforderungen umgeht und welche Funktionen er in der Risikokommunikation erfüllt.
- Die Entwicklung der Risikogesellschaft und die Bedeutung von Risiko in der heutigen Zeit
- Die Funktionen und Herausforderungen des Journalismus in der Risikokommunikation
- Die Beziehung zwischen Journalismus und Wirtschaft im Kontext der Risikogesellschaft
- Die Auswirkungen von Individualisierung und Virtualisierung auf die Risikogesellschaft und den Journalismus
- Die Rolle von Gewalt in der Risikogesellschaft und die Darstellung von Gewalt durch den Journalismus
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: die Risikogesellschaft: Dieses Kapitel führt den Leser in das Thema der Risikogesellschaft ein und beleuchtet die zentralen Aspekte, die diese Gesellschaft prägen. Die zunehmende Komplexität und Unsicherheit in der modernen Welt und die daraus resultierenden Risiken stehen im Mittelpunkt der Diskussion. Die Entstehung der Risikogesellschaft im Kontext der Entwicklung neuer Technologien und der wachsenden Bedeutung von Entscheidungen mit weitreichenden Folgen wird hervorgehoben.
- Risiko: Dieses Kapitel definiert den Begriff des Risikos und analysiert verschiedene Facetten des Risikos. Der Konflikt zwischen Entscheidern und Betroffenen, die paradoxe Natur von Risiko und die Rolle der Sicherheit werden betrachtet. Es wird die Bedeutung von Entscheidungen in der Risikogesellschaft beleuchtet und die Frage nach der Selbstreferenz des Risikos diskutiert.
- Ansätze in der Risikoforschung: R= W x S ?: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Ansätze in der Risikoforschung, die versuchen, das Phänomen des Risikos zu erklären. Der formal-normative Ansatz, der psychologisch-kognitive Ansatz und der kulturell-soziologische Ansatz werden vorgestellt und ihre jeweiligen Stärken und Schwächen diskutiert.
- Risikojournalismus als System: Dieses Kapitel analysiert den Risikojournalismus als System. Es werden die Grundlagen der Systemtheorie erläutert und die Bedeutung von Kommunikation, strukturellen Kopplungen und Interdependenzen für den Journalismus in der Risikogesellschaft herausgestellt. Die Funktionen von Journalismus und Risikojournalismus und die spezifische Struktur von (Risiko)-Journalismus werden detailliert betrachtet.
- Risiko und Moral: Dieses Kapitel untersucht die Verbindung zwischen Risiko und Moral. Es werden die ethischen Herausforderungen und moralischen Dilemmata, die mit dem Umgang von Risiken verbunden sind, diskutiert.
- Risiko und Angst: Dieses Kapitel betrachtet die Beziehung zwischen Risiko und Angst. Es wird die Bedeutung von Angst in der Risikogesellschaft beleuchtet und die Rolle des Journalismus in der Angstbewältigung untersucht.
- Risiko und Politik: Dieses Kapitel analysiert die Interaktion zwischen Risiko und Politik. Es werden die Herausforderungen für die Politik in der Risikogesellschaft und die Rolle des Journalismus in der politischen Kommunikation über Risiken betrachtet.
- Risiko und Protestbewegungen: Dieses Kapitel untersucht die Verbindung zwischen Risiko und Protestbewegungen. Es wird die Entstehung von Protestbewegungen im Kontext der Risikogesellschaft und die Rolle des Journalismus bei der Mobilisierung und Darstellung von Protesten beleuchtet.
- Risiko und Wirtschaft: Dieses Kapitel betrachtet die Beziehung zwischen Risiko und Wirtschaft. Es werden die Chancen und Risiken für die Wirtschaft in der Risikogesellschaft und die Rolle des Journalismus in der Wirtschaftsberichterstattung über Risiken analysiert.
- Individualisierung in der Risikogesellschaft: Dieses Kapitel untersucht die Auswirkungen von Individualisierung auf die Risikogesellschaft. Es werden die Folgen von Individualisierung, die Bedeutung von Inklusion und die Chancen der Individualisierung für den Einzelnen diskutiert.
- Individualisierung, Lebensplanung, Arbeit: Dieses Kapitel fokussiert auf die Bedeutung von Individualisierung, Lebensplanung und Arbeit in der Risikogesellschaft. Die Rolle des Journalismus in der Beratung und Unterstützung der Menschen bei der Bewältigung der Herausforderungen in diesen Bereichen wird betrachtet.
- Familie in der Risikogesellschaft: Dieses Kapitel untersucht die Rolle der Familie in der Risikogesellschaft. Die Funktionen und Leistungen der Familie in der modernen Welt und die besonderen Herausforderungen, die sich durch die Risikogesellschaft für die Familie ergeben, werden beleuchtet.
- Gewalt in der Risikogesellschaft: Dieses Kapitel analysiert die Bedeutung von Gewalt in der Risikogesellschaft. Es werden verschiedene Formen von Gewalt diskutiert und die Rolle des Journalismus bei der Darstellung und Analyse von Gewalt betrachtet.
- Zersplitterte Gesellschaft? Risiko und Virtualisierung: Dieses Kapitel beleuchtet die Auswirkungen von Virtualisierung auf die Risikogesellschaft. Es werden die Chancen und Risiken der digitalen Welt für den Einzelnen und die Gesellschaft diskutiert und die Rolle des Journalismus im digitalen Raum betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit setzt sich mit den Begriffen Risikogesellschaft, Journalismus, Risiko, Kommunikation, Systemtheorie, Individualisierung, Virtualisierung und Gewalt auseinander. Sie beleuchtet die Funktionen des Journalismus in der Risikokommunikation, die Interdependenzen zwischen Risikogesellschaft und Journalismus und die Herausforderungen, die sich durch die Risikogesellschaft für den Journalismus ergeben.
Häufig gestellte Fragen
Was charakterisiert die moderne „Risikogesellschaft“?
Die Risikogesellschaft nach Ulrich Beck ist geprägt durch technologische Risiken, die Folge menschlicher Entscheidungen sind und deren Auswirkungen oft global und irreversibel sind.
Welche Rolle spielt der Journalismus in der Risikokommunikation?
Journalismus fungiert als Vermittler von Risiken, hilft bei der Angstbewältigung und thematisiert ethische sowie politische Herausforderungen komplexer Entscheidungen.
Wie hängen Risiko und Systemtheorie zusammen?
Die Arbeit nutzt die Systemtheorie (Luhmann), um Journalismus als autopoietisches System zu analysieren, das über strukturelle Kopplungen mit Politik, Wirtschaft und Wissenschaft interagiert.
Was ist das Paradoxon von Risiko und Sicherheit?
In der Risikogesellschaft ist Sicherheit oft eine „sichere Illusion“, da jede Entscheidung neue Risiken birgt und auch Nicht-Entscheiden riskant sein kann.
Wie beeinflusst die Individualisierung den Umgang mit Risiken?
Individualisierung zwingt den Einzelnen dazu, Lebensplanung und Risikovorsorge eigenverantwortlich zu gestalten, was neue Aufgaben für den beratenden Journalismus schafft.
- Quote paper
- Tim Cappelmann (Author), 2005, Risikogesellschaft und Journalismus - Leistungen, Funktionen, Interdependenzen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/58278