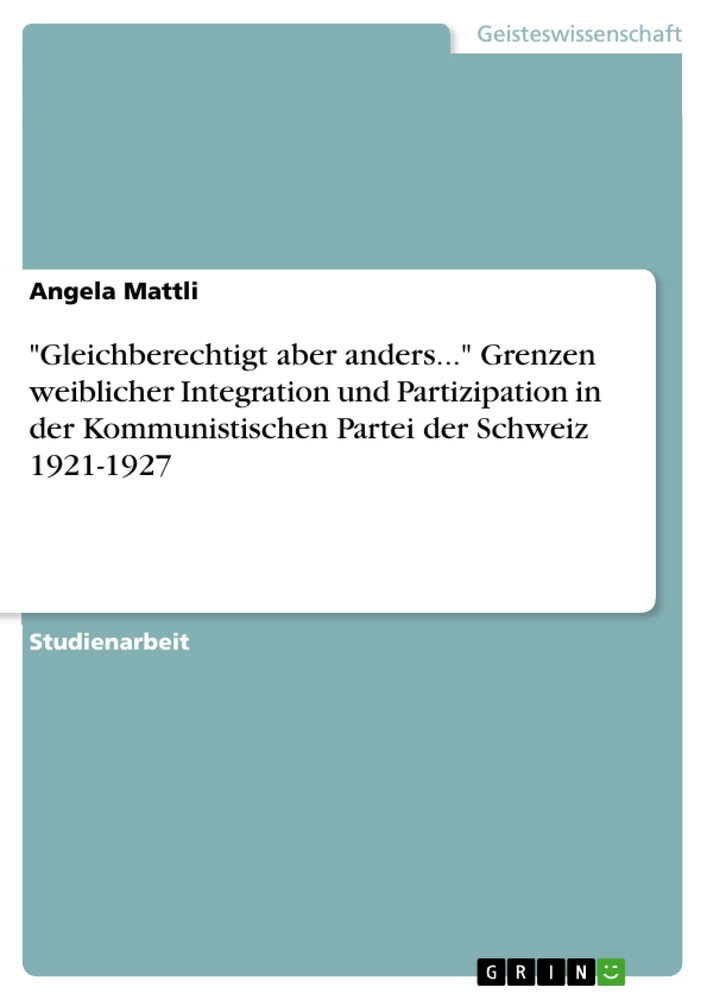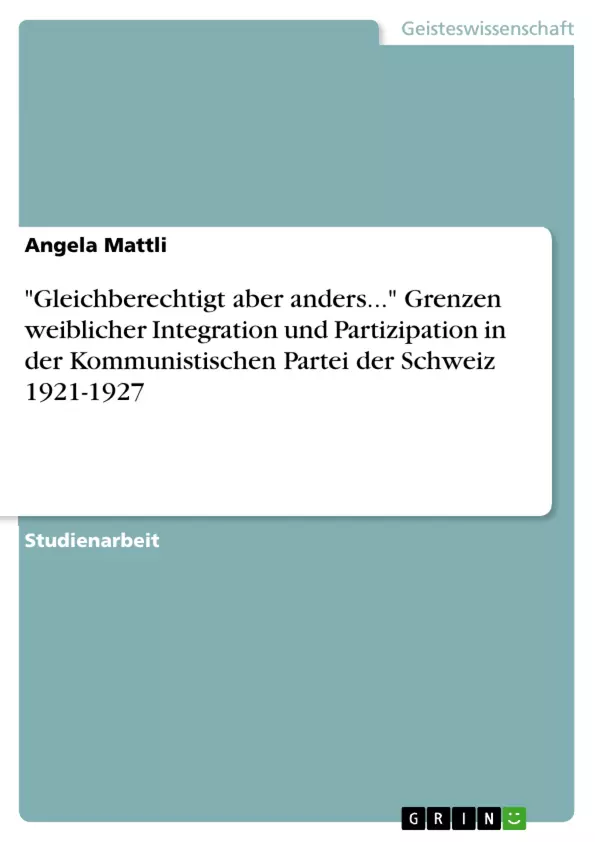Ich habe bewusst diese Periode gewählt, da 1927 einerseits die Arbeit und Integration der Frau als Sache der Gesamtpartei erklärt und in den Statuten festgeschrieben wurde, andereseits, wie oben bereits erwähnt, der Frauenanteil schrumpfte und keine Frau in der engeren Führung vertreten war. Ausserdem lancierte die KPS während dieser Periode ihre einzigen frauenpolitischen Kampagnen:1922 für einen straffreien Schwangerschaftsabbruch und 1927 für die Einführung des Frauenstimmrechts.
Im ersten Kapitel geht es um die theoretische Auseinandersetzung mit den marxistischen Emanzipationstheorien von August Bebel und Clara Zetkin und die Geschlechtsidentität innerhalb der kommunistischen Bewegung.
Das zweite Kapitel liefert einen kurzen Überblick über die Frauenemanzipation in der schweizerischen Arbeiterbewegung. Es geht dabei um die vorherrschenden theoretischen Werke und ihre Rezeption im ArbeiterInnenmilieu selbst.
Das dritte Kapitel umfasst die Gründung der KPS, ihr struktureller Aufbau, ihre Entwicklung bis 1927 und insbesondere die zunehmende Zentralisierung unter dem Einfluss von Moskau. Das vierte Kapitel stellt die Eingliederung der Frau in die KPS dar. Dabei wird auf Rekrutierungs-und Mobilisierungstrategien und ihre tatsächliche Umsetzung eingegangen. Ein weitere wichtiger Punkt bildet die Aufzeichnung der Grenzen und Schwierigkeiten weiblicher Durchsetzungsfähigkeit und Partizipation innerhalb der KPS. Dabei wird sowohl auf soziokulturelle wie auch organisationstechnische Hindernisse eingegangen.
Das fünfte Kapitel zeigt die Frauenpolitik der KPS auf. Es darin insbesondere um die Stellung der Frauenanliegen innerhalb der politischen Agenda. Dabei wird besonders auf das Engagement für Frauenstimmrecht und Schwangerschaftsabbruch eingegangen. Im letzten Punkt geht es um den Wandel der Frauenpolitik und der Marginalisierung von Frauenanliegen durch die zunehmende „Stalinisierung“ der Partei. Das sechste und letzte Kapitel umfasst die Konklusion.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Frauenbild im Kommunismus: Gleichberechtigt aber anders...
- Die marxistische Emanzipationstheorie: August Bebel und Clara Zetkin
- Geschlechtsidentität und Kommunismus
- Frauenemanzipation in der schweizerischen Arbeiterbewegung
- Theoretische Werke
- Frauenemanzipation und ArbeiterInnenmilieu
- Entwicklung der KPS vom Gründungsparteitag bis zum ,,Bolschewisierungsstatut“ von 1927.
- Die Gründung der KPS
- Struktureller Aufbau der KPS
- Die Bolschewisierungsphase 1924-1927
- Die Eingliederung der Frau in die KPS
- Rekrutierung und Mobilisierung
- Grenzen weiblicher Durchsetzungsfähigkeit und Partizipation in der KPS
- Die Frauenpolitik der KPS
- Allgemeine Postulate der KPS zur Frauenemanzipation in der Schweiz
- Frauenstimmrecht
- Schwangerschaftsabbruch
- Wandel der Frauenpolitik
- Konklusion
- Soziokulturelle Faktoren
- Parteistrukturelle Faktoren
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Proseminararbeit untersucht die politische und soziale Stellung der Frau in der Kommunistischen Partei der Schweiz (KPS) in den Jahren 1921-1927. Sie befasst sich mit der Frage, welche parteistrukturellen und soziokulturellen Faktoren die Integration und Partizipation von Frauen in der Partei während dieser Zeit beeinflussten. Das Hauptziel ist es, die Gründe für die begrenzte Anzahl von Frauen in Führungspositionen trotz der marxistischen Emanzipationstheorie zu beleuchten.
- Die marxistische Emanzipationstheorie und ihre Umsetzung in der KPS
- Die Rolle der Frau in der Schweizer Arbeiterbewegung
- Die Rekrutierung und Mobilisierung von Frauen in der KPS
- Die Grenzen weiblicher Durchsetzungsfähigkeit und Partizipation in der KPS
- Die Frauenpolitik der KPS und ihre Entwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die theoretischen Grundlagen der marxistischen Emanzipationstheorie, insbesondere die Beiträge von August Bebel und Clara Zetkin. Es wird die Bedeutung der Geschlechtsidentität im Kontext der kommunistischen Bewegung betrachtet.
Das zweite Kapitel gibt einen Überblick über die Frauenemanzipation in der Schweizer Arbeiterbewegung. Es werden wichtige theoretische Werke und ihre Rezeption im ArbeiterInnenmilieu betrachtet.
Das dritte Kapitel widmet sich der Gründung der KPS, ihrem strukturellen Aufbau und ihrer Entwicklung bis 1927. Es werden die Auswirkungen der Bolschewisierung auf die Partei beleuchtet.
Das vierte Kapitel analysiert die Eingliederung von Frauen in die KPS. Dabei werden die Rekrutierungs- und Mobilisierungstrategien sowie die tatsächliche Umsetzung der Frauenpolitik untersucht.
Das fünfte Kapitel beschäftigt sich mit der Frauenpolitik der KPS. Es wird insbesondere die Position der Frauenanliegen innerhalb der politischen Agenda betrachtet, einschließlich des Engagements für Frauenstimmrecht und Schwangerschaftsabbruch.
Schlüsselwörter
Die Proseminararbeit beschäftigt sich mit den Themen Frauenemanzipation, Kommunismus, Arbeiterbewegung, Geschlechterverhältnisse, politische Partizipation, Schweizer Geschichte, KPS, Frauenpolitik, Rekrutierung, Mobilisierung, soziokulturelle Faktoren, parteistrukturelle Faktoren, August Bebel, Clara Zetkin.
Häufig gestellte Fragen
Wie war die Stellung der Frau in der Kommunistischen Partei der Schweiz (KPS) zwischen 1921 und 1927?
Obwohl die marxistische Theorie die Gleichberechtigung forderte, war die reale Partizipation von Frauen begrenzt. In Führungspositionen waren sie kaum vertreten, und der Frauenanteil schrumpfte gegen Ende dieses Zeitraums sogar.
Welche frauenpolitischen Kampagnen führte die KPS in dieser Zeit durch?
Die KPS lancierte zwei bedeutende Kampagnen: 1922 setzte sie sich für den straffreien Schwangerschaftsabbruch ein und 1927 für die Einführung des Frauenstimmrechts in der Schweiz.
Welchen Einfluss hatten August Bebel und Clara Zetkin auf das Frauenbild?
Ihre marxistischen Emanzipationstheorien bildeten die theoretische Grundlage für die KPS. Sie postulierten die Befreiung der Frau als Teil des Klassenkampfes, was jedoch in der Parteipraxis oft an soziokulturellen Hindernissen scheiterte.
Was bedeutete die „Stalinisierung“ für die Frauenanliegen in der Partei?
Mit der zunehmenden Zentralisierung und Stalinisierung (Bolschewisierung) der Partei wurden spezifische Frauenanliegen zunehmend marginalisiert und der allgemeinen Parteidisziplin untergeordnet.
Welche Hindernisse erschwerten die weibliche Partizipation?
Es gab sowohl soziokulturelle Faktoren (traditionelle Rollenbilder im ArbeiterInnenmilieu) als auch organisationstechnische Hindernisse innerhalb der Parteistrukturen, die eine echte Gleichstellung verhinderten.
- Citation du texte
- Master Angela Mattli (Auteur), 2005, "Gleichberechtigt aber anders..." Grenzen weiblicher Integration und Partizipation in der Kommunistischen Partei der Schweiz 1921-1927, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/58279