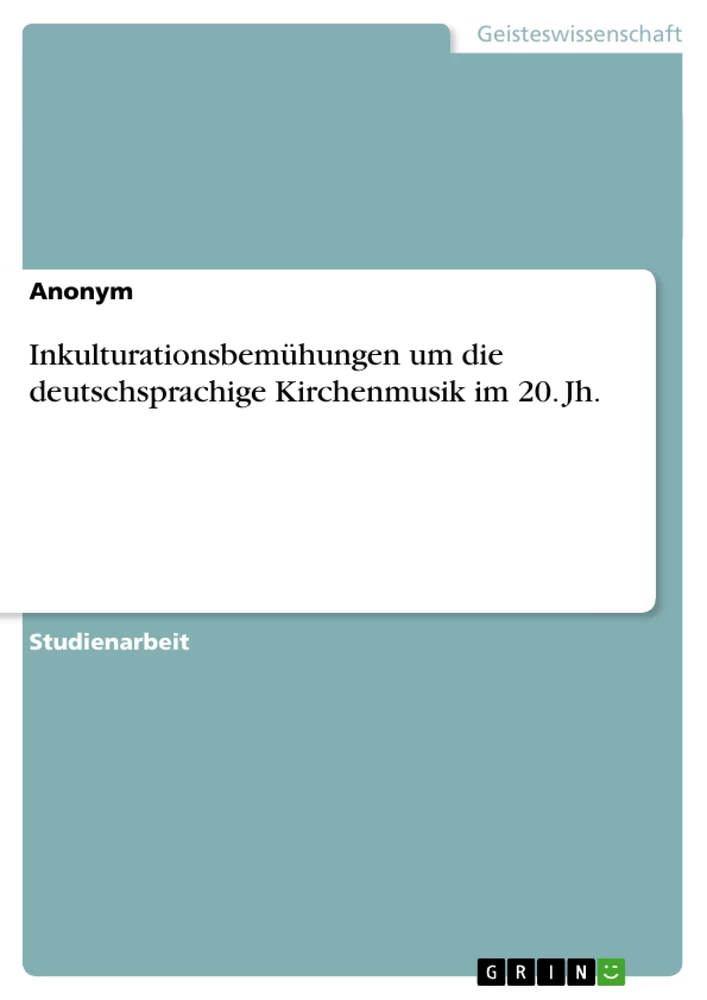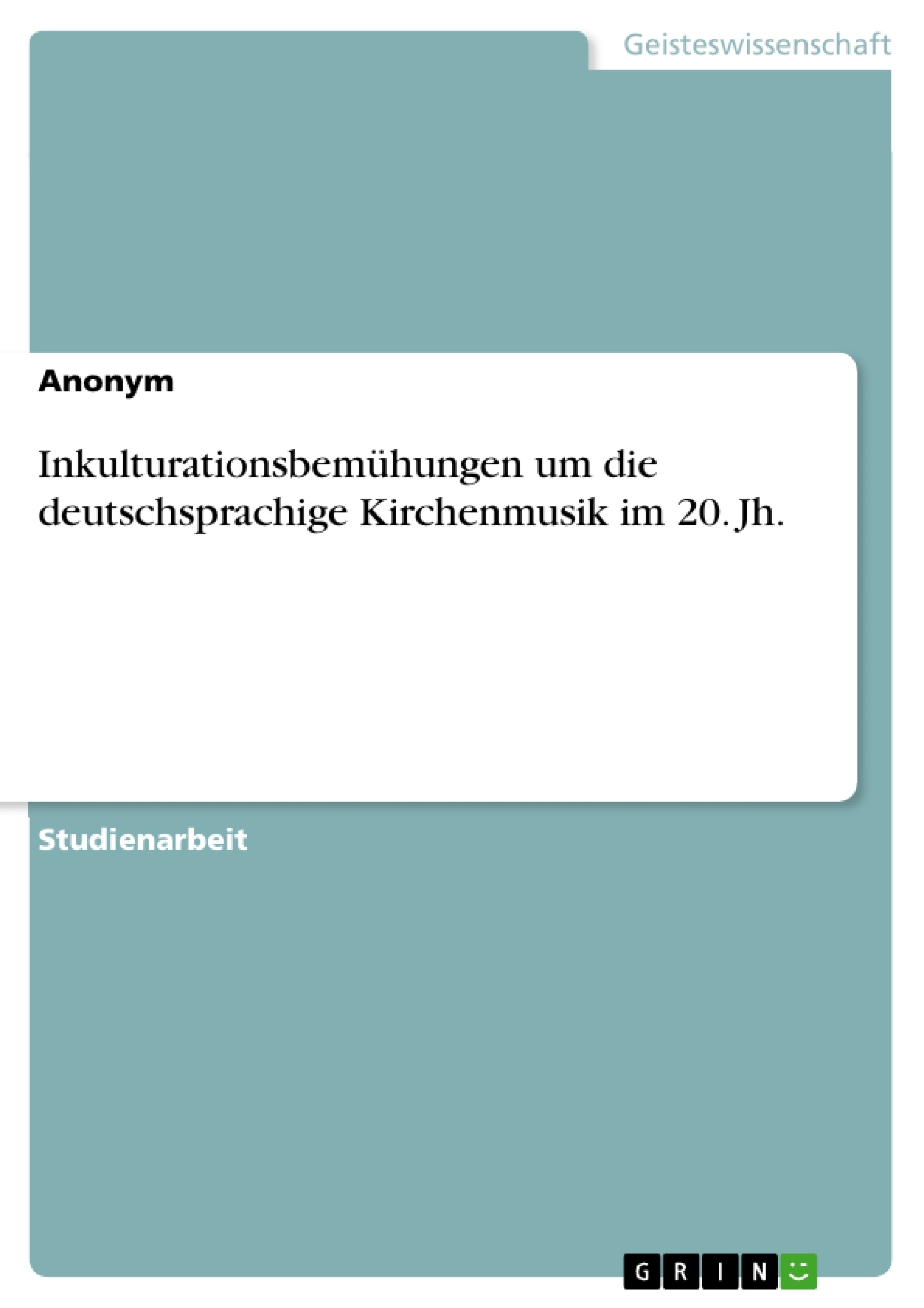Manch junger Katholik mag der Meinung sein, ein katholischer Gottesdienst, vor allem mit Kirchenliedern in deutscher Sprache sei selbstverständlich. Mittlerweile mag dies vielleicht auch so stimmen.
Doch mein Ziel ist es, in dieser Arbeit das Resultat eines langen Inkulturationsprozesses darzustellen, dessen Wurzeln bereits im 7. Jahrhundert liegen.
Die Probleme, die eine sprachliche Inkulturation mit sich bringt, sind auf den ersten Blick nur schwer zu überblicken, da mehr als ein einfacher Beschluss für die Übersetzung des Messgesanges in die deutsche Sprache nötig war.
Erst durch ausführliche Beschäftigung mit geschichtlichen Fragen und Vorschriften kann erkannt werden, dass die ganze Intention eines Gottesdienstes durch eine sprachliche Interlinearversion geändert werden kann.
Vom Mysterienspiel, zu dem der Christ als reiner Zuschauer geladen war, wurde der Gottesdienst im Laufe der Jahrhunderte zur Gemeinschaftsmesse, in der seit dem II. Batikanum die tätige Teilnahme der Gläubigen anerkannt wird.
Erst seit dem Konzil gelten Messteile, die das Volk singt oder spricht messweiterführend.
Zu Beginn der Arbeit werde ich den Begriff ,,Inkulturation" erläutern, sowie die Geschichte der deutschsprachigen Kirchenmusik. Das folgende Kapitel gilt den Bemühungen um eine Approbation von Seiten des Hl. Stuhls, zum Einsatz des messweiterführenden Kirchengesangs .
Im Anschluss daran werde ich die Beschlüsse des II. Vatikanums, die das Deutsche Hochamt in seiner heutigen Form ermöglichten, erörtern, bevor ich mich mit der Frage befasse, ob die Beschlüsse des Zweiten Vatikanums zu einem neuen Liturgieverständnis geführt haben und wie in der Praxis mit diesen umgegangen wird.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Zum Begriff: „Inkulturation“
- Allgemeine Begriffsdefinition
- Das Phänomen christlicher Inkulturation
- Das Phänomen der Inkulturation auf die christliche Liturgie bezogen
- Geschichte und Bedeutung der dt. Kirchenmusik
- Die vorkonziliaren Inkulturationsbemühungen zur Übersetzung der Kirchenmusik in die deutsche Sprache
- Bemühungen um die Approbation zur Übersetzung der Kirchenmusik in die deutsche Sprache vor der Ankündigung zum II. Vatikanischen Konzil
- Die allgemeine Vorbereitungsphase des II. Vatikanischen Konzils
- Die Voten der deutschen Theologen
- Die Beschlüsse des II. Vatikanums zur Erneuerung der Kirchenmusik
- Die Beschlüsse des „Sacrosanctum concilium“
- Die Ausführungsbestimmungen des „Sacrosanctum Concilium“ in dem Dokument „Musicam sacram“
- Erläuterung der Beschlüsse und daraus resultierende Aufgaben der Kirchenmusik
- Ist aufgrund der Beschlüsse infolge des II. Vatikanums ein neues Liturgieverständnis entstanden?
- Wie wird in der Praxis mit diesen Beschlüssen umgegangen?
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den langen Prozess der Inkulturation des katholischen Messgesangs in die deutsche Sprache. Sie beleuchtet die Herausforderungen und die historische Entwicklung, die zur endgültigen Formulierung in den Dokumenten „Sacrosanctum concilium“ und „Musicam sacram“ des II. Vatikanischen Konzils führte.
- Der Begriff der Inkulturation und seine verschiedenen Facetten
- Die Geschichte der deutschsprachigen Kirchenmusik
- Die Bemühungen um die Approbation der Übersetzung des Messgesangs ins Deutsche
- Die Beschlüsse des II. Vatikanischen Konzils zur Kirchenmusik
- Die Auswirkungen der Konzilsbeschlüsse auf das Liturgieverständnis
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Das Vorwort erläutert die scheinbare Selbstverständlichkeit des deutschsprachigen katholischen Gottesdienstes für heutige Katholiken und hebt die lange Geschichte des Inkulturationsprozesses hervor, der diesen Zustand ermöglichte. Es unterstreicht die Komplexität der sprachlichen Inkulturation und wie diese mehr als nur eine einfache Übersetzung des Messgesangs in die deutsche Sprache erforderte, um die Intention des Gottesdienstes zu wahren und die aktive Teilnahme der Gläubigen zu ermöglichen. Der Wandel vom Mysterienspiel zum gemeinschaftlichen Gottesdienst mit aktiver Gläubigenbeteiligung, der erst seit dem II. Vatikanischen Konzil vollends anerkannt ist, wird skizziert.
Zum Begriff: „Inkulturation“: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Inkulturation“ umfassend, grenzt ihn von Akkulturation und Enkulturation ab und beleuchtet seine theologische Bedeutung im Kontext der christlichen Liturgie. Es erklärt, wie Inkulturation das wechselseitige Verhältnis zwischen christlicher Botschaft und kultureller Vielfalt beschreibt und wie die Anpassung des Gottesdienstes an verschiedene Kulturen ein interkultureller Austausch ermöglicht. Das Kapitel beschreibt die drei Phasen der Inkulturation nach Roest Croellius: Akkulturation, Aneignung und Transformation.
Das Phänomen der Inkulturation auf die christliche Liturgie bezogen: (Kapitel fehlt im bereitgestellten Text)
Geschichte und Bedeutung der dt. Kirchenmusik: (Kapitel fehlt im bereitgestellten Text)
Die vorkonziliaren Inkulturationsbemühungen zur Übersetzung der Kirchenmusik in die deutsche Sprache: Dieses Kapitel befasst sich mit den Bemühungen vor dem II. Vatikanischen Konzil, den Messgesang ins Deutsche zu übersetzen und die damit verbundenen Schwierigkeiten und Widerstände zu überwinden. Es beleuchtet die verschiedenen Phasen der Vorbereitung und die Meinungsverschiedenheiten unter den deutschen Theologen. Es zeigt den langen und mühsamen Prozess der Anpassung der Liturgie an die deutsche Kultur auf.
Die Beschlüsse des II. Vatikanums zur Erneuerung der Kirchenmusik: Dieses Kapitel analysiert die konkreten Beschlüsse des II. Vatikanischen Konzils bezüglich der Erneuerung der Kirchenmusik, insbesondere die Entscheidungen in „Sacrosanctum concilium“ und „Musicam sacram“. Es untersucht die Auswirkungen dieser Beschlüsse auf die Praxis des Gottesdienstes und die Rolle der Kirchenmusik in der Liturgie. Die Kapitel erläutert die Bedeutung der Beschlüsse für die aktive Beteiligung der Gläubigen.
Ist aufgrund der Beschlüsse infolge des II. Vatikanums ein neues Liturgieverständnis entstanden?: Dieses Kapitel untersucht die Frage, ob die Beschlüsse des II. Vatikanums tatsächlich zu einem grundlegenden Wandel im Verständnis der Liturgie geführt haben. Es analysiert die praktische Umsetzung der Konzilsbeschlüsse und die Herausforderungen bei der Integration der neuen Ansätze in den Alltag der Gemeinden. Das Kapitel diskutiert die Kontinuität und den Wandel in der Liturgiepraxis.
Schlüsselwörter
Inkulturation, Kirchenmusik, Liturgie, II. Vatikanisches Konzil, Sacrosanctum concilium, Musicam sacram, deutschsprachige Liturgie, Messgesang, aktive Gläubigenbeteiligung, theologische Reflexion, Kultur, Tradition.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit: Inkulturation des katholischen Messgesangs in die deutsche Sprache
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht den langwierigen Prozess der Inkulturation des katholischen Messgesangs in die deutsche Sprache. Sie beleuchtet die Herausforderungen und die historische Entwicklung bis hin zur endgültigen Formulierung in den Dokumenten „Sacrosanctum concilium“ und „Musicam sacram“ des II. Vatikanischen Konzils.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Begriff der Inkulturation, die Geschichte der deutschsprachigen Kirchenmusik, die Bemühungen um die Übersetzung des Messgesangs ins Deutsche vor dem Konzil, die Beschlüsse des II. Vatikanischen Konzils zur Kirchenmusik und die Auswirkungen dieser Beschlüsse auf das Liturgieverständnis.
Was wird im Vorwort erläutert?
Das Vorwort verdeutlicht die scheinbare Selbstverständlichkeit des deutschsprachigen katholischen Gottesdienstes für heutige Katholiken und hebt die lange Geschichte des Inkulturationsprozesses hervor. Es betont die Komplexität der sprachlichen Inkulturation und den Wandel vom Mysterienspiel zum gemeinschaftlichen Gottesdienst mit aktiver Gläubigenbeteiligung.
Wie wird der Begriff „Inkulturation“ definiert?
Der Begriff „Inkulturation“ wird umfassend definiert, von Akkulturation und Enkulturation abgegrenzt und seine theologische Bedeutung im Kontext der christlichen Liturgie beleuchtet. Es wird erklärt, wie Inkulturation das wechselseitige Verhältnis zwischen christlicher Botschaft und kultureller Vielfalt beschreibt und die Anpassung des Gottesdienstes an verschiedene Kulturen als interkulturellen Austausch darstellt. Die drei Phasen der Inkulturation nach Roest Croellius (Akkulturation, Aneignung und Transformation) werden beschrieben.
Was wird in den Kapiteln zur vorkonziliaren Zeit und den Konzilsbeschlüssen behandelt?
Das Kapitel zu den vorkonziliaren Bemühungen beschreibt die Schwierigkeiten und Widerstände bei der Übersetzung des Messgesangs ins Deutsche vor dem II. Vatikanischen Konzil. Das Kapitel zu den Konzilsbeschlüssen analysiert die Entscheidungen in „Sacrosanctum concilium“ und „Musicam sacram“ und deren Auswirkungen auf die Praxis des Gottesdienstes und die Rolle der Kirchenmusik in der Liturgie.
Welche Frage steht im Mittelpunkt des letzten Kapitels?
Das letzte Kapitel untersucht, ob die Beschlüsse des II. Vatikanums zu einem grundlegenden Wandel im Verständnis der Liturgie geführt haben. Es analysiert die praktische Umsetzung der Konzilsbeschlüsse und die Herausforderungen bei der Integration der neuen Ansätze in den Alltag der Gemeinden.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Inkulturation, Kirchenmusik, Liturgie, II. Vatikanisches Konzil, Sacrosanctum concilium, Musicam sacram, deutschsprachige Liturgie, Messgesang, aktive Gläubigenbeteiligung, theologische Reflexion, Kultur, Tradition.
Welche Kapitel fehlen im bereitgestellten Text?
Die Kapitel „Das Phänomen der Inkulturation auf die christliche Liturgie bezogen“ und „Geschichte und Bedeutung der dt. Kirchenmusik“ fehlen im bereitgestellten Text.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2002, Inkulturationsbemühungen um die deutschsprachige Kirchenmusik im 20. Jh., Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/5829