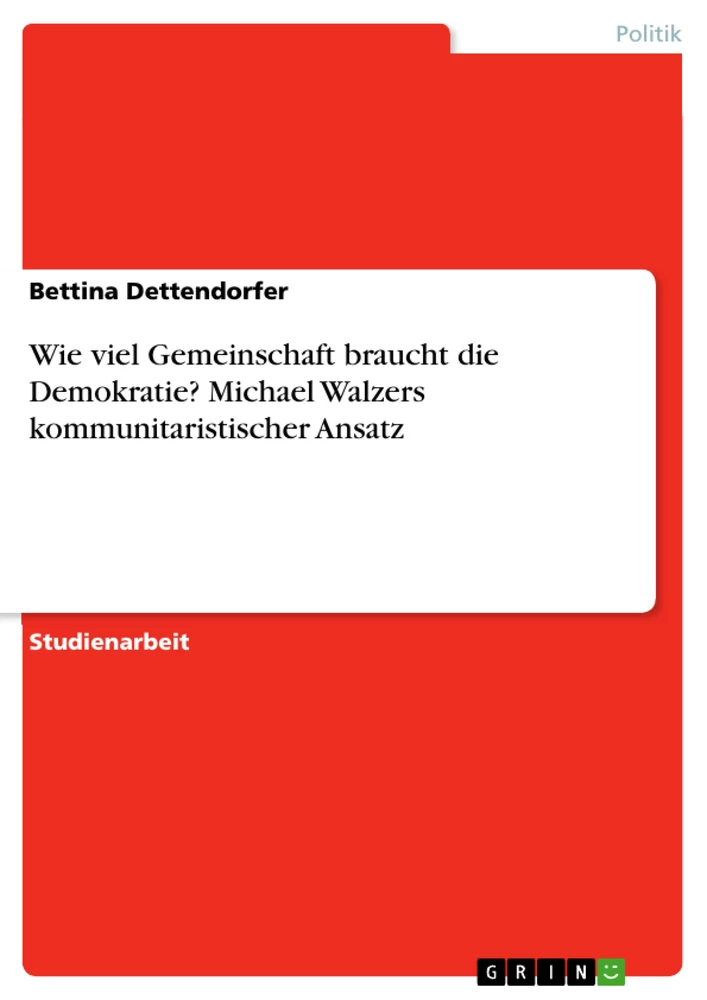Spätestens seit Anfang der 90er Jahre erzwingen aktuelle politische und gesellschaftliche Umbrüche in Ost- und Westeuropa immer wieder ein Nachdenken über die Bedeutung von Gemeinschaften für stabile Demokratien. Wieviel Gemeinschaft brauchen Gesellschaften, wie viel Konsens benötigt eine Demokratie? Kann in heutigen pluralen Gesellschaften überhaupt noch von *einer* Gemeinschaft gesprochen werden? Die Beantwortung dieser Fragen fällt schwer, da vor allem mit Blick auf die deutsche Geschichte Gemeinschaftsdenken ideologieverdächtig erscheint. Aus einem anderen theoriegeschichtlichen Hintergrund heraus beschäftigt sich bereits seit Anfang der 80er Jahre eine theoretische, politikphilosophische Bewegung mit genau diesen Fragen: der aus Nordamerika kommende Kommunitarismus. Die kommunitaristische Strömung umfaßt so unterschiedliche Autoren wie Michael Sandel, Amitai Etzioni, Charles Taylor, Richard Rorty und ist deshalb schwer in das übliche Links-Rechts-Schema einzu-ordnen. Gemeinsam ist den kommunitaristischen Autoren jedoch der „Versuch einer Wiederbelebung von Gemeinschaftsdenken unter den Bedingungen postmoderner Dienstleistungsgesellschaften“. Der Kommunitarismus prägte nicht nur in den USA die Debatte um die Integrationsfähigkeit moderner Gesellschaften, thematisiert bis heute den Verlust politischer Integration in hochindustrialisierten Gesellschaften und glaubt in der Stärkung der Gemeinschaften und ihrer Werte eine Lösung für die zunehmende Individualisierung und Politikverdrossenheit zu erkennen. Mit diesem Gemeinschaftsdenken bezieht der Kommunitarismus Position gegen den politischen Liberalismus, der zur Lösung gesellschaftlicher Probleme auf eine Stärkung individueller Rechte und Freiheiten setzt und diese über universalistische Norm- und Gerechtigkeitsprinzipien absichert. Auch Michael Walzer, der kommunitaristisch geprägt das individualistische Menschenbild kritisiert und den Blick auf die sozialen Gemeinschaften richtet, wird zu den zentralen Akteuren der politisch-philosophischen Debatte zwischen Kommunitaristen und Liberalisten gerechnet. Mit seinem Werk „Sphären der Gerechtigkeit“ distanziert er sich zu John Rawls liberaler, universalistischer „Eine Theorie der Gerechtigkeit“ und wirbt für ein pluralistisches Gerechtigkeits- und Gleichheitskonzept: „Unterschiedliche Lebensformen bedingen unterschiedliche Konzeptionen der Gerechtigkeit“.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Konzept der „Sphären der Gerechtigkeit“
- Die Kunst der Trennung als Ausgangspunkt
- Soziale Güter und geteilte Überzeugungen einer Gemeinschaft
- Komplexe Gleichheit
- Walzers kommunitaristische Demokratievorstellung
- Die politische Gemeinschaft und die Communities
- Die Bedeutung der Communities
- Mitgliedschaft in der politischen Gemeinschaft
- Demokratischer Staat und Zivile Gesellschaft
- Die Zivile Gesellschaft
- Die Aufgaben des demokratischen Staates
- Partizipation in der zivilen Gesellschaft
- Die politische Gemeinschaft und die Communities
- Kritische Betrachtung des Walzerschen Demokratieverständnis
- Die Ungerechtigkeit der „Sphären der Gerechtigkeit“
- Ein vormoderner Begriff politischer Gemeinschaft
- Das Risiko in der walzerschen Gemeinschaftsbindung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit Michael Walzers kommunitaristischem Ansatz zur Demokratie und dessen kritischer Betrachtung. Sie untersucht die Frage, wie viel Gemeinschaft eine Demokratie benötigt und setzt sich mit Walzers Konzept der „Sphären der Gerechtigkeit“ auseinander.
- Walzers Kritik am individualistischen Menschenbild und die Betonung sozialer Gemeinschaften
- Das Konzept der „Sphären der Gerechtigkeit“ und die Trennung der Gesellschaft in verschiedene Bereiche
- Die Bedeutung von Communities und deren Rolle in Walzers Demokratievorstellung
- Der Vergleich zwischen Walzers kommunitaristischem Ansatz und dem liberalen Demokratieverständnis
- Die kritische Auseinandersetzung mit den Risiken und Herausforderungen von Walzers Gemeinschaftsdenken
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt den aktuellen Diskurs über die Bedeutung von Gemeinschaft für Demokratien in den Kontext des Kommunitarismus. Sie erläutert den historischen Hintergrund und die zentralen Ziele der kommunitaristischen Bewegung.
Im zweiten Kapitel wird Walzers Konzept der „Sphären der Gerechtigkeit“ vorgestellt. Es wird die Trennung der Gesellschaft in verschiedene Sphären mit eigenen Verteilungsregeln erläutert, die die komplexe Gleichheit gewährleisten sollen.
Kapitel 3 beleuchtet Walzers Demokratievorstellung. Die Bedeutung von Communities, die Mitgliedschaft in der politischen Gemeinschaft und die Rolle des demokratischen Staates als zivile Gesellschaft werden dargestellt.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit befasst sich mit Themen wie Kommunitarismus, Demokratie, Gerechtigkeit, „Sphären der Gerechtigkeit“, Gemeinschaft, zivile Gesellschaft, politische Partizipation, komplexe Gleichheit, Individualismus, Liberalismus und pluralistische Gesellschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Kern von Michael Walzers Kommunitarismus?
Walzer betont die Bedeutung von Gemeinschaften (Communities) für eine stabile Demokratie und kritisiert das rein individualistische Menschenbild des Liberalismus.
Was versteht Walzer unter „Sphären der Gerechtigkeit“?
Er schlägt vor, die Gesellschaft in verschiedene Bereiche zu unterteilen, in denen jeweils eigene Verteilungsregeln für soziale Güter gelten, um „komplexe Gleichheit“ zu erreichen.
Wie unterscheidet sich Walzer von John Rawls?
Während Rawls auf universalistische Gerechtigkeitsprinzipien setzt, argumentiert Walzer, dass unterschiedliche Lebensformen auch unterschiedliche Konzeptionen von Gerechtigkeit erfordern.
Welche Rolle spielt die zivile Gesellschaft in Walzers Theorie?
Die zivile Gesellschaft ist der Raum, in dem Bürger in verschiedenen Gemeinschaften partizipieren und so die soziale Integration und demokratische Praxis stärken.
Welche Kritik wird an Walzers Ansatz geäußert?
Kritiker bemängeln unter anderem einen potenziell vormodernen Begriff der politischen Gemeinschaft und die Risiken einer zu starken Gemeinschaftsbindung.
- Citar trabajo
- Bettina Dettendorfer (Autor), 2000, Wie viel Gemeinschaft braucht die Demokratie? Michael Walzers kommunitaristischer Ansatz , Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/58340