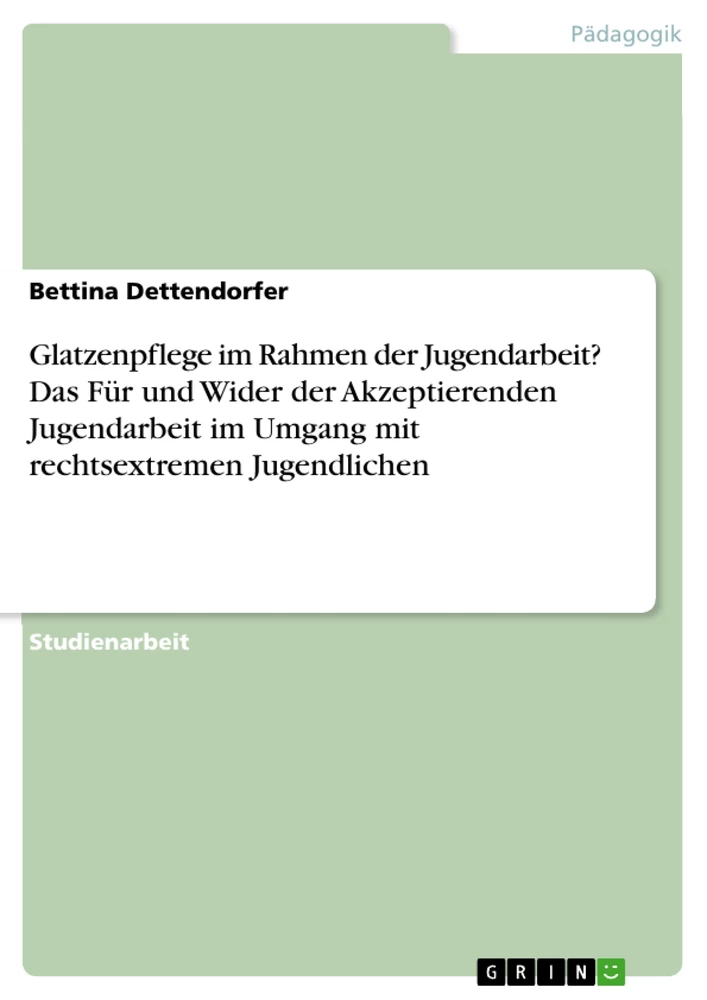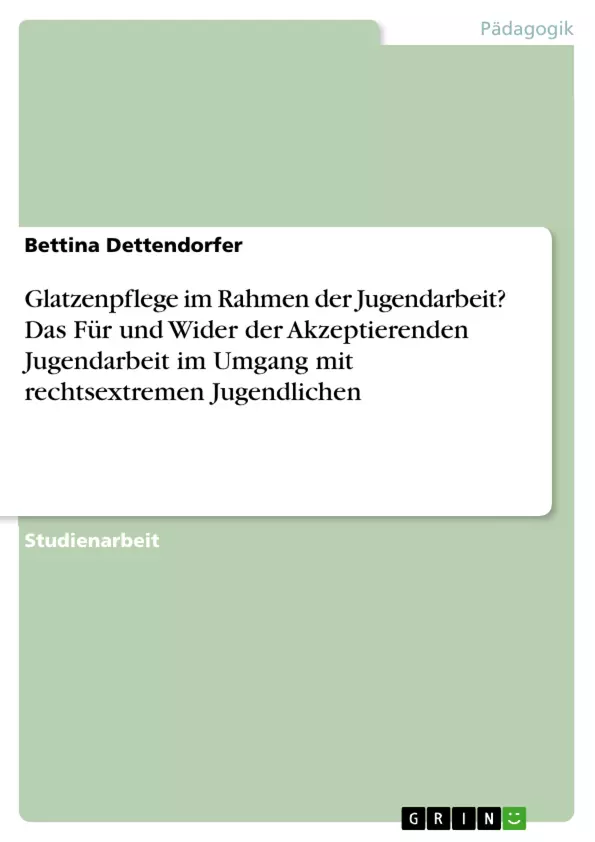„Fünf Jahre Glatzenpflege auf Staatskosten. Jugendarbeit zwischen Politik und Pädagogik.“ Der provokante Titel eines Buches, das sich kritisch mit Möglichkeiten und Chancen der Jugendarbeit mit rechtsextrem orientierten Jugendlichen auseinandersetzt, verdeutlicht bereits im Titel das Dilemma der Jugendarbeit in diesem Arbeitsbereich: Inwieweit kann Jugendarbeit in diesem Feld einen Erfolg erzielen, wenn das Phänomen des Rechtsextremismus kein eigentliches Jugendphänomen ist, sondern durchaus in der Mitte der Gesellschaft zu verankern ist? Welche Methoden und Konzepte bieten eine Chance, politische Ideologien der Ungleichheit und ihre gewalttätige Umsetzung einzudämmen? Kann dies überhaupt eine pädagogische Aufgabe sein oder übernimmt die Jugendarbeit im Umgang mit rechtsextremen Kindern und Jugendlichen nur eine „Notnagelfunktion“, die politische Instanzen aus der Verantwortung hebt? Betrachtet man nun die Entwicklung politischer Orientierungen und Einstellungen von Kindern und Jugendlichen in den 90er Jahren, so läßt sich gerade in der Akzeptanz rechtsextremer Orientierungen und der Ausübung politisch rechtsextrem motivierter Gewalttaten eine erschreckende Zunahme feststellen: Hoyerswerda, Rostock oder Mölln sind nur einige Orte an denen sich rechtsextreme Übergriffe Anfang der 90er Jahre deutlich manifestierten. Auch heute zeugen noch genügend Schlagzeilen in der Presse von rechtsextremen Jugendlichen. Sicherlich sind rechtsextreme Gewalttaten auch in früheren Jahren vorgekommen. Neu ist jedoch das zunehmend jüngere Alter der Täter, die gesteigerte Gewalt und der hohe Zulauf zu rechtsextremen Organisationen gerade unter Jugendlichen. Für die Jugendarbeit bedeuten diese Tatsachen gerade in den 90er Jahren einen zunehmenden Handlungsbedarf in der Arbeit mit rechtsextremen Cliquen und Jugendlichen. In dieser Hausarbeit soll nun nach einer definitorischen Abgrenzung der Begrifflichkeiten versucht werden, anhand von ausgewählten Jugendstudien rechtsextreme Orientierungen und Einstellungen der Jugend in den 90er Jahren zu erfassen und den sozialisationstheoretischen Ansatz von Willhelm Heitmeyer als potentielle Begründung für diese Phänomene darzustellen. Als eine mögliche Konsequenz im Umgang mit rechtsextremen Jugendlichen wird in einem weiteren Schwerpunkt der Hausarbeit die Akzeptierende Jugendarbeit mit rechten Jugendcliquen vorgestellt, kritisch hinterfragt und eine Alternative dazu in der politischen Jugendbildungsarbeit erörtert. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Ergebnisse der Jugendforschung zur Entwicklung rechtsextremer Orientierungen
- 2.1 Definitorische Abgrenzung der Begrifflichkeiten
- 2.1.1 Politische Orientierung
- 2.1.2 Gewalttätiges Handeln und Rechtsextreme Orientierung
- 2.2 Die Entwicklung rechtsextremer Orientierungsmuster in Jugendstudien
- 2.2.1 Die Demokratiezufriedenheit
- 2.2.2 Die Einstellung zur Gewalt
- 2.2.3 Die nationalistische und ausländerfeindliche Orientierung
- 2.2.4 Die rechtsradikalistische Orientierung
- 2.3 Der sozialisationstheoretische Begründungsansatz
- 2.3.1 Einflußfaktoren
- 2.3.1.1 Die Arbeitssituation
- 2.3.1.2 Die Milieus im Umfeld des Jugendlichen
- 2.3.1.3 Die Schullaufbahn und der Bildungsabschluß
- 2.3.1.4 Die Politische Entfremdung
- 2.3.2 Die Instrumentalisierungsthese
- 2.3.1 Einflußfaktoren
- 2.1 Definitorische Abgrenzung der Begrifflichkeiten
- 3 Die Einordnung der Akzeptierenden Jugendarbeit in den cliquenorientierten Ansatz
- 3.1 Die Bedeutung der Jugendclique
- 3.2 Pädagogische Grundsätze einer cliquenorientierten Arbeit
- 4 Die „Akzeptierende“ Jugendarbeit
- 4.1 Entstehung und Prämissen dieser Jugendarbeit
- 4.2 Zentrale Grundsätze
- 4.3 Das Grundverständnis der Akzeptanz
- 4.4 Die zentralen Handlungsebenen
- 4.4.1 Die Akzeptanz bestehender Cliquen
- 4.4.2 Das Angebot sozialer Räume
- 4.4.3 Die Beziehungsarbeit
- 4.4.4 Die Entwicklung einer lebensweltorientierten infrastrukturellen Arbeit
- 4.5 Die Problematik der Grenzziehung
- 5 Kritische Betrachtung der Akzeptierenden Jugendarbeit
- 5.1 Kritik aus pädagogischer Sicht
- 5.2 Kritik aus politischer Sicht
- 5.3 Pädagogisch-politische Alternativen?
- 6 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Herausforderungen der Jugendarbeit im Umgang mit rechtsextrem orientierten Jugendlichen. Sie analysiert die Entwicklung rechtsextremer Orientierungen bei Jugendlichen in den 1990er Jahren anhand von Jugendstudien und dem sozialisationstheoretischen Ansatz von Wilhelm Heitmeyer. Die Arbeit beleuchtet die "Akzeptierende Jugendarbeit" als einen möglichen Ansatz und diskutiert dessen Vor- und Nachteile kritisch.
- Definitorische Abgrenzung von Rechtsextremismus und politischen Orientierungen
- Analyse der Entwicklung rechtsextremer Orientierungen bei Jugendlichen in den 1990er Jahren
- Präsentation des sozialisationstheoretischen Ansatzes als Erklärungsmodell
- Vorstellung und kritische Auseinandersetzung mit der "Akzeptierenden Jugendarbeit"
- Diskussion pädagogisch-politischer Alternativen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Problematik der Hausarbeit vor: den Umgang der Jugendarbeit mit rechtsextrem orientierten Jugendlichen. Sie verweist auf die Zunahme rechtsextremer Gewalttaten in den 1990er Jahren und die damit verbundene Notwendigkeit, effektive Strategien zu entwickeln. Die Arbeit kündigt eine definitorische Abgrenzung von Begriffen, die Analyse von Jugendstudien, die Darstellung des sozialisationstheoretischen Ansatzes und die kritische Betrachtung der "Akzeptierenden Jugendarbeit" an.
2 Ergebnisse der Jugendforschung zur Entwicklung rechtsextremer Orientierungen: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition von politischen Orientierungen und rechtsextremen Einstellungen. Es analysiert Ergebnisse von Jugendstudien, die sich mit der Verbreitung rechtsextremer Orientierungen unter Jugendlichen in den 1990er Jahren auseinandersetzen, und beleuchtet verschiedene Faktoren wie Demokratiezufriedenheit, Einstellungen zur Gewalt, nationalistische und ausländerfeindliche Orientierungen sowie rechtsradikale Einstellungen. Der sozialisationstheoretische Ansatz wird als möglicher Erklärungsansatz für diese Phänomene vorgestellt, wobei Einflussfaktoren wie Arbeitssituation, Milieu, Schullaufbahn und politische Entfremdung berücksichtigt werden.
3 Die Einordnung der Akzeptierenden Jugendarbeit in den cliquenorientierten Ansatz: Dieses Kapitel ordnet die Akzeptierende Jugendarbeit in den Kontext cliquenorientierter Ansätze ein. Es betont die Bedeutung von Jugendcliquen als soziale Bezugsgruppen und diskutiert pädagogische Grundsätze, die für eine erfolgreiche Arbeit mit diesen Gruppen essentiell sind. Es bereitet den Boden für die ausführliche Darstellung der Akzeptierenden Jugendarbeit im folgenden Kapitel.
4 Die „Akzeptierende“ Jugendarbeit: Dieses Kapitel beschreibt die Entstehung und die Prämissen der Akzeptierenden Jugendarbeit, ihre zentralen Grundsätze und ihr Verständnis von Akzeptanz. Es analysiert verschiedene Handlungsebenen, darunter die Akzeptanz bestehender Cliquen, das Angebot sozialer Räume, die Beziehungsarbeit und die Entwicklung einer lebensweltorientierten Infrastruktur. Die Problematik der Grenzziehung zwischen Akzeptanz und Duldung rechtsextremer Einstellungen wird ebenfalls thematisiert.
5 Kritische Betrachtung der Akzeptierenden Jugendarbeit: Dieses Kapitel bietet eine kritische Auseinandersetzung mit der Akzeptierenden Jugendarbeit aus pädagogischer und politischer Sicht. Es analysiert mögliche Schwächen und Grenzen dieses Ansatzes und diskutiert alternative pädagogisch-politische Strategien zur Prävention und Intervention im Umgang mit rechtsextrem orientierten Jugendlichen.
Schlüsselwörter
Rechtsextremismus, Jugendforschung, politische Orientierung, Sozialisation, Akzeptierende Jugendarbeit, Jugendcliquen, Gewaltprävention, politische Jugendbildung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Umgang der Jugendarbeit mit rechtsextrem orientierten Jugendlichen
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Herausforderungen der Jugendarbeit im Umgang mit rechtsextrem orientierten Jugendlichen in den 1990er Jahren. Sie analysiert die Entwicklung rechtsextremer Orientierungen, beleuchtet den Ansatz der "Akzeptierenden Jugendarbeit" und diskutiert dessen Vor- und Nachteile kritisch.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst die definitorische Abgrenzung von Rechtsextremismus und politischen Orientierungen, die Analyse der Entwicklung rechtsextremer Orientierungen bei Jugendlichen anhand von Jugendstudien, die Präsentation des sozialisationstheoretischen Ansatzes als Erklärungsmodell, die Vorstellung und kritische Auseinandersetzung mit der "Akzeptierenden Jugendarbeit" sowie die Diskussion pädagogisch-politischer Alternativen.
Wie wird Rechtsextremismus in der Arbeit definiert?
Die Arbeit beginnt mit einer genauen definitorischen Abgrenzung der Begrifflichkeiten „Politische Orientierung“ und „Gewalttätiges Handeln und Rechtsextreme Orientierung“, um eine klare Grundlage für die weiteren Analysen zu schaffen.
Welche Jugendstudien werden analysiert?
Die Hausarbeit analysiert Ergebnisse verschiedener Jugendstudien der 1990er Jahre, die sich mit der Verbreitung rechtsextremer Orientierungen unter Jugendlichen befassen. Konkrete Studien werden im Hauptteil benannt.
Welcher sozialisationstheoretische Ansatz wird verwendet?
Die Arbeit nutzt den sozialisationstheoretischen Ansatz, um die Entwicklung rechtsextremer Orientierungen zu erklären. Hierbei werden Einflussfaktoren wie Arbeitssituation, Milieu, Schullaufbahn und politische Entfremdung berücksichtigt.
Was ist die „Akzeptierende Jugendarbeit“?
Die „Akzeptierende Jugendarbeit“ wird als ein möglicher Ansatz im Umgang mit rechtsextrem orientierten Jugendlichen vorgestellt. Die Arbeit beschreibt deren Entstehung, Prämissen, zentrale Grundsätze und Handlungsebenen (Akzeptanz bestehender Cliquen, Angebot sozialer Räume, Beziehungsarbeit, lebensweltorientierte Infrastruktur). Die Problematik der Grenzziehung zwischen Akzeptanz und Duldung wird ebenfalls diskutiert.
Welche Kritikpunkte an der „Akzeptierenden Jugendarbeit“ werden genannt?
Die Arbeit enthält eine kritische Betrachtung der „Akzeptierenden Jugendarbeit“ aus pädagogischer und politischer Perspektive. Mögliche Schwächen und Grenzen des Ansatzes werden analysiert.
Welche Alternativen zur „Akzeptierenden Jugendarbeit“ werden vorgeschlagen?
Die Hausarbeit diskutiert alternative pädagogisch-politische Strategien zur Prävention und Intervention im Umgang mit rechtsextrem orientierten Jugendlichen.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral für die Arbeit?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Rechtsextremismus, Jugendforschung, politische Orientierung, Sozialisation, Akzeptierende Jugendarbeit, Jugendcliquen, Gewaltprävention und politische Jugendbildung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sechs Kapitel gegliedert: Einleitung, Ergebnisse der Jugendforschung, Einordnung der Akzeptierenden Jugendarbeit, Die Akzeptierende Jugendarbeit, Kritische Betrachtung und Fazit. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
- Quote paper
- Bettina Dettendorfer (Author), 1999, Glatzenpflege im Rahmen der Jugendarbeit? Das Für und Wider der Akzeptierenden Jugendarbeit im Umgang mit rechtsextremen Jugendlichen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/58345