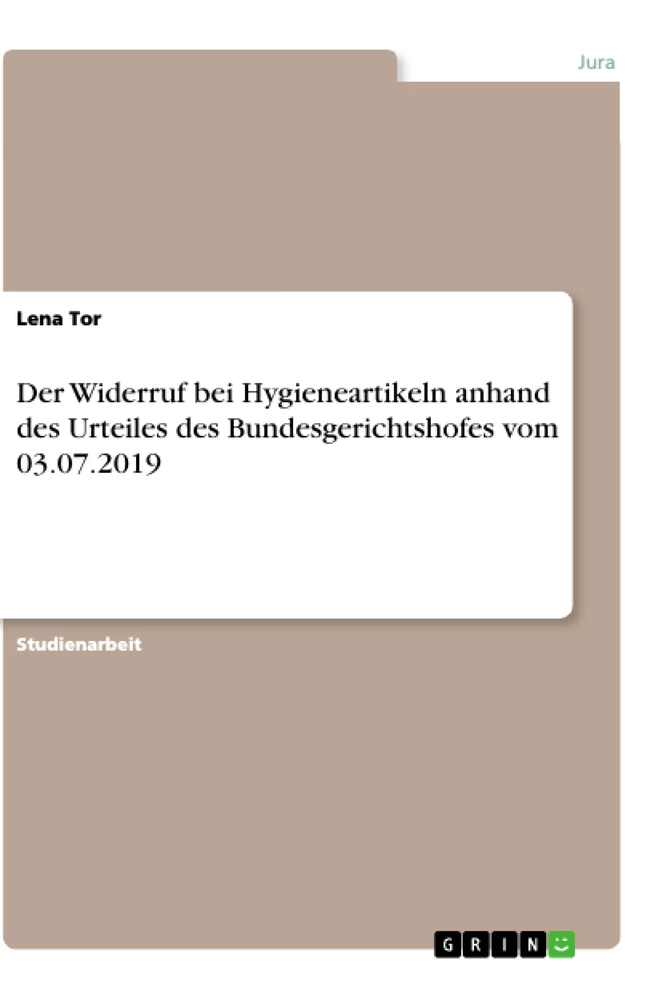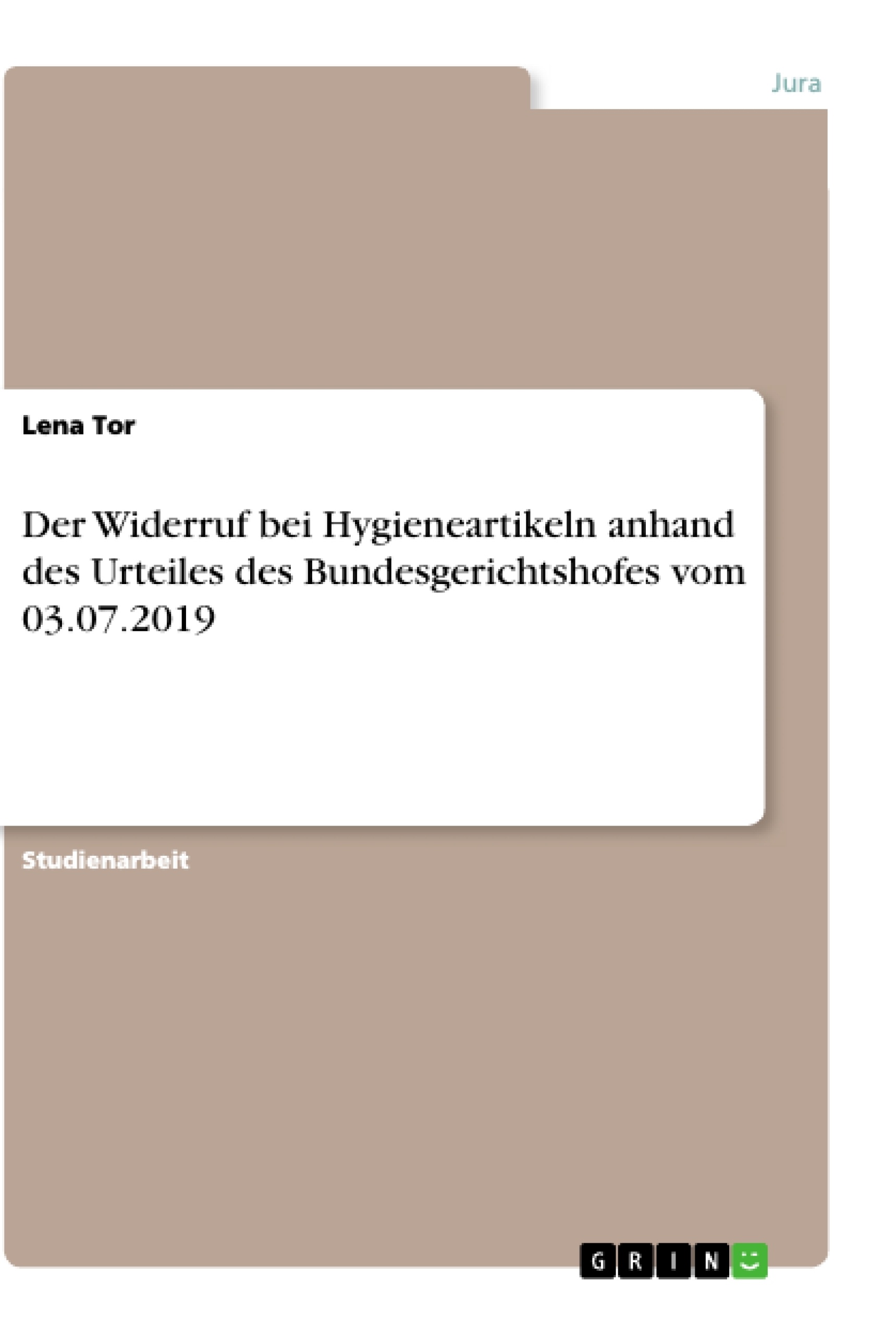Diese Seminararbeit befasst sich mit dem Widerruf bei Hygieneartikeln am Beispiel des Urteils des Bundesgerichtshofes vom 03.07.2019 (VIII ZR 194/16). Der § 312g BGB setzt die „20. Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2011 über die Rechte der Verbraucher“ (hier: Verbraucherrechterichtlinie), welche bei Vertragsschlüssen ab Juni 2014 gilt, um. Der § 312g II Nr. 1 – 13 BGB im speziellen schränkt das gesetzliche Widerrufsrecht von Verbrauchern bei Fernabsatzverträgen ein und erläutert die Ausnahmetatbestände, die als solche wortgleich aus der EU-Verbraucherrechterichtlinie übernommen wurden.
Der Begriff des Fernabsatzvertrages ist in § 312c I BGB legaldefiniert. In §312g II Nr. 3 BGB ist der Ausnahmetatbestand für Gesundheits- und Hygieneartikel geregelt. Wie auch im BGH-Urteil ist die Frage nach der Definition von Waren, die unter diesen Paragraphen fallen, immer wieder Thema in Gerichtsverhandlungen und Diskussionsgegenstand in der Literatur. Dies liegt unter anderem daran, dass in der Verbraucherrechterichtlinie zwar Beispiele für Waren, die als Hygieneprodukte anzusehen sind oder durch ihre Beschaffenheit aus gesundheitlichen Gründen nach Entfernung der Schutzfolie nicht mehr weiterzuverkaufen wären genannt sind, aber keine Legaldefinition für den Begriff der Versiegelung existiert. Auch bei der Umsetzung der Richtlinie ins BGB wurde dieser Begriff nicht weiter definiert. Es ist allerdings so, dass eine Versiegelung als solche nicht durch explizite Warnhinweise gekennzeichnet sein muss.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung in die Thematik
- 2 Der Widerruf nach § 312g BGB
- 2.1 Zweck der Norm
- 2.1.1 Reformation im Sinne der EU-Verbraucherrechterichtlinie
- 2.1.2 Schutzgedanke
- 2.1.3 Ausschlussgründe
- 2.1 Zweck der Norm
- 3 Darstellung des Falls
- 4 Relevante Normen
- 5 Hygieneprodukte
- 6 Kritik am Widerruf als Transferaufgabe
- 7 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert das Widerrufsrecht bei Hygieneartikeln im Kontext des BGH-Urteils vom 03.07.2019 (VIII ZR 194/16) und § 312g BGB. Die Arbeit untersucht die Umsetzung der EU-Verbraucherrechterichtlinie im deutschen Recht und beleuchtet die damit verbundenen Herausforderungen und Auslegungsprobleme, insbesondere im Hinblick auf die Definition von Hygieneartikeln und die Ausnahmetatbestände vom Widerrufsrecht.
- Umsetzung der EU-Verbraucherrechterichtlinie in Bezug auf das Widerrufsrecht
- Definition von Hygieneartikeln gemäß § 312g II Nr. 3 BGB
- Auslegung der Ausnahmetatbestände vom Widerrufsrecht
- Verbraucherschutz und Interessenabwägung zwischen Verbraucher und Unternehmer
- Juristische Bewertung des BGH-Urteils
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einführung in die Thematik: Diese Einführung stellt den Kontext der Seminararbeit dar, indem sie das BGH-Urteil vom 03.07.2019 (VIII ZR 194/16) als zentralen Bezugspunkt nennt und den § 312g BGB als Umsetzung der EU-Verbraucherrechterichtlinie erklärt. Es wird die Problematik der Definition von Hygieneartikeln und die damit verbundenen Auslegungsschwierigkeiten im Recht und der Literatur hervorgehoben. Die Arbeit fokussiert auf die Frage, welche Waren unter den Ausnahmetatbestand des § 312g II Nr. 3 BGB fallen und wie der Begriff der Versiegelung juristisch zu verstehen ist. Die Unklarheiten in der Richtlinie und deren Umsetzung im BGB werden als zentrale Forschungsfrage identifiziert.
2 Der Widerruf nach § 312g BGB: Dieses Kapitel behandelt den Widerruf nach § 312g BGB im Detail. Es erläutert den Zweck der Norm, der darin besteht, ein hohes Verbraucherschutzniveau zu gewährleisten und die strukturelle Unterlegenheit des Verbrauchers gegenüber dem Unternehmer auszugleichen, gleichzeitig aber die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmers zu wahren. Der erweiterte Schutz für Verbraucher bei Fernabsatzverträgen wird erklärt, sowie die Bedeutung der 14-tägigen Widerrufsfrist. Der Kapitel behandelt zudem die Anpassung des deutschen Rechts an die EU-Verbraucherrechterichtlinie und deren Ziel der europaweiten Harmonisierung des Verbraucherschutzes. Es werden die Neuerungen im deutschen Verbraucherrecht wie die erweiterte Informationspflicht der Unternehmer und die Änderungen bei Fernabsatzgeschäften erläutert. Schließlich werden die Ausschlussgründe des Widerrufsrechts nach § 312g II Nr. 1-13 BGB diskutiert.
Schlüsselwörter
Widerruf, Hygieneartikel, § 312g BGB, EU-Verbraucherrechterichtlinie, Verbraucherschutz, Fernabsatzvertrag, BGH-Urteil, Versiegelung, Ausnahmetatbestände, Rechtsauslegung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Widerrufsrecht bei Hygieneartikeln
Was ist der Gegenstand der Seminararbeit?
Die Seminararbeit analysiert das Widerrufsrecht bei Hygieneartikeln im Kontext des BGH-Urteils vom 03.07.2019 (VIII ZR 194/16) und § 312g BGB. Sie untersucht die Umsetzung der EU-Verbraucherrechterichtlinie im deutschen Recht und die damit verbundenen Herausforderungen und Auslegungsprobleme, insbesondere bezüglich der Definition von Hygieneartikeln und der Ausnahmetatbestände vom Widerrufsrecht.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Umsetzung der EU-Verbraucherrechterichtlinie in Bezug auf das Widerrufsrecht; Definition von Hygieneartikeln gemäß § 312g II Nr. 3 BGB; Auslegung der Ausnahmetatbestände vom Widerrufsrecht; Verbraucherschutz und Interessenabwägung zwischen Verbraucher und Unternehmer; Juristische Bewertung des BGH-Urteils; Zweck und Schutzgedanke von § 312g BGB; Ausschlussgründe des Widerrufsrechts.
Was ist die zentrale Forschungsfrage der Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage ist die Klärung, welche Waren unter den Ausnahmetatbestand des § 312g II Nr. 3 BGB fallen und wie der Begriff der Versiegelung juristisch zu verstehen ist. Die Unklarheiten in der Richtlinie und deren Umsetzung im BGB werden als zentrale Problematik identifiziert.
Wie wird der Widerruf nach § 312g BGB in der Arbeit behandelt?
Das Kapitel zum Widerruf nach § 312g BGB erläutert detailliert den Zweck der Norm (hohes Verbraucherschutzniveau, Ausgleich der strukturellen Unterlegenheit des Verbrauchers), den erweiterten Schutz bei Fernabsatzverträgen, die 14-tägige Widerrufsfrist, die Anpassung des deutschen Rechts an die EU-Verbraucherrechterichtlinie und die damit verbundene Harmonisierung des Verbraucherschutzes. Es werden auch die Neuerungen im deutschen Verbraucherrecht (erweiterte Informationspflicht, Änderungen bei Fernabsatzgeschäften) und die Ausschlussgründe des Widerrufsrechts nach § 312g II Nr. 1-13 BGB diskutiert.
Welche Rolle spielt das BGH-Urteil vom 03.07.2019 (VIII ZR 194/16)?
Das BGH-Urteil vom 03.07.2019 (VIII ZR 194/16) dient als zentraler Bezugspunkt der Seminararbeit und bildet den Kontext für die Analyse des Widerrufsrechts bei Hygieneartikeln. Die Arbeit untersucht die juristische Bewertung dieses Urteils im Hinblick auf die Auslegung von § 312g BGB.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Widerruf, Hygieneartikel, § 312g BGB, EU-Verbraucherrechterichtlinie, Verbraucherschutz, Fernabsatzvertrag, BGH-Urteil, Versiegelung, Ausnahmetatbestände, Rechtsauslegung.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit?
Die Seminararbeit umfasst Kapitel zu folgenden Themen: Einführung in die Thematik; Der Widerruf nach § 312g BGB (inkl. Zweck der Norm, Schutzgedanke, Ausschlussgründe); Darstellung des Falls; Relevante Normen; Hygieneprodukte; Kritik am Widerruf als Transferaufgabe; Fazit.
- Citation du texte
- Lena Tor (Auteur), 2019, Der Widerruf bei Hygieneartikeln anhand des Urteiles des Bundesgerichtshofes vom 03.07.2019, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/583690