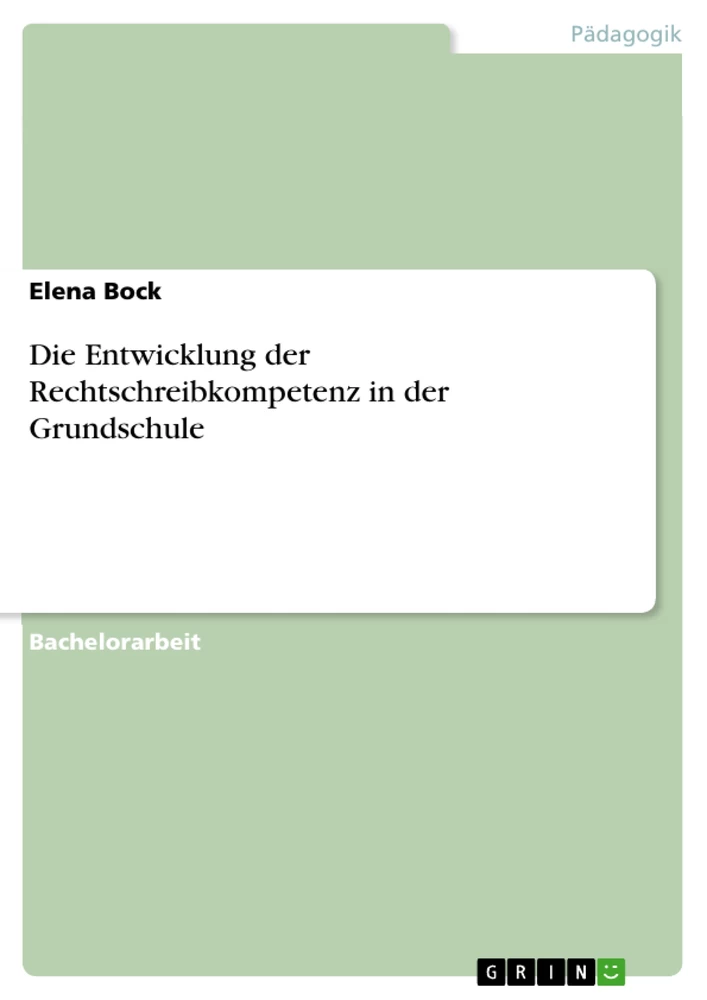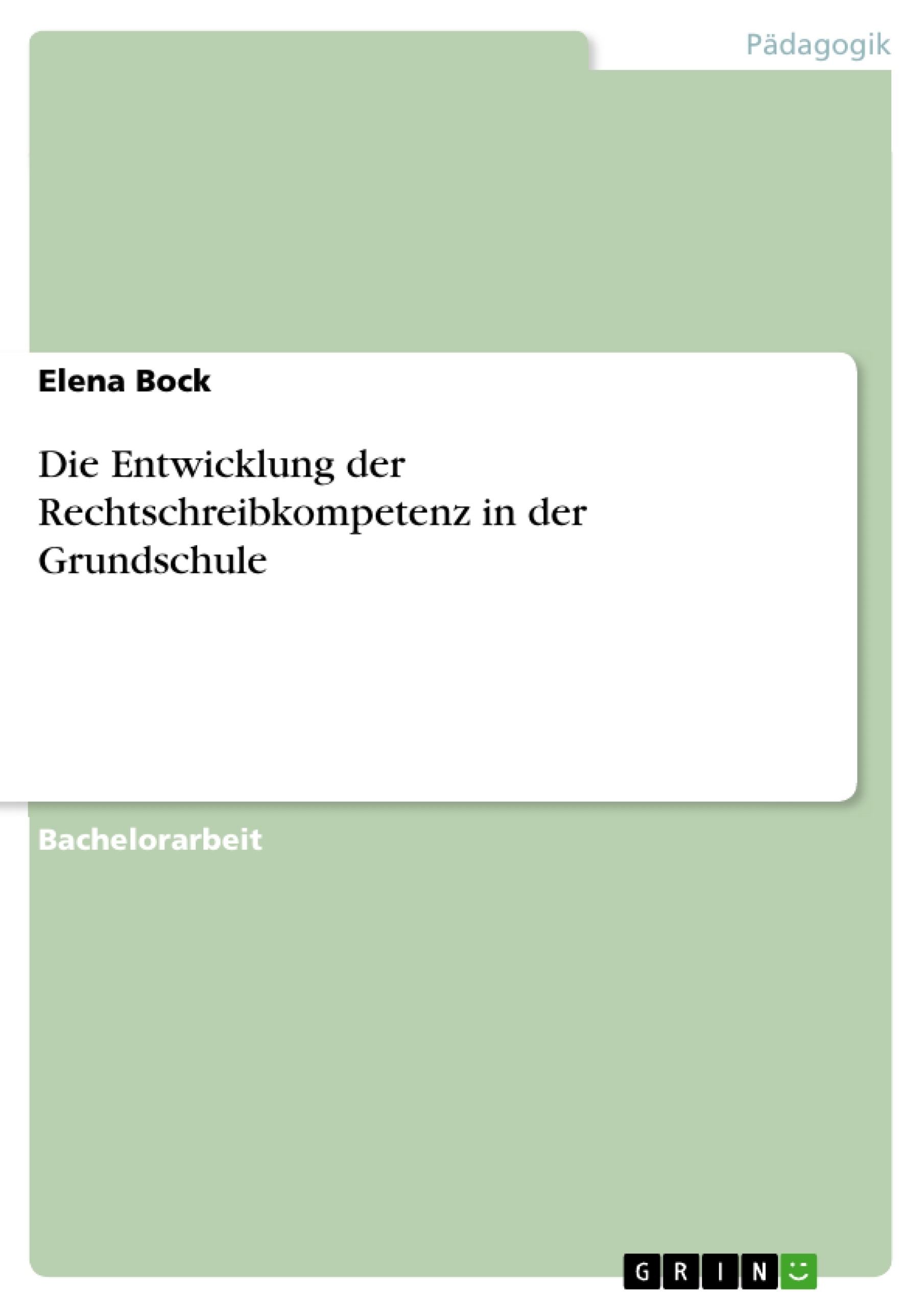In dieser Arbeit soll zunächst geklärt werden, was unter Rechtschreibung zu verstehen ist, wer sich mit ihr beschäftigt und wie es dazu kommt, dass bestimmte, ausgewählte Schreibungen unter den Terminus Rechtschreibung fallen. Diese Schreibungen, die normiert und daher verbindlich sind, werden als orthografische Prinzipien genauer betrachtet und erläutert. Bevor fokussiert wird, wie Rechtschreibkompetenz im Unterricht ausgebildet und gefördert werden kann, wird der Orthografieerwerb innerhalb der Grundschule thematisiert. Hierfür wird zunächst das Zwei-Wege-Modell des Rechtschreibens erläutert. Des Weiteren werden zwei Modellierungen dargestellt, die den Versuch einer Phasenunterteilung des Rechtschreiberwerbs vornehmen.
Des Weiteren wird der Rechtschreibunterricht des Deutschen fokussiert. Es wird erklärt, was unter Rechtschreibkompetenz zu verstehen ist, welche konkreten Fähigkeiten sie umfasst und welche konkreten Vorgaben der Bildungsplan in sich zu dieser Thematik verankert. Daneben wird der Rechtschreibrahmen der Kultusministerkonferenz erläutert, um die verbindlichen Vorgaben, die für den Unterricht vorgesehen sind, herauszustellen. Im Anschluss werden didaktische Konzeptionen thematisiert. Hierfür wurden sechs, für die Grundschule relevante, Konzeptionen ausgewählt und kritisch betrachtet. Dies wird mit Forschungsergebnissen einer aktuellen Studie in Verbindung gesetzt, die sich mit dem Erwerb der Rechtschreibkompetenz auseinandersetze und dabei eine Methoden-Diskussion auslöste. Einzelne Standpunkte werden an dieser Stelle ausgeführt, um einen Überblick über die Debatte zu geben.
Die Beherrschung der deutschen Rechtschreibung ist in unserer heutigen Gesellschaft nicht wegzudenken. Besonders in der Grundschule wird, neben der Ausbildung einer persönlichen Handschrift, auf die Entwicklung und Ausbildung einer soliden Rechtschreibkompetenz von Schülern gezielt, was ein wichtiges und anzustrebendes Ziel deutscher Lehrkräfte darstellt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Was ist Rechtschreibung?
- 2.1. Prinzipien der deutschen Rechtschreibung
- 3. Rechtschreiberwerb
- 3.1. Das Zwei-Wege-Modell des Rechtschreibens
- 3.2. Der Rechtschreiberwerb nach Scheerer-Neumann und Thomé
- 4. Rechtschreibdidaktik im Deutschunterricht der Grundschule
- 4.1. Zum Begriff der „Rechtschreibkompetenz“
- 4.2. Der Rechtschreibrahmen: Zielsetzungen und Orientierungen
- 4.3. Didaktische Konzeptionen
- 4.3.1. Grundwortschatzkonzepte
- 4.3.2. Regelkonzepte
- 4.3.3. Silbenkonzepte
- 4.3.4. Spracherfahrungsansatz
- 4.3.5. Analytisch-synthetische Verfahren
- 4.3.6. Phonographisch orientierter Rechtschreibunterricht
- 5. Aktueller Diskurs: Die Bonner Studie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit gibt einen Überblick über die Entwicklung der Rechtschreibkompetenz in der Grundschule. Sie beleuchtet die Definition von Rechtschreibung, den Erwerbsprozess und verschiedene didaktische Konzeptionen im Unterricht. Ein aktueller Diskurs um die Bonner Studie und deren Auswirkungen auf den Rechtschreibunterricht wird ebenfalls behandelt.
- Definition und Prinzipien der deutschen Rechtschreibung
- Kognitive Prozesse des Rechtschreibens und Modelle des Rechtschreiberwerbs
- Didaktische Konzeptionen im Rechtschreibunterricht der Grundschule
- Der Rechtschreibrahmen der Kultusministerkonferenz
- Auswirkungen der Bonner Studie auf den aktuellen Diskurs
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Arbeit führt in das Thema der Rechtschreibkompetenz in der Grundschule ein und skizziert den Aufbau der Arbeit. Sie betont die Bedeutung fehlerfreien Schreibens in verschiedenen Lebensbereichen und die zentrale Rolle der Grundschule bei der Entwicklung dieser Kompetenz.
2. Was ist Rechtschreibung?: Dieses Kapitel definiert den Begriff Rechtschreibung und Orthographie. Es diskutiert die Bedeutung von Normen und Regelwerken für die korrekte Schreibweise und beleuchtet den Einfluss von Faktoren wie Textsorte und Adressat auf die Anwendung orthographischer Regeln. Der hohe gesellschaftliche Stellenwert von Rechtschreibung wird ebenfalls hervorgehoben.
2.1. Prinzipien der deutschen Rechtschreibung: Der Abschnitt beschreibt die Prinzipien der deutschen Rechtschreibung, darunter das phonographische, silbische, morphologische und syntaktische Prinzip. Er vergleicht die vereinfachte Darstellung von Hochstadt, Krafft und Olsen mit der detaillierteren Ausführung von Risel, wobei der Schwerpunkt auf dem Verständnis der Prinzipien und deren Anwendung liegt.
3. Rechtschreiberwerb: Dieses Kapitel behandelt den Erwerbsprozess der Rechtschreibung. Es beginnt mit einer Klärung des Begriffs „Schreiben“ und der untrennbaren Verbindung zum Lesen. Der Erwerb der formalen und funktionalen Aspekte der Schrift wird erläutert.
3.1. Das Zwei-Wege-Modell des Rechtschreibens: Der Abschnitt erklärt das Zwei-Wege-Modell des Rechtschreibens nach Augst und Dehn, das den Rechtschreibprozess als Wechselspiel zwischen dem Abruf von Schreibschemata und der phonologischen Übersetzung beschreibt. Die Herausforderungen des deutschen Schriftsystems, mit seiner hohen Anzahl an Phonemen und orthographischen Besonderheiten, werden verdeutlicht.
3.2. Der Rechtschreiberwerb nach Scheerer-Neumann und Thomé: Hier werden die Phasenmodelle des Rechtschreiberwerbs nach Scheerer-Neumann und Thomé dargestellt und verglichen. Die verschiedenen Stufen der Rechtschreibentwicklung werden detailliert beschrieben und anhand von Beispielen verdeutlicht. Die Stärken und Schwächen beider Modelle werden kritisch diskutiert.
4. Rechtschreibdidaktik im Deutschunterricht der Grundschule: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die didaktischen Aspekte des Rechtschreibunterrichts. Der Begriff der Rechtschreibkompetenz wird definiert, und es werden verschiedene Teilkompetenzen benannt, die im Unterricht gefördert werden müssen.
4.1. Zum Begriff der „Rechtschreibkompetenz“: Der Abschnitt präzisiert den Begriff der Rechtschreibkompetenz und erläutert die verschiedenen Teilkompetenzen, die sie umfasst. Die Bedeutung von Automatisierung, Strategien und Fehlersensibilität wird hervorgehoben.
4.2. Der Rechtschreibrahmen: Zielsetzungen und Orientierungen: Hier wird der Rechtschreibrahmen der Kultusministerkonferenz (KMK) als verbindliche Grundlage für den Deutschunterricht vorgestellt. Seine Zielsetzungen, Orientierungen und didaktischen Hinweise für die Unterrichtsgestaltung werden erläutert. Die Unterscheidung zwischen regelgeleiteten und Merkschreibungen wird als wichtig für die Auswahl geeigneter Lernstrategien hervorgehoben.
4.3. Didaktische Konzeptionen: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene didaktische Konzeptionen für den Rechtschreibunterricht in der Grundschule. Es werden Grundwortschatzkonzepte, Regelkonzepte, Silbenkonzepte, der Spracherfahrungsansatz, analytisch-synthetische Verfahren und der phonographisch orientierte Rechtschreibunterricht beschrieben und kritisch bewertet.
4.3.1. Grundwortschatzkonzepte: Die Zusammenfassung beschreibt Grundwortschatzkonzepte und deren Fokus auf das Auswendiglernen von Wortformen. Die Vorteile und Nachteile dieser Konzepte werden diskutiert, insbesondere die Kritik an der Vernachlässigung von Regelkenntnissen und der potenziellen Überforderung von Schülern.
4.3.2. Regelkonzepte: Dieser Abschnitt behandelt Regelkonzepte im Rechtschreibunterricht. Die verschiedenen Arten von Regeln (Eigenregeln, Fremdregeln, Faustregeln) werden erläutert, und die Herausforderungen bei der Anwendung von Regeln im Unterricht werden diskutiert.
4.3.3. Silbenkonzepte: Die Zusammenfassung beschreibt verschiedene Silbenkonzepte, darunter intuitive Ansätze wie die Buschmann-Methode und elaborierte, theoriebezogene Konzepte. Die Verwendung von Häusermodellen zur Visualisierung von Silbenstrukturen wird erläutert.
4.3.4. Spracherfahrungsansatz: Hier wird der Spracherfahrungsansatz vorgestellt, der den Fokus auf die Schaffung einer anregungsreichen Lernumgebung und die Förderung des selbstständigen Schreibens legt. Die ABC-Landschaft nach Brinkmann wird als Beispiel für die praktische Umsetzung dieses Ansatzes beschrieben.
4.3.5. Analytisch-synthetische Verfahren: Der Abschnitt behandelt analytisch-synthetische Verfahren im Schriftspracherwerb, einschließlich der Rolle der Fibel und der Kritik an diesem Ansatz. Die Vor- und Nachteile dieser Methode werden diskutiert.
4.3.6. Phonographisch orientierter Rechtschreibunterricht: Die Zusammenfassung beschreibt den phonographisch orientierten Rechtschreibunterricht, einschließlich der Methode „Lesen durch Schreiben“. Die Vorteile und Nachteile dieser Methode werden im Detail diskutiert, insbesondere die Herausforderungen in Bezug auf die Berücksichtigung orthographischer Regeln und die Berücksichtigung von individuellen Lernvoraussetzungen.
5. Aktueller Diskurs: Die Bonner Studie: Dieses Kapitel analysiert die Ergebnisse der Bonner Studie zum Rechtschreiberwerb und den daraus resultierenden Diskurs. Die Kritik an der Studie und deren Auswirkungen auf den Rechtschreibunterricht werden detailliert dargestellt.
Schlüsselwörter
Rechtschreibkompetenz, Rechtschreiberwerb, Rechtschreibdidaktik, Grundschule, Deutschunterricht, Orthographie, Prinzipien der Rechtschreibung, Didaktische Konzeptionen, Bonner Studie, Methodenvielfalt.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Entwicklung der Rechtschreibkompetenz in der Grundschule
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Der Text bietet einen umfassenden Überblick über die Entwicklung der Rechtschreibkompetenz in der Grundschule. Er behandelt die Definition von Rechtschreibung, den Erwerbsprozess, verschiedene didaktische Konzeptionen im Unterricht und den aktuellen Diskurs um die Bonner Studie und deren Auswirkungen auf den Rechtschreibunterricht. Der Text enthält ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Der Text beleuchtet folgende Schwerpunkte: Definition und Prinzipien der deutschen Rechtschreibung, kognitive Prozesse des Rechtschreibens und Modelle des Rechtschreiberwerbs (u.a. das Zwei-Wege-Modell und die Modelle von Scheerer-Neumann und Thomé), didaktische Konzeptionen im Rechtschreibunterricht der Grundschule (inkl. Grundwortschatzkonzepte, Regelkonzepte, Silbenkonzepte, Spracherfahrungsansatz, analytisch-synthetische Verfahren und phonographisch orientierter Unterricht), den Rechtschreibrahmen der Kultusministerkonferenz und die Auswirkungen der Bonner Studie auf den aktuellen Diskurs.
Welche didaktischen Konzeptionen werden im Text vorgestellt?
Der Text beschreibt und bewertet kritisch verschiedene didaktische Konzeptionen für den Rechtschreibunterricht: Grundwortschatzkonzepte (Auswendiglernen von Wörtern), Regelkonzepte (Anwendung von Rechtschreibregeln), Silbenkonzepte (Fokus auf Silbenstruktur), den Spracherfahrungsansatz (anregungsreiche Lernumgebung), analytisch-synthetische Verfahren (Zerlegung und Zusammensetzung von Wörtern) und den phonographisch orientierten Rechtschreibunterricht (Verbindung von Lauten und Buchstaben).
Welche Rolle spielt die Bonner Studie?
Die Bonner Studie und deren Ergebnisse bilden einen zentralen Bestandteil des Textes. Der Text analysiert die Studie, ihre Kritikpunkte und die Auswirkungen auf den aktuellen Diskurs und die Praxis des Rechtschreibunterrichts in der Grundschule.
Was versteht der Text unter „Rechtschreibkompetenz“?
Der Text definiert „Rechtschreibkompetenz“ und beschreibt die verschiedenen Teilkompetenzen, die sie umfasst. Hierzu gehören u.a. die Automatisierung orthographischer Regeln, die Anwendung von Rechtschreibstrategien und die Sensibilität für eigene Rechtschreibfehler.
Welche Prinzipien der deutschen Rechtschreibung werden erläutert?
Der Text beschreibt die Prinzipien der deutschen Rechtschreibung, wie das phonographische, silbische, morphologische und syntaktische Prinzip. Es wird ein Vergleich zwischen vereinfachten und detaillierteren Darstellungen dieser Prinzipien vorgenommen.
Für wen ist dieser Text gedacht?
Der Text richtet sich an Personen, die sich im akademischen Kontext mit der Entwicklung der Rechtschreibkompetenz in der Grundschule auseinandersetzen, z.B. Lehramtsstudierende, Lehrkräfte, Wissenschaftler und alle, die an der Verbesserung des Rechtschreibunterrichts interessiert sind.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Text?
Schlüsselwörter sind: Rechtschreibkompetenz, Rechtschreiberwerb, Rechtschreibdidaktik, Grundschule, Deutschunterricht, Orthographie, Prinzipien der Rechtschreibung, Didaktische Konzeptionen, Bonner Studie, Methodenvielfalt.
- Arbeit zitieren
- Elena Bock (Autor:in), 2020, Die Entwicklung der Rechtschreibkompetenz in der Grundschule, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/583746