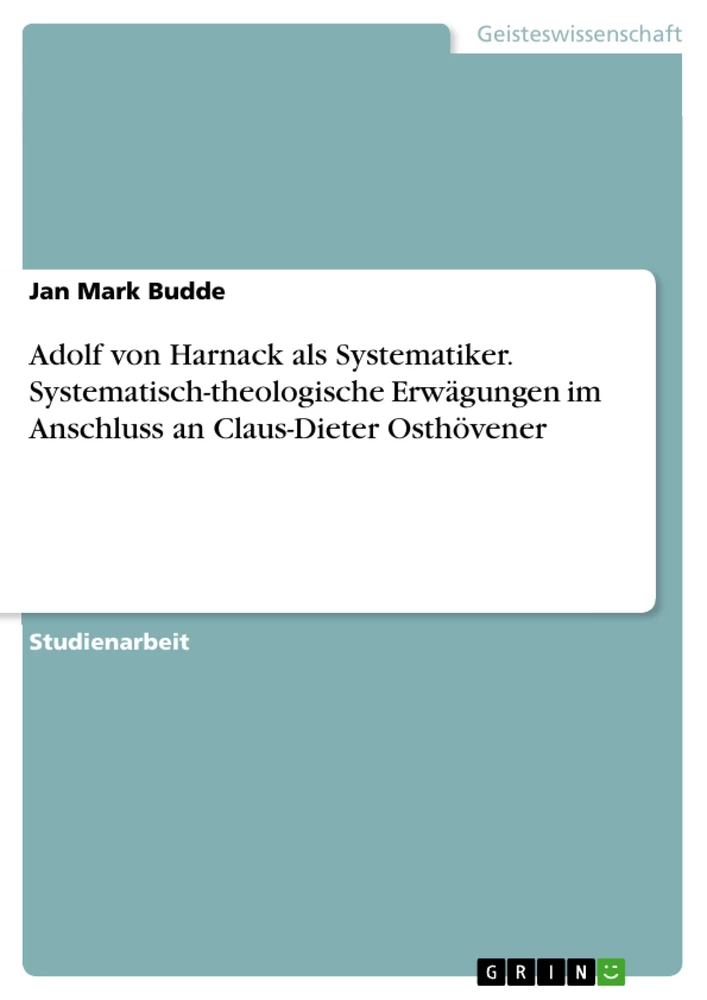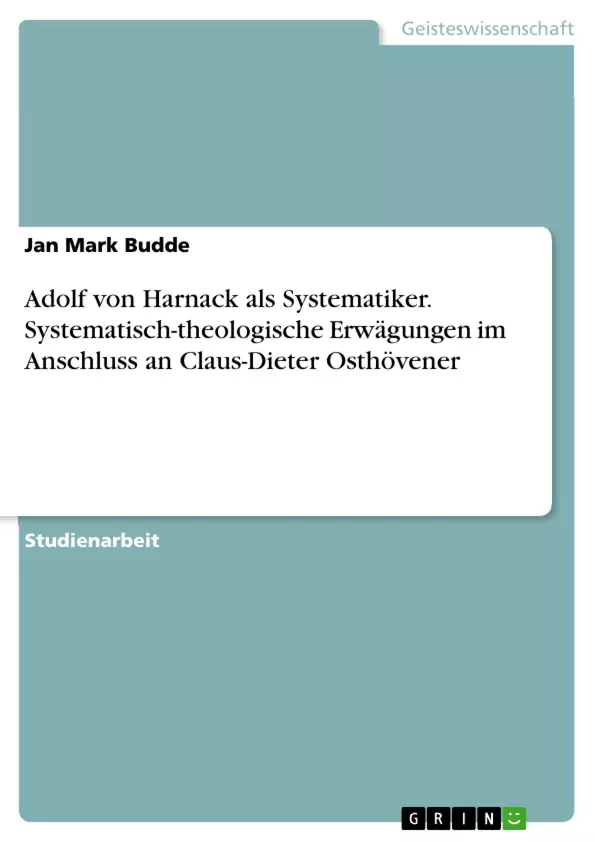Claus-Dieter Osthövener hielt am 7. Mai 2001, dem 150. Geburtstag Adolf von Harnacks, eine Antrittsvorlesung mit dem Titel „Adolf von Harnack als Systematiker“, die er ein Jahr später in redigierter Fassung als Aufsatz publizierte. Ausgehend von diesem Aufsatz und auf der Basis seines wohl bedeutendsten systematischen Werkes, „Das Wesen des Christentums“ (1900), möchte ich im Rahmen dieser Hauptseminararbeit im Fach Systematik die Bedeutung von Harnacks Wirken für die Systematische Theologie herausstellen und damit einen Beitrag zur systematisch-theologischen Erforschung des theologischen Werkes Harnacks leisten. In einem abschließenden Resümee möchte ich dann schließlich die kritische Frage klären, ob Adolf von Harnack nicht heutzutage vielmehr auch als Systematiker in den Blick genommen werden müsste als nur in seiner oft wahrgenommenen Funktion als Dogmenhistoriker und Patristiker. Die außerordentlich guten Gedanken von Claus-Dieter Osthövener möchte ich dabei fortführen und in dieser Arbeit systematisch-theologische Erwägungen anstellen, die zu einer interdisziplinären Erforschung des Harnackschen Werkes von Kirchenhistorikern und Systematikern und zu einer Neuauflage der Harnack-Forschung im 21. Jahrhundert anregen wollen.
Karl Gustav Adolf Harnack, ab 1914 von Harnack (* 7. Mai 1851 in Dorpat; † 10. Juni 1930 in Heidelberg) gilt als einer der bedeutendsten Dogmenhistoriker auf der Schwelle vom 19. zum 20. Jahrhundert und als einer der einflussreichsten protestantischen Theologen seiner Zeit. Zudem hatte er bedeutenden Einfluss auf das wissenschaftliche und kulturelle Leben in Preußen und fungierte als Wissenschaftsorganisator unter Kaiser Wilhelm II. Er leistete auch außerordentliche Beiträge zur theologischen Wissenschaft. Oftmals überließ man innerhalb der protestantischen Wissenschaft des 20. Jahrhunderts die Erforschung des theologischen Wirkens Adolf von Harnacks der Kirchengeschichte. Zahlreiche bedeutende Kirchenhistoriker wie beispielsweise Kurt Nowak, Wolfram Kinzig oder Kurt-Victor Selge haben sich in der jüngeren Vergangenheit bereits mit dem Werk Harnacks befasst, wohingegen dieses seitens der Systematischen Theologie bisweilen nur zu gewissen Teilen eingehend untersucht wurde (so u. a. von Gunther Wenz, Trutz Rendtorff und in jüngster Zeit von Claus-Dieter Osthövener).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kurzer biographischer Abriss zu Leben und Werk Harnacks..
- Kindheit und Jugend……………………
- Theologischer und beruflicher Werdegang..
- Adolf von Harnack als Wissenschaftsorganisator in Preußen
- Politisches Engagement unter Kaiser Wilhelm II.
- Theologisches Werk und Vermächtnis
- Das dreibändige „Lehrbuch der Dogmengeschichte“ (1886-1890)...
- ,,Das Wesen des Christentums“ (1900) als epochales Werk.....
- Die Harnack-Forschung im 20. Jahrhundert.......
- Adolf von Harnacks Bedeutung für die theologische Wissenschaft.
- Neues Testament
- Kirchen- und Theologiegeschichte...
- Systematische Theologie.....
- Claus Dieter-Osthövener: Adolf von Harnack als Systematiker (2002).
- Resümee: Adolf von Harnack – ein Systematiker?..\n
- Literaturverzeichnis.....
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hauptseminararbeit im Fach Systematik zielt darauf ab, die Bedeutung von Adolf von Harnacks Wirken für die Systematische Theologie herauszustellen und damit einen Beitrag zur systematisch-theologischen Erforschung seines Werkes zu leisten. Ausgehend von Claus-Dieter Osthöveners Aufsatz „Adolf von Harnack als Systematiker“ (2002) und auf der Basis von Harnacks Werk „Das Wesen des Christentums“ (1900), werden systematisch-theologische Erwägungen angestellt, die zu einer interdisziplinären Erforschung des Harnackschen Werkes durch Kirchenhistoriker und Systematiker anregen sollen.
- Adolf von Harnacks systematische Ansätze in „Das Wesen des Christentums“
- Die Rezeption von Harnacks systematischen Ideen in der jüngeren theologischen Forschung
- Die Bedeutung von Harnacks Werk für die Systematische Theologie im 21. Jahrhundert
- Harnacks Einfluss auf die Entwicklung der Theologiegeschichte und der Dogmengeschichte
- Harnacks Rolle als Wissenschaftsorganisator und seine Auswirkungen auf das wissenschaftliche und kulturelle Leben in Preußen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einleitung in die Arbeit und stellt den Fokus auf Adolf von Harnacks Bedeutung für die Systematische Theologie dar. Im zweiten Kapitel wird ein kurzer biographischer Abriss über Harnacks Leben und Werk gegeben, der seine Kindheit und Jugend, seinen theologischen und beruflichen Werdegang sowie sein politisches Engagement unter Kaiser Wilhelm II. umfasst.
Kapitel 3 beleuchtet Harnacks dreibändiges Lehrbuch der Dogmengeschichte (1886-1890), während Kapitel 4 sich auf sein epochales Werk „Das Wesen des Christentums“ (1900) konzentriert. Kapitel 5 gibt einen Überblick über die Harnack-Forschung im 20. Jahrhundert.
Kapitel 6 analysiert die Bedeutung von Harnacks Werk für die theologische Wissenschaft, insbesondere in Bezug auf das Neue Testament, die Kirchen- und Theologiegeschichte sowie die Systematische Theologie.
Schlüsselwörter
Adolf von Harnack, Systematische Theologie, Dogmengeschichte, „Das Wesen des Christentums“, „Lehrbuch der Dogmengeschichte“, Kirchen- und Theologiegeschichte, Wissenschaftsorganisator, Kaiser Wilhelm II., Protestantische Theologie, Neuauflage der Harnack-Forschung, interdisziplinäre Erforschung
Häufig gestellte Fragen
Wer war Adolf von Harnack?
Adolf von Harnack (1851-1930) war ein bedeutender deutscher Theologe, Dogmenhistoriker und Wissenschaftsorganisator unter Kaiser Wilhelm II.
Warum wird Harnack in dieser Arbeit als "Systematiker" untersucht?
Obwohl er meist als Kirchenhistoriker wahrgenommen wird, analysiert die Arbeit seine systematisch-theologischen Ansätze, insbesondere in seinem Werk „Das Wesen des Christentums“.
Welches Werk Harnacks gilt als besonders epochal?
Sein Werk „Das Wesen des Christentums“ aus dem Jahr 1900 wird als zentral für seine systematischen Überlegungen herangezogen.
Welchen Einfluss hatte Harnack auf die Wissenschaftsorganisation?
Harnack war ein einflussreicher Berater in Preußen und trug maßgeblich zur Gestaltung des wissenschaftlichen und kulturellen Lebens bei.
Was ist das Ziel der interdisziplinären Harnack-Forschung?
Ziel ist es, Kirchenhistoriker und Systematiker für eine gemeinsame Erforschung seines komplexen Werkes im 21. Jahrhundert anzuregen.
- Arbeit zitieren
- Jan Mark Budde (Autor:in), 2020, Adolf von Harnack als Systematiker. Systematisch-theologische Erwägungen im Anschluss an Claus-Dieter Osthövener, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/584024