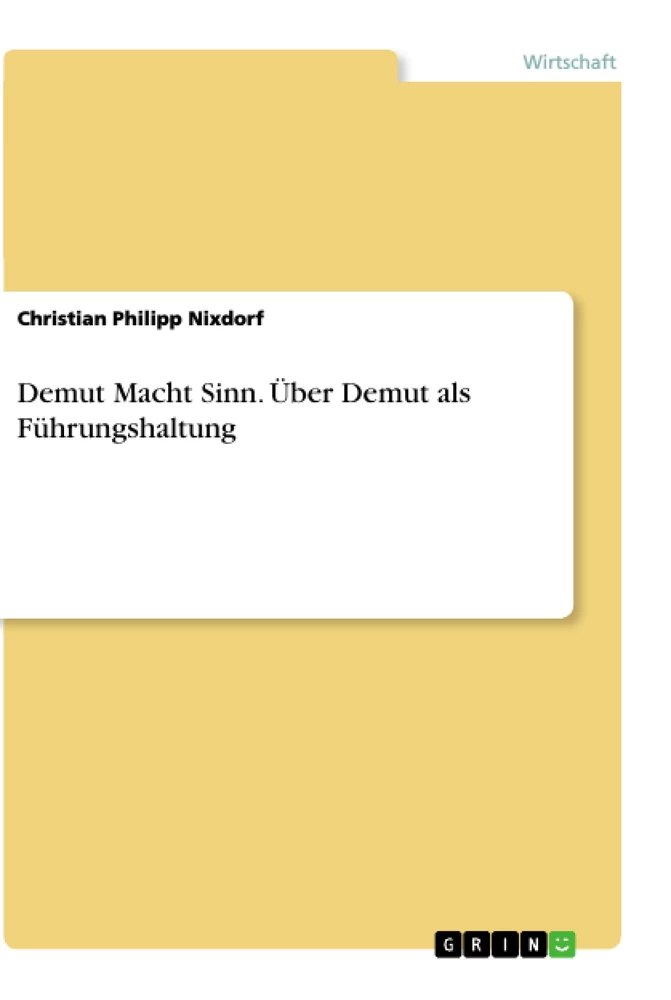Demut ist ein Zeitgeist-Phänomen. Längst nicht mehr nur Theologen und religiöse Menschen setzen sich mit dem Wert der Demut auseinander. Manager, Unternehmensberater und Coaches tun es genauso. Galt plakativ zur Schau gestelltes Gewinnstreben in den 1980er Jahren in Managementkreisen noch als sozial akzeptiert, kann man heute eher mit proklamierter Demut punkten. Demut ist, so liest man in diversen Management-Ratgebern, heute eine jener Voraussetzungen, derer es bedarf, um eine Kultur der Menschenwürde in Organisationen zu etablieren und zu leben. Demut schützt eine Führungskraft davor, übermütig zu werden und sich deutlich zu überschätzen. Demut erdet, was einem Unternehmen dienlich sein kann. Wer demütig ist, wird auch eher geneigt sein, seinen Mitmenschen mit Respekt zu begegnen und deren Expertise anzunehmen. Wer demütig führt, gesteht sich Fehler ein. Er trägt so entscheiden dazu bei, dass eine Kultur der Fehlerfreundlichkeit gelebt wird. Wenn Mitarbeiter ihre Führungskraft als demütig und fehlertolerant erleben, werden sie eher geneigt sein, ebenfalls Fehler einzuräumen. In einer globalisierten Welt, in der Unternehmen weltweit konkurrieren, ist das essenziell, da es Innovationen befördert. Kurzum kann es von Vorteil zu sein, mehr Demut zu zeigen. Aber es gibt auch manche Nachteile. Dass man es auch mit Hochmut sehr weit bringen kann, beweist Donald Trump schließlich tagtäglich. Und noch etwas stimmt im Hinblick auf die Demut nachdenklich: Wie echt ist Demut, so ließe sich fragen, wenn Unternehmen sich ihrer im Kontext von Corporate-Social-Responsibility-Bekundungen primär deshalb bedienen, weil es dem eigenen Image dienlich ist. Ist das dann wirklich Demut, oder ist es nur Legitimationskitsch, mithin also Heuchelei? Und wenn Letzteres zutrifft, ist das schlimm? Und warum eigentlich? Darum geht es im Text.
Inhalt
Ein Zeitgeist-Phänomen im Management
Demütig sein – Was heißt das eigentlich?
Führen – Was bedeutet das?
Demut und Führung – Wie passt das zusammen?
Humility + Will = Level 5 Leadership 25 (Do not) fake it – Falsche Demut und Paradoxien
Demütig(er) führen – Was bleibt?
Literatur
In aller Kürze – Worum es geht
Demut ist ein Zeitgeist-Phänomen. Längst nicht mehr nur Theologen und religiöse Men- schen setzen sich mit dem Wert der Demut auseinander. Manager, Unternehmensberater und Coaches tun es genauso. Galt plakativ zur Schau gestelltes Gewinnstreben in den 1980er Jahren in Managementkreisen noch als sozial akzeptiert, kann man heute eher mit prokla- mierter Demut punkten. Demut ist, so liest man in diversen Management-Ratgebern, heute eine jener Voraussetzungen, derer es bedarf, um eine Kultur der Menschenwürde in Orga- nisationen zu etablieren und zu leben. Demut schützt eine Führungskraft davor, übermütig zu werden und sich deutlich zu überschätzen. Demut erdet, was einem Unternehmen dien- lich sein kann. Wer demütig ist, wird auch eher geneigt sein, seinen Mitmenschen mit Res- pekt zu begegnen und deren Expertise anzunehmen. Wer demütig führt, gesteht sich Fehler ein. Er trägt so entscheiden dazu bei, dass eine Kultur der Fehlerfreundlichkeit gelebt wird. Wenn Mitarbeiter ihre Führungskraft als demütig und fehlertolerant erleben, werden sie eher geneigt sein, ebenfalls Fehler einzuräumen. In einer globalisierten Welt, in der Unter- nehmen weltweit konkurrieren, ist das essenziell, da es Innovationen befördert. Kurzum kann es von Vorteil zu sein, mehr Demut zu zeigen. Aber es gibt auch manche Nachteile. Dass man es auch mit Hochmut sehr weit bringen kann, beweist Donald Trump schließlich tagtäglich. Und noch etwas stimmt im Hinblick auf die Demut nachdenklich: Wie echt ist Demut, so ließe sich fragen, wenn Unternehmen sich ihrer im Kontext von Corporate-Social- Responsibility-Bekundungen primär deshalb bedienen, weil es dem eigenen Image dienlich ist. Ist das dann wirklich Demut, oder ist es nur Legitimationskitsch, mithin also Heuchelei?
Und wenn Letzteres zutrifft, ist das schlimm? Und warum eigentlich? Darum geht es im Text.
Ein Zeitgeist-Phänomen im Management
Der Papst hat in seiner Sozialenzyklika Caritas in Veritate mehr Präsenz von ihr in der Wirtschaft gefordert. Ebenso tun es Bundespräsidenten in Weihnachtsansprachen. Der Dalai-Lama ist ein steter Verfechter von ihr, Nelson Mandela war es auch – Mahatma Gandhi sowieso. US-Präsiden- ten betonen, Donald Trump ausgenommen, in ihren Reden zum State of the Union regelmäßig, sie übten ihr Amt in ihr aus. Und immer wieder findet sich in Artikeln in Wirtschaftsmagazinen ein selbsternannter oder tatsächlicher Management-Experte, der sie als zentrale Führungshaltung rühmt: Demut. Dass die Demut wieder absolut „in“ ist, belegen unzählige Publikationen. Hier ei- nige Beispiele: Understatement – Der Stil des Erfolgs lautet der Titel eines Buches von Rainer Wälde (2008), in dem wir einiges über die Vorteile eines demütigen Führungsstils erfahren. Im selben Jahr erschien Kristian Furchs Demut macht stark (2008). Über die Demut – so lautet der Titel eines Kapitels in Baldur Kirchners (2012) Benedikt für Manager. Ein Kapitel im Management- Fachbuch Das Zukunfts-Mindset von Jörg Hawlitzeck (2018, S. 212) ist ähnlich betitelt: Mit Leis- tungsbereitschaft und Demut zum Erfolg. Paul Romer, Wirtschaftsnobelpreis-Träger von 2018, sagte auf dem 12. Institutional Money Kongress: „Mehr Demut täte uns gut.“ Der Ex-Benediktiner Anselm Bilgri hielt beim HAYS Forum 2012 einen Vortrag über werteorientierte Führung, in dem er auf den Sinn der Demut für Führungskräfte einging. Ein anderer Benediktiner, Anselm Grün, schrieb ein Jahr später im Handelsblatt einen Artikel über Den Mut, hinabzusteigen. Er erklärt der Leserschaft darin, die Demut sei „in der Wirtschaft eine Haltung, die uns mitten in dem Streben, immer höher zu steigen, Halt gibt. Sie bewahrt uns davor, uns über andere zu stellen und in un- serem Höhenflug dann jäh abzustürzen.“ Susanne Thielecke beschrieb das, was heute als guter Führungsstil gilt, im Magazin Unsere Wirtschaf t (2018) mit folgenden Worten:
„Moderne Führungskräfte brauchen neben Klarheit, Entscheidungsfreude und Mut auch Demut, Empathie und Offenheit.“ Alexander Groth erklärt in seinem Buch Best of Führungslehre (2019, S. 27) in ähnlichem Tenor: „Eine demütige Führungskraft erhebt sich im Geist nicht über ihre Mitar- beiter, sie stellt sich nicht auf eine Ego-Säule, von der aus sie auf sie herabschaut.“ Im Artikel Mehr Mut zur Demut in der Führung auf WELT-Online (2019) postuliert Anke Houben dem ähnlich:
„Führen heißt dienen. Die Autorität einer Führungskraft ist nichts anderes als zugestandene Macht im Austausch für eine Dienstleistung. […] Wenn es um Bescheidenheit und Ambition geht, wird schwarz-weiß gedacht. Beides zusammen geht einfach nicht. Und genau das ist der Trug- schluss: Wirklich starke Führungskräfte verzichten auf Dominanz. Sie geben nicht vor, alle Ant- worten in einer immer komplexeren Welt zu kennen.“ Ähnliche Äußerungen finden sich in Wirt- schaftsmagazinen, in Reden von Keynote-Speakern und in Ratgebern zum Management zuhauf. Dass die Demut im letzten Jahrzehnt als Tugend auch in elitären Investment-Banker-Kreisen (vor- dergründig) wiederentdeckt wurde, die mit ihr - so die Wahrnehmung vieler Menschen - sonst eher wenig am sprichwörtlichen Hut haben, ist vor allem auf die weltweiten Finanzkrise zurück- zuführen, die sich ab 2007 abzeichnete und ihren Höhepunkt 2009 fand. Die Finanzkrise gilt als Paradebeispiel dafür, was Arroganz, Ignoranz, Gier und Hochmut anrichten können. Sie offen- barte, was passieren kann, wenn sich Manager allein dem Gewinnstreben verpflichtet fühlen, wenn sie hochrisikoreiche Entscheidungen treffen, für die sie persönlich nicht haftbar gemacht werden und bei denen sie im Falle des Scheiterns meist noch Millionen-Abfindungen erhalten, während Kleinsparer und Angestellte unter den Entscheidungen enorm leiden. Rakesh Khurana, Professor für Führungsentwicklung in der Organisationstheorie an der Wirt- schaftskader-Schmiede Harvard Business School, forderte daher bereits 2009 eine Art hippokra- tischen Eid für Manager. Die MBA-Absolventen sollten sich verpflichten, so seine Idee, der Gesell- schaft zu dienen und ihr Unternehmen rentabel, sozial sowie auch umweltverträglich zu führen (vgl. Buchhorn & Werle 2009). Professor Khurana war sich der Tatsache, dass eine solcher Eid nicht mehr sei als eine unverbindliche Willenserklärung - ähnlich des Giving Pledge - freilich be- wusst.1 Ein anderer bedeutsamer Management-Denker, Professor Henry Mintzberg von der McGill-University in Montreal, geht auf den Grund für den Hochmut vieler Harvard-MBAs in sei- nem Buch Managers, Not MBAs (2004, S. 74 ff.) ein. Er erklärt, dass die Kombination aus Kompe- tenz, Erfolgsverallgemeinerung und Arroganz vieler Studierender in Ivy-League-MBA-Program- men zu Selbstüberschätzung der Studierenden führen könne. Sein wenig schmeichelhaftes Resü- mee (ebd., S. 75) war schon vor 15 Jahren: „If the business schools were really doing their job, were truly creating leaders, their graduates would be known für their humility, not their arro- gance. Certainly they would graduate with an acute appreciation of what they don’t know. Instead, we hear from a recent graduate of Harvard Business School about a professor who told her class that, in the future we would be among those who set the rules and have the conversa- tions about what should and shouldn’t be done in the way business is conducted.‘ She and her classmates gave him a standing ovation.‘ No doubt!“ Dass Professor Khurana trotz - oder aufgrund - Mintzbergs Kritik am elitären MBA-Gehabe und der fragwürdigen Performance von Harvard- MBAs ein symbolisches Zeichen für mehr Demut im Business setzen wollte, entspricht dem Zeit- geist. Man könnte auch sagen: Der Professor erkannte einen Trend, der seit über 10 Jahren an- hält. Birger Menke bringt ihn im Artikel Wiederkehr der Demut im SPIEGEL (2012) auf den Punkt. Er schreibt: „Nach der erfolgreichen Selbstermächtigung steigt der Wunsch nach einer neuen Selbstverpflichtung gegenüber Werten wie Solidarität, Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit. Der Wunsch nach einer neuen Form von Demut. Alexander Dibelius, Deutschlandchef und mächtiger Manager der Investmentbank Goldman Sachs, rief seine Branche zu ‚kollektiver Demut‘ auf. Medienmogul Rupert Murdoch sagte, als er vor dem britischen Unterhaus zu den menschenverachtenden Ab- hörmethoden seiner ‚News of the World‘ Stellung nehmen musste, es handle sich für ihn um den Tag ‚größter Demut‘. Karl-Theodor zu Guttenberg entschuldigte sich ‚in Demut‘ nach der Plagi- atsaffäre, der damalige FDP-Generalsekretär Christian Lindner empfahl seiner Partei nach der Berlin-Wahl, das Ergebnis ‚in Demut aufzunehmen‘. Es gibt unzählige weitere Beispiele, eines zei- gen sie alle: Demut mag verstaubt sein, an Wirkung hat sie nicht verloren.“ Die Liste von mehr oder weniger bedeutsamen Persönlichkeiten, die sich zum hohen Wert der Demut (bzw. zu ihrem jeweiligen Verständnis davon) geäußert haben, ließe sich fortsetzen. Und zwar lang. Das Internet ist voller Zitate von Menschen, die im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehen und bekunden, ihre jeweilige Führungsaufgabe in Demut auszuüben. 44 Millionen Treffer liefert allein das Stichwort »Humble Leadership« bei einer Google-Suche im September 2019. Die Begriffskombination »de- mütig führen« brachte es auf 1,6 Millionen Treffer.
Das ist insofern interessant, als es noch gut 1/3 weniger Treffer waren, als der Autor dieses Auf- satzes vor gut 10 Jahren bereits einmal einen Artikel über Demut als Management-Hype (Nixdorf 2010; unveröffentlichtes Working Paper) schrieb. Daran zeigt sich, dass Demut als Führungshal- tung weiter an Resonanz gewonnen hat. Oder provokativ gesagt: Das Reden von und über Demut als Führungshaltung. Aus wohlfeilen Texten und Lobpreisungen auf Demut kann schließlich kei- neswegs gefolgert werden, dass Manager das, was sie im Manager Magazin, in der Organisati- onsEntwicklung oder im Harvard Business Manager so von sich geben, in der Praxis tatsächlich auch tun. Zu reden und zu handeln sind eben unterschiedliche Paar Schuhe. „Die Deutsche Bank übt Demut“ – so schreibt Hans-Jürgen Jakobs im Handelsblatt (2019). Dass dieselbe Deutsche Bank in Sachen Demut indes mitnichten eine Vorzeige-Organisation ist, hat nicht nur Josef Acker- manns mittlerweile zur Ikone der Kapitalismuskritik gewordenes Victory-Zeichen 2004 beim Man- nesmann-Prozesses bewiesen. Es zeigte sich auch unlängst wieder, als die Bank bekanntgab, welt- weit 18.000 Stellen streichen zu wollen. Am selben Tag, an dem das verkündet wurde, besuchten Schneidermeister von Fielding & Nicholson die Deutsche Bank in London, um deren Top-Manager zu vermessen zwecks Anfertigung maßgeschneiderter Anzüge, von denen die günstigsten min- destens 1800 Euro kosten (vgl. Farrell 2019). Das wirkte eher ignorant als demütig. Die Panama Papers und der VW Skandal zeugen ebenso davon, dass von wahrlich gelebter Demut vieler Wirt- schaftseliten in real wenig zu sehen ist. Dass dies auch für so manche Eliten in der Politik gilt, belegt der Skandal um dreistellige Millionenbeträge, die ohne Ausschreibungen für Beratungs- dienstleistungen seitens des Verteidigungsministeriums an die großen Consulting-Firmen Ac- centure und McKinsey flossen (vgl. Löhe 2019, siehe speziell zum Agieren von Eliten auch Hart- mann 2019). Die damalige Verteidigungsministerin, Ursula von der Leyen, die mittlerweile Präsi- dentin der EU ist, sagte bei einer Rede im EU-Parlament übrigens: „The task ahead of us humbles me.“ Sich öffentlichkeitswirksam in Demut zu üben gehört mittlerweile zum guten Ton. Das alles verwundert nicht. Die Organisationswissenschaftler Nils Brunsson (1989) und Stefan Kühl (2007) haben umfassend dargelegt, dass Heuchelei im Sinne eines A sagen und B tun eine gesellschaftlich zwar vordergründig verpönte, indes doch weit verbreitete, ja gar überlebenswichtige Eigenschaft von Managern ist. Ob im Jahr 2020 wirklich demütiger geführt, gemanagt und mit Bürgern, Kun- den sowie Mitarbeitenden kommuniziert wird als vor 10, 20 oder 30 Jahren, ist allerdings unge- wiss. Vielleicht wird heute auch nur besser geheuchelt.1 2
Klar ist, dass die Kommunikation über das Ideal der Demut als Führungstugend zugenommen hat. Das jedenfalls indiziert die Tatsache, dass laut Statistischem Bundesamt 27 % der betrieblichen und außerbetrieblichen Lehrveranstaltungen mit den meisten Stunden im Jahr 2015 Kundenori- entierung zum Inhalt hatten. Explizit Führungskompetenz hatten 18 % der Veranstaltungen zum Ziel. Der Trendmonitor Weiterbildung (2018, S. 17) der Leipzig Graduate School of Management u. a. verweist ebenfalls auf die hohe Bedeutung von Soft Skills wie Kommunikationsfähigkeit in Unternehmen. Darin heißt es bezugnehmend auf eine Stichprobe von 157 Unternehmen, die 2016/2017 analysiert wurde: „In den befragten Unternehmen wird eine Vielzahl von Lerninhalten durch entsprechende Weiterbildungsangebote unterstützt […]. Besonders häufig werden in der betrieblichen Weiterbildung Soft Skills (75 Prozent) sowie Management Skills (74 Prozent) ver- mittelt.“ Forderungen nach mehr Demut fallen heute - insbesondere in Kombination mit den Wor- ten »Wirtschaft«, »Politik« und »Finanzmarkt« - oft. Und das sicher nicht völlig grundlos, denn in letzter Zeit, so jedenfalls das Empfinden vieler Menschen, scheinen sich gerade in der Wirtschaft doch die Fälle zu häufen, in denen durch Hochmut, Egoismus und kurzsichtiges Gewinnstreben gigantische Wertvernichtung betrieben wird. Das neoliberale2 Credo, dass an jeden gedacht sei, wenn jeder an sich denke (medial bestens verkörpert durch die Figur des Gordon Gekko im Film Wallstreet), ist heute in vielen Milieus verpönt – und das nicht nur bei der politischen Linken. In weiteren Teilen der Gesellschaft gilt heute, dass demonstrativ zur Schau gestellte Bescheidenheit etwas ist, mit dem man punkten kann. Zumindest in Deutschland.3 Sich demütig zu geben, ist gutes Impression-Management. Beflissentlich wird die Demut daher nicht nur von Managern und Unternehmensberatern proklamiert, sondern auch in Talkshows, in Zeitungskommentaren sowie auf Gewerkschaftskongressen von Wirtschafts- und Finanzeliten eingefordert. Es wird eine Züge- lung des weltweiten Finanzmarktkapitalismus verlangt, mehr Nachhaltigkeit angemahnt und auf ein entschiedenes Entgegentreten gegenüber internationalen Hedge-Fonds insistiert, die auch Heuschrecken genannt werden. Die Analogie zur biblischen Plage ist offensichtlich. Die Essenz der Kritik lässt sich oft auf eine Kernbotschaft reduzieren: Manager hätten - so wird behauptet - durch Hochmut und Gier, verblendet von astronomischen Renditeerwartungen, erst die Unternehmen an die Wand gefahren, dann nach dem Staat gerufen und am Ende auch noch gewaltige Boni oder Millionenabfindungen kassiert für ihr egozentriertes Totalversagen. Und selbst als es hart auf hart kam, kassierten sie vor Gericht - wenn überhaupt - Geldstrafen, die sie aus der Portokasse bezahl- ten. Verantwortung sieht anders aus. Anstand sieht anders aus. Demut sieht anders aus. Doch was soll man machen? In Reden und Artikeln weiterhin vehement mehr Demut einfordern? An die moralischen Verpflichtungen und an das Gewissen von Managern appellieren? Beides ist si- cher nicht verkehrt, doch wird sich mehr Demut bei den Adressaten dadurch kaum einstellen.
Sinnvoller scheint es, sich nicht moralisierend, sondern aus rationalem Kalkül, eben aus Manager- Sicht, mit Demut zu befassen. In der Sozialen Arbeit würde man sagen: Sprich die Sprache des Klienten, sonst erreichst du ihn nicht. Die Sprache von Managern dreht sich um Rendite, Effekti- vität, Effizienz und Erfolg. Manager haben, je höher sie aufsteigen, mehr und mehr Verantwor- tung, Macht, Einfluss und dadurch oft hohes Selbstvertrauen. Nicht selten: Eine »Alphatier-Men- talität«. Da ist es verständlich, dass einer Aufforderung wie „Seid demütiger“ ob ihrer vermeintli- chen Naivität eher achselzuckend oder ablehnen begegnet wird. Uns allen wird zudem ja schon in der Schule klargemacht, dass wir in einer Leistungsgesellschaft leben, umgeben von potenziel- len Konkurrenten, mit denen wir uns ein Leben lang werden messen müssen. In der Wirtschaft, zumal in der globalisierten, stimmt das umso mehr. Wie kann da behaupten werden, dass Demut erstrebenswert sei, wenn persönliche Erfahrung, rationale Betriebswirtschaftslehre und nicht zu- letzt auch das Auftreten des mächtigsten Mannes der Welt, Donald Trump, nahelegen, dass auch - oder gerade - dann hohe Gewinne eingefahren und Karrieren gefördert werden, wenn eben kein demütiges, sondern eher ein egoistisches, mindestens doch opportunistisches, Verhalten an den Tag gelegt wird? Kann Demut aus Managersicht wirklich eine erstrebenswerte Haltung sein, die über Lippenbekenntnisse hinausgeht, welche lediglich in Kenntnis dessen geäußert werden, dass es in der Öffentlichkeit eben gut ankommt, sich demütig zu geben? Welchen Sinn könnte es ha- ben, eine so wenig greifbare, manchmal arg mystisch anmutende Haltung wie Demut anzustre- ben? Genau das wird auf den folgenden Seiten betrachtet. Es wird geschaut, inwieweit Führung und Demut zusammenpassen, bzw. warum Demut eine echte Stärke sein kann, gerade auch, weil sie im Konkurrenzkampf Vorteile mit sich bringt. Doch halt! – so ließe sich nun einwenden und fragen: Handelt es sich überhaupt um »wahre« Demut, wenn man diese nur deshalb anstrebt, weil man sich dadurch einen Vorteil erhofft? Wenn Demut keine aus Überzeugung generierte Geisteshaltung ist, sondern wenn sie lediglich qua Kalkül eingesetzt bzw. vorgetäuscht wird, kann dann überhaupt von »echter« Demut gesprochen werden? Und wenn nicht, ist das dann verwerf- lich? Um sich dem zu nähern, ist es sinnvoll, zunächst zu klären, was gemeint ist, wenn von Demut und Führung die Rede ist.
Demütig sein – Was heißt das eigentlich?
Philipp Wüschner (2017, S. 98) erklärt die Wortherkunft und die Assoziationen, die mit Demut einhergehen so: „Demut wird von der deutschen Sprache etymologisch als eine Form des ‚Muts‘ bestimmt. Dessen indogermanische Wurzeln verweisen auf Phänomene von ‚Mühe‘, ‚Kraft‘, ‚Zorn‘, ‚Wille‘, aber auch auf ‚Sinn‘ und ‚Geist‘; das heißt auf all das, was im Deutschen gemeint wird, wenn einem irgendwie zumute ist.“ Anselm Bilgri (2012, S. 2) beschreibt, dass das Wort Demut sich vom Ausdruck „dien-muot“ ableite, was so viel wie „Wille zum Dienen“ bedeutet. Kristian Furch (2008, S. 23) führt die Bedeutung des Wortes Demut ebenfalls etymologisch zurück auf die Wortstämme „Deus“ (lat. Gott) und „Muoth“ (altdeutsch Mut). Die Demut könne somit verstanden werden als „der Mut, sich von etwas Großem, zweifelsfrei Guten, abhängig zu ma- chen“. Es gehe dabei, so Bilgri (ebd.), „nicht um Dienen im Sinne von ‚ducken‘, sondern um eine Haltung, eine kraftvolle Übernahme von Verantwortung.“ Anselm Grün (2013) schildert die Wortherkunft der Demut so: ,Das griechische Wort für dienen heißt ‚diakonein‘, und das meint den Tischdiener. Für mich ist das ein Bild: der Tischdiener möchte, dass uns das Leben schmeckt. Dienen heißt daher: dem Leben dienen, Leben hervorlocken in den Menschen, Leben wecken.“ Weiter erklärt er: „Demut ist der Mut, hinabzusteigen in die Tiefen der Seele und alles, was da in mir ist, anzunehmen: Das gehört auch zu mir. Wenn ich es annehme, verliert es an Gefährlichkeit. Dieses Hinabsteigen in die Tiefen der eigenen Seele meint Jesus, wenn er sagt: ‚Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden‘ (Lk 18, 14).“
Demut ist im christlichen Verständnis die überdauernde innere Haltung des Individuums Gott ge- genüber. Thomas Eggensperger (2017, S. 114) meint dazu: „Demut scheint ihren Ort in einem Beziehungsgeflecht zwischen Gott und Mensch zu haben, nicht zwischen Menschen untereinan- der […]. Dennoch steht es dem Menschen an, einem anderen gegenüber demütig zu sein. Denn um Gottes Willen unterwirft sich der Mensch in Demut auch anderen.“ Demütig zu sein, bedeutet in der jüdisch-christlichen Tradition, sich als Diener Gottes zu erweisen, dessen Allmacht anzuer- kennen und zu akzeptieren, dass es etwas Unerreichbares, Höheres gibt: Gott. Ähnliches schreibt Karl Hörmann die Demut betreffend im Lexikon der christlichen Moral (1969, S. 190): „Sein Ver- hältnis zu Gott sieht der Demütige, wie es wirklich ist: Alle natürlichen und übernatürlichen Vor- züge hat er von Gott empfangen. Der Wille anerkennt diesen Befund: ‚Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin’ (1 Kor. 15, 10).“ Demut meint das Streben, es Gottes Vorbild nachzutun, bei gleichzeitiger Gewissheit, dass dieses Ideal erstrebt, doch nie erreicht werden kann. Der Mensch ist fehlbar. Demut verlangt, sich diese Fehlbarkeit einzugestehen, denn Demut umfasst auch die Bereitschaft, „sich selbst richtig einzuschätzen und gemäß einer richtigen Selbsteinschätzung sich zu verhalten [...] Die Selbsteinschätzung vollzieht sich auf dem Weg des Vergleichs gemäß Bezie- hungen, in denen der Mensch durch Natur und Gnade steht, nämlich zu Gott und zum Mitmen- schen“ (ebd., S. 190). Da der Demütige weiß, dass alle Vorzüge von Gottes Gnaden kommen, liegt es ihm fern, sich selbst zu überschätzen und andere zu unterschätzen. „In der Überwindung dieser Schwierigkeit liegt die eigentliche Leistung des Demütigen“ (ebd., S. 190). Der Demütige ergeht sich nicht in Selbstgefälligkeit, „sondern sieht in Gott den Urheber des eigenen Wertes. Auf die eigenen Vorzüge weist er nur dann hin, wenn es einen guten Sinn hat, etwa zur Vermehrung des Lobes Gottes [...] oder zur Sicherung des eigenen Bestehens und Wirkens [...]; im übrigen überläßt er das Urteil Gott“ (ebd., S. 191). Der Demütige ist unvoreingenommen, denn er erkennt, dass er selbst nicht besser ist als andere Menschen. Er erhebt sich daher ganz bewusst nicht über andere und bildet sich auf seine Erfolge nichts ein, da er weiß, dass er sich diese nicht nur selbst zuzu- schreiben hat. Diese Erkenntnis schützt vor Hochmut. Kurzum ist dem Demütigen wohl bewusst, dass am „sichersten [...] vor der Überheblichkeit bewahrt [wird], wer im Geist christlicher Liebe seine Aufgabe im Dienst am Nächsten erblickt. Jesus verwirklicht diese demütige Liebe. ‚Er ent- äußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an und wurde den Menschen gleich. In seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tode, ja bis zum Tode am Kreuze’ (Phil. 2,7 f; vgl. Apg. 8,33; Hebr. 2,7.9)“ (ebd., S. 192). Der wahr- haft Demütige ist nun aufgefordert, es Jesus gleichzutun: „Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, müßt auch ihr einander die Füße waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr tut, wie ich euch getan habe (Joh. 13,14 f)“ (ebd., S. 193).
Das Dargelegte zeigt das Demutsverständnis aus einer genuin religiösen Sicht. Freilich gibt es noch viele weitere Möglichkeiten, Demut zu betrachten und ihren Sinn philosophisch, sozialpsycholo- gisch oder wirtschaftlich herzuleiten. Demut ist also ausdrücklich keine exklusiv jüdisch-christliche Tugend, wie Thomas Eggensperger (2017, S. 113) darlegt. Er kontrastiert das christliche Demuts- verständnis mit Demutsverständnissen aus anderen Epochen und kommt zum Schluss, dass „man die Demut in den antiken nicht-christlichen Tugendkatalogen der Philosophen nicht findet. Die griechische Demut bezeichnet keine sittliche Tugend, sondern Unterwürfigkeit oder Untertänig- keit. In der aristotelischen Tradition ist es tugendhaft, großgesinnt zu sein und damit in der Mitte zwischen Aufgeblasenheit und Kleinmütigkeit zu stehen. Selbst Bescheidenheit ist keine Zier, son- dern die Haltung des Mittelmäßigen. Demut wird erst in der jüdisch-christlichen Anschauung zu einer positiv bewerteten Grundhaltung der sittlichen Lebensführung.“ Demut hängt, so die Kon- sequenz, in der jüdisch-christlichen Tradition eng zusammen mit Dienen, oder besser: Mit Dienst am Menschen. Allerdings hat die Demut als Tugend trotz der religiösen Ableitung des Wortes im weiteren Sinne nicht zwangsweise etwas mit Religiosität bzw. mit dem Glauben an eine Gottheit zu tun. Vom Dienst für und vor Gott hat sich das heute Demutsverständnis in weiteren Teilen der Gesellschaft gewandelt. Auch Nicht-Gläubige, die ihren universalen Selbstwert nicht aus ihrer Unvollkommenheit im Vergleich zu Gott ableiten, betonen häufig, etwas in Demut zu tun oder Demut zu empfinden. Ein jeder Mensch, ob religiös oder nicht, kann demütig sein, wenn er - aus welchen Gründen auch immer - davon überzeugt ist, dass es ein hohes Gut ist, (auch) anderen zu dienen und sich selbst immer wieder infrage zu stellen. Martina Aron-Weidlich schildert das in ihrem Buch Essenz der Führung (2012, S. 44) so: „Führung bedeutet auch Autoritäten anzuerken- nen, sich unterzuordnen und in einer bestimmten Art und Weise auch demütig sein zu können. Dienen ist ein ausgleichendes Element, das nicht automatisch mit ‚sich verbiegen‘ einhergeht“. Eine erfolgreiche Führungskraft verstehe es, eine Balance zwischen Anpassung und Querdenken an den Tag zu legen. „Zugegeben, es erfordert manchmal die Künste eines Chamäleons, sowohl der eigenwillige Entrepreneur als auch der flexible, sich situativ Unterordnende zu sein.“ Ein Blick in diverse Texte, in denen die Verknüpfung von Demut und Management vorgenommen wird, zeigt, dass die religiöse Bezugnahme heute kaum mehr erfolgt. Eher wird Demut als moralisch gebotene Tugend ohne deistischen Bezug interpretiert. So definiert Rainer Wallisser (2006) die Demut als „Gesinnung des Dienenden bzw. des selbstlosen Dienens im Gegensatz zu Selbsterhe- bung, Stolz und Hochmut, der eigenen Selbstüberschätzung und Vermessenheit. [...] Demut wird im weltlichen Sinn vor allem als soziale Tugend, als Dienst an der Gemeinschaft verstanden. Wer demütig ist, stellt seine eigenen Ansprüche zurück und seinen persönlichen Stolz nicht in den Vor- dergrund. Schicksalsschläge können u. a. ohne zu klagen ‚demütig’ akzeptiert werden.“
Robert Solomon (1999, S. 94) definiert Demut als „a realistic assessment of one’s own contribu- tion and the recognition of the contribution of others, along with luck and good fortune that made one’s own success possible. Humility, acordingly, is a version of gratitude […].“ Žiaran et al. (2015, S. 2222) sehen Demut als Konvergenz von Selbst-Achtung, Selbst-Vertrauen und Selbst-Einschät- zung: „Humility is the mid-point between negative extremes of arrogance and lack of self-esteem. In our view, this definition, based on one’s own capacity to discern among esteem, confidence and assessment is most compatible with our view of the humility concept.“ Nicht religiöse Men- schen assoziieren mit Demut oft schlicht Zurückhaltung, Mäßigung und Kenntnis um die eigene Fehlbarkeit. Wer Demut eher negativ konnotiert (was auch vorkommt), hat mitunter hingegen Assoziationen wie Kriecherei, Leisetreterei, Schleimerei oder Duckmäusertum im Kopf. Festzu- stellen ist allerdings, dass sich in wissenschaftlichen Datenbanken weit mehr Texte finden, die auf den Nutzen der Demut eingehen, als solche, die vom potenziellen Nutzen des Hochmutes berich- ten. Es gibt aber auch Letztere, die darauf verweisen, dass ein gewisses Maß an Hochmut und Selbstüberschätzung in bestimmten Situationen hilfreich sein kann. So schildern Galasso & Sim- coe (2010, S. 22) in einem Working Paper - basierend auf einer Modellrechnung - dass Selbstüber- schätzung Innovationen befördern kann. Sie schreiben: „In particular, overconfident CEOs obtain more cite-weighted patents, and this effect increaseswith product market competition. These findings suggest that overconfident CEOs are more likely to initiate a significant change in their firm’s innovation strategy.“ Dem ähnlich erklären auch Herz et al. (2013, S. 22 f.), dass Selbstüber- schätzung (overoptimism) und Innovation positiv korrelieren: „we argue that the connection between overconfidence and innovative activity is more nuanced than the existing literature suggests.“ Auch US-Präsident Donald Trump beweist, dass man es mit Hochmut weit bringen kann. Allen Frances, einer der renommiertesten Psychiater der USA und Mitautor der vierten Re- vision des Diagnostischen und Statistischen Handbuches Psychischer Störungen (DSM-IV) etwa er- klärte: „Mr. Trump causes severe distress rather than experiencing it and has been richly re- warded, rather than punished, for his grandiosity, self-absorption and lack of empathy.” Fake it till you make it – das Sprichwort bringt den potenziellen Nutzen von Selbstüberschätzung treffend auf den Punkt. Einen Kontrast dazu stellen die folgenden beiden Aussprüche des atheistischen Jahrhundert-Genies Albert Einstein dar, die geradezu exemplarisch stehen für eine »weltliche« Form echter Demut (zit. Nach Melcher 1979, S. 60): „Der Mensch kann eben in seinem kurzen und gefahrenreichen Leben einen Sinn nur finden, wenn er sich dem Dienst an der Gesellschaft widmet. [...] Und es ist die hohe Bestimmung des Menschen, mehr zu dienen als zu herrschen oder sich sonst in irgendeiner Form zu erheben.“ Es steckt viel Demut in diesen Worten, doch das völlig ohne religiöse Begründung, ohne Rekurs auf eine jenseitige Macht. Wer oder was die hohe Bestimmung vorgibt, bleibt außen vor – und unbedeutend. Die Essenz von Einsteins Postulat ist schlicht die Erkenntnis, dass das Leben für alle Menschen lebenswerter wird, wenn sich mehr Menschen der Demut, der dienenden Nächstenliebe, verpflichten. Summa summarum ist festzu- halten, dass - ganz gleich ob mit oder ohne religiösen Bezug - als demütig gelten kann, wer…
- …sich nicht über andere erhebt,
- …sich eingesteht, nicht unfehlbar zu sein,
- …sich selbst realistisch und ehrlich einschätzen kann,
- …achtsam und wertschätzend mit sich und anderen umgeht,
- …davon Abstand nimmt, sich mit anderen vergleichen zu wollen,
- …akzeptiert, dass er/sie nicht besser oder schlechter ist als andere Menschen,
- …überzeugt ist, dass der eigene Selbstwert universal und bedingungslos besteht,
- …meint, dass zu dienen ein höheres Ideal darstellt, als selbstzweckhaft zu herrschen,
- …anerkennt, dass ein höheres, unerreichbares, aber erstrebenswertes Ideal existiert.
Führen – Was bedeutet das?
Es gibt wahrlich Berge an Literatur zum Thema Führung. Weit mehr noch als zur Demut. Gerade ob dieser Fülle an Quellen kann festgehalten werden, dass der Begriff der »Führung« wenig kon- turierter ist. Es existieren unzählige Führungsdefinitionen, in denen, je nachdem, ob man sich der Führung aus einer eher betriebswirtschaftlichen, organisationssoziologischen oder psychologi- schen Sicht nähert, verschiedene Charakteristika der Führung unterschiedlich gewichtet und be- leuchtet werden (siehe etwa Neuberger 2002, S. 15 ff.). Erschwerend kommt hinzu, dass dem Substantiv Führung eine fast beliebig anmutende Anzahl von Präfixen vorangestellt werden kann, was die Gegenstandsbestimmung noch schwieriger macht. So gibt es diverse Definitionen und Umschreibungen von Unternehmensführung, Personalführung, Gruppenführung, militärischer Führung, Selbstführung und Weiteres. Eine sehr kompakte Definition von Führung stammt von Lutz von Rosenstiel (2009, zit. nach Nerdinger 2014, S. 84). Er definiert diese auf ihren Kern redu- ziert als „bewusste und zielbezogene Einflussnahme auf Menschen.“ Mohe & Karczmarzyk (2015, S. 11) definieren Führung dem ähnlich als „ziel- und ergebnisorientierte, wechselseitige und akti- vierende, soziale Beeinflussung zur Erfüllung gemeinsamer Aufgaben in und mit einer strukturier- ten Arbeitssituation.“ Ausführlicher fällt die Definition von Wolfgang Staehle (1999, S. 328) aus. Er beschreibt das Wesen der Führung als „Beeinflussung der Einstellung und des Verhaltens von Einzelpersonen sowie der Interaktionen in und zwischen Gruppen, mit dem Zweck, gemeinsam bestimmte Ziele zu erreichen. Führung als Funktion ist eine Rolle, die von den Organisationsmit- gliedern in unterschiedlichem Umfang und Ausmaß wahrgenommen wird.“ Eine der umfang- reichsten Führungsdefinitionen stammt von Thomas Bartscher. Im Online-Wirtschaftslexikon (2019) des Wissenschaftsverlags Springer-Gabler schreibt er, dass Führung verstanden werden könne „als psychologische und soziale Fähigkeit einer Person im Umgang mit Menschen“. Bart- scher meint, dass Führung eine „durch Interaktion vermittelte Ausrichtung des Handelns von In- dividuen und Gruppen auf die Verwirklichung vorgegebener Ziele“ sei, welche „asymmetrische soziale Beziehungen der Über- und Unterordnung“ beinhalte. Des Weiteren erklärt er:
„Die Ausübung von Führung bedient […] unterschiedliche Funktionen, etwa kann sie den Geführ- ten Sicherheit und Orientierung vermitteln. In arbeitsteiligen Organisationen haben Führungsbe- ziehungen darüber hinaus u. a. den Zweck, Koordination und Zielerreichung zu befördern. Neben der Orientierung auf die Erreichung von Zielen durch Individuen und Gruppen in Organisationen, Unternehmen, Betrieben etc. bestehen Führungsfunktionen in der Motivation der Mitarbeiter und in der Sicherung des Gruppenzusammenhalts.“ Weitere Definitionen könnten noch aufgelis- tet werden, die sich in Nuancen unterscheiden. Übereinstimmende Merkmale, die sich in fast allen Definitionen finden, sind, dass Führung (1) intendiert zu beeinflussen meint, (2) konkrete Ziel zu erreichen anstrebt, (3) Kommunikation und Interaktion bedarf, (4) mit einem Machtgefälle einhergeht sowie (5) Personen voraussetzt, die geführt werden. Personen zu führen meint, sie dahingehend zu beeinflussen, dass die vorgegebenen Ziele verfolgt werden. Das bedeutet aller- dings keineswegs, dass Führung hierarchisch darauf reduziert werden kann, dass einer führt und andere folgen. Führung ist nur dann möglich, wenn die zu führenden Personen die ihnen zuge- wiesene Rolle der Zu-Führenden annehmen und sich führen lassen. Das zeigt sich immer dann, wenn Führungskräfte sich mit ihren Wünschen und Ideen gegenüber den Mitarbeitern nicht durchsetzen können, weil diese sie durch Ignoranz oder Dienst nach Vorschrift unterminieren. Rudolf Wimmer beschreibt das in Führen - Eine kollektive Leistung (2001, S. 11) so: „Es ist über- haupt ganz zentral zu sehen, dass die Führungsleistung eines Einzelnen, egal auf welcher Ebene, zutiefst abhängig ist vom sozialen Umfeld, das es ermöglicht oder verunmöglicht. Wir neigen ja dazu, Führung als Leistung einer Person zu beschreiben, und dort im Positiven wie Negativen zu verorten - hat sie Erfolg oder Misserfolg? - und sehen viel zu wenig, dass die Wahrnehmung der Führungsfunktion eine kollektive Leistung ist.“ Doch auch wenn Führen eine kollektive Leistung ist, steht sie, so schreibt Dirk Baecker in Postheroisches Management (1994, S. 33), „voll und ganz in der Tradition des Hierarchiedenkens. Das bedeutet, dass sie [Führung] eine Idee ist, die die Geführten akzeptieren müssen, wenn sie Erfolg haben soll. Und das bedeutet, dass die Gründe, aus denen sie akzeptiert wird, die Gründe von Untergebenen sind.“ Führungskräfte können nicht führen, wenn die Geführten ihnen die Gefolgschaft verweigern, wenn sie also »nicht mitspielen«. So erklärt sich auch, dass vermeintliche Führungskräfte „oft weit weniger Macht [haben] als die ihnen formal unterstellten Mitarbeiter. Das liegt zum einen daran, dass die Mitarbeiter entschei- den, was überhaupt ‚nach oben’ kommuniziert wird. Sie haben eine Art Filterfunktion und können ihre ‚Chefs’ ruhigstellen und in gewissen Bandbreiten ahnungslos halten“ (Simon 2007, S. 92). Und zum anderen sind es schließlich die Mitarbeiter, die Geführten, die operativ das umsetzen, was von Führungskräften beschlossen wird. Das heißt, Führung ist in der Tat eine kollektive An- gelegenheit, bei der den Geführten wie den Führern gleichermaßen Bedeutung zukommt. Die Führer geben zwar den Rahmen vor, die Geführten aber agieren aktiv in diesem Rahmen. Die Geführten „kontrollieren die Unsicherheit ihrer Chefs und haben daher auch eine nicht zu unter- schätzende Macht über sie“ (ebd., S. 92). Auch Rainer Stroebe legt den Fokus auf die kollektive Komponente von Führung. In Grundlagen der Führung (2006, S. 18) schreibt er:
„Es gibt fünf Einflussfaktoren auf Führung: die Führungskraft, den einzelnen Mitarbeiter, die Gruppe, gemeinsame Werte und Ziele und die jeweilige Situation.“ Ferner nennt Stroebe zwei Grundaufgaben der Führung: Kohäsion (das Herbeiführen und Aufrechterhalten der Gruppenzu- sammengehörigkeit) und Lokomotion (die Motivation der Gruppe zur gemeinsamen Zielerrei- chung initiieren). Kohäsion bezeichnet, so Stroebe, „den menschlichen, den Beziehungs-Aspekt der Führung. [...] Die Gruppe steht im Vordergrund. Kohäsion ist erforderlich, weil ein Unterneh- men nicht nur eine Leistungsorganisation, sondern auch eine Sozialorganisation ist: Ein Manager muss mit einer Sache nicht nur vorankommen - er muss auch mit ihr und bei den Menschen an- kommen. Eine hohe emotionale Kompetenz, das erfolgreiche Umgehen mit eigenen und fremden Gefühlen, ist hierfür Voraussetzung“ (ebd., S. 14). Lokomotion dagegen „beschreibt den sachli- chen und den innovatorischen Aspekt der Führung. Hier steht das Ziel im Vordergrund. Lokomo- tion ist erforderlich, weil ein Unternehmen eine Leistungsorganisation ist, deren Ziele erreicht werden müssen, wenn sie überleben will“ (ebd., S. 16). Lokomotion bezeichnet somit die Not- wendigkeit, die Leistung durch klare Zielvorgaben, Kontrollen, Prozessoptimierungen und Bench- marking zu gewährleisten. Um langfristig erfolgreich führen zu können, ist es notwendig, Kohä- sion und Lokomotion in einem Ausgleich zu belassen. Dies zu erreichen bedarf einer kollektiven Leistung, weil die Führungskraft allein weder die Fachkenntnis noch die Macht besitzt, alles allein zu überschauen und zu koordinieren. Denn: „Führungskräfte sind keine Spezialisten wie ihre Mit- arbeiter. Deren Fachwissen geht in die Tiefe. [...] Führungskräfte dagegen sind - abhängig von der Ebene - mehr oder weniger Führungsspezialisten. [...] Für Spezialistentätigkeiten sind Füh- rungskräfte nicht da. [...] Führungskräfte sind insofern Universalisten, als sie umfassende Füh- rungsaufgaben wahrnehmen. Hierzu benötigen sie vorrangig Führungswissen [...]. Dieses Wissen geht nicht - wie bei den Spezialisten - in die Tiefe. Es geht in die Breite. Das fachliche Wissen von Führungskräften ist Methodenwissen, ist Grundsatzwissen über die Tätigkeiten der Mitarbeiter“ (ebd., S. 21). Rudolf Wimmer argumentiert in Die Zukunft von Führung (1996, S. 54) ähnlich, dass Führung und Selbstorganisation bzw. Selbststeuerungsfähigkeit (der Geführten) kein Gegensatz sind, sondern dass gute Führung vielmehr die Basis schafft, d. h. die notwendige Freiheit gewährt, doch auch den notwendigen Rahmen vorgibt, damit Aufgaben so frei wie möglich, aber so kon- trolliert wie nötig, bearbeitet werden können: „Löst man sich von der personenorientierten Vor- stellung, dass Führung in erster Linie etwas mit Befehlen, Anordnen, Ausführen und Gehorchen zu tun hat, sondern begreift man sie als eine Funktion, die darauf konzentriert ist, geeignete Be- dingungen zu schaffen, damit die Leute ihre Arbeit erfolgreich erledigen können, also in der Lage sind, sich selbst zu führen, dann kann man sich leichter mit der Frage konfrontieren, wie sich diese Funktion am besten organisieren lässt.“ Kurzum kann die Führung als das zentrale Qualitätsmerk- mal für die Selbststeuerungsfähigkeit von Unternehmen (oder Teams allgemein) angesehen wer- den. Die Entgegensetzung »Führung vs. Selbststeuerung« stammt, so Wimmer, „aus der Zeit als Hierarchie für Fremdbestimmung stand und die Gruppe als Ort der Emanzipation von diesem Fremdbestimmtsein gegolten hat. Für die heutigen Organisationsverhältnisse sind diese Denk- muster vielfach zu einfach gestrickt“ (ebd., S. 55).
Was Wimmer vor 24 Jahre schrieb, ist heute, in der Arbeitswelt 4.0, noch weit bedeutsamer. Heute wünschen sich viele Arbeitgeber gerade in Bereichen, wo projektförmig gearbeitet wird und wo nicht jeder Prozessschritt standardisiert werden kann, Mitarbeitende, die ein ausgepräg- tes Maß der Fähigkeit zur Selbstführung mitbringen. Vice versa wünschen sich zur Selbstführung fähige Mitarbeitenden oft Chefs, die ihnen Freiraum geben, die ihre Kompetenz wertschätzen und die sie dergestalt führen, dass sie ihnen vertrauen, nicht alles für sie regeln, sondern lediglich situativ angemessen eingreifen - oder das bewusst nicht tun (vgl. Spector 1997, S. 55 ff.; Weinert 1992, S. 296 ff.). In Conclusio lässt sich sagen, dass Führen heute nicht mehr unbedingt beinhaltet, voranzugehen. Es kann auch heißen, im Hintergrund zu bleiben und den Mitarbeitenden den Rü- cken zu stärken: Leading from behind – so das mögliche Credo. Das kann beinhalten, eine Umge- bung zu schaffen, in der es Mitarbeitenden möglich ist, sich effektiv und effizient selbst zu führen. Weit mehr als noch vor wenigen Jahrzehnten beinhaltet Führen heute, zu erkennen, wann die eigene Zurückhaltung geboten ist, wann es also gilt, Verhalten von Mitarbeitern dadurch zu be- einflussen, dass auf Direktiven verzichtet wird, um die Motivation der Mitarbeitenden nicht zu unterminieren. Führen heute heißt auch, zu reflektieren, was man alles nicht weiß, kann und selbst zu erledigen imstande ist. Es heißt, die Arbeit so aufzuteilen, dass kompetente Mitarbei- tende dazu imstande sind, die so delegierten Arbeiten zu übernehmen, wofür sie Anerkennung sowie eine wertschätzende, ehrliche Rückmeldung erfahren. Es kann im Ergebnis also festgehal- ten werden, dass Führung sich durch folgendes auszeichnet:
- Führung ist ein Instrument zur Erreichung zuvor definierter Ziele. Sie beinhaltet, das Ver- halten anderer zielorientiert zu beeinflussen.
- Führen setzt Kommunikation und Handeln voraus. Allerdings kann Führung auch beinhalten, bewusst nicht zu handeln und im Hintergrund zu bleiben.
- Führung basiert auf einem hierarchischen Prinzip der Über/Unterordnung. Doch funktio- niert sie nur, wenn die Zu-Führenden ihre Rolle akzeptieren.
- Führung ist die Befähigung, das Wissen, Können und Wollen der Zu-Führenden zu erkennen, zwecks Zielerreichung nutzbar zu machen und zu fördern.
Demut und Führung – Wie passt das zusammen?
Nachdem beschrieben wurde, was Demut und was Führung auszeichnet, soll nun erörtert wer- den, inwieweit beides zusammenpasst – oder auch in einem Spannungsverhältnis steht. Denn es stellt sich die Frage, ob die hohe Verantwortung und das oft ebenso hohe Selbst-vertrauen, wel- ches vielfach mit der Zuschreibung einhergeht, eine Führungspersönlichkeit zu besitzen, es über- haupt zulassen, wahrhaft demütig zu sein. Oder anders gefragt: Kann man sich echte Demut und die damit einhergehende Gewissheit, selbst fehlbar zu sein, leisten, wenn man als Vorbild fungie- ren, die Richtung vorgeben, eben führen will? Muss, wer andere überzeugen will, nicht von sich selbst überzeugt sein? Die Antwort darauf ist ein klares »Ja«. Eine Führungskraft wird andere nicht überzeugen können, sie nicht zu motivieren und zu begeistern imstande sein, wenn die Füh- rungskraft selbst gar nicht wirklich überzeugt ist von sich. Sie wird nicht (auf andere) wirken kön- nen, wenn sie nicht daran glaubt, dass das, was sie ermöglicht, vorschlägt, anweist, propagiert, den Mitarbeitern ans Herz legt und vorlebt, auch »richtig« ist. Mitarbeiter werden einer Füh- rungskraft kein Vertrauen schenken, wenn diese sich selbst nicht vertraut. Selbstüberzeugung bildet die Basis für Selbstvertrauen. Dessen bedarf es, damit auch andere, nämlich die Geführten, auf die Führungskraft vertrauen können. Solange die Selbstüberzeugung keine extremen Züge annimmt, bewirkt sie, dass man sich selbst schätzt. Eben das ist zentral, um andere schätzen zu können. Ein Zitat von Henry J. Kaiser (1882 – 1967) bringt auf den Punkt, dass ein großes Selbst- vertrauen und Demut ausdrücklich keine Gegensätze sein müssen. Es lautet: „Ich mache Fort- schritte, indem ich mich mit Menschen umgebe, die klüger sind als ich, und ihnen zuhöre. Und ich gehe davon aus, dass jeder etwas hat, worin er klüger ist als ich“ (zit. nach Covey 2014, S. 94).
Henry J. Kaiser war ein Industrieller und insbesondere im Bereich des US-amerikanischen Schiff- baus ähnlich wirkmächtig, wie es Henry Ford in der Automobilindustrie war. Kaiser, der posthum 1990 in die U.S. Labor Hall of Fame und 2009 in die California Hall of Fame aufgenommen wurde, machte sich nicht nur aufgrund seiner wirtschaftlichen Erfolge einen Namen. Er tat es auch durch sein soziales Engagement. So setzte er sich u. a. für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen seiner Arbeiterschaft ein und investierte in die Gesundheitsversorgung/Krankenversicherung die- ser und ihrer Familien (vgl. dazu Schanetzky 2016). Sein Zitat bringt den Nutzen eines demütigen Management-Verständnisses auf den Punkt und zeugt dabei von großer Weitsicht. Zum einen war Kaiser trotz dessen, dass er bereits sehr erfolgreich war, immer noch bestrebt, Fortschritte zu machen. Er sah das eigene Agieren nicht als Best Practice, sondern als Good Practice, die durchaus noch verbessert werden konnte. Kaiser war zukunftskompetent. Das eine solche Kompetenz ge- rade die demütigen Führungskräfte haben, verwundert nicht. Sie wissen eben aufgrund ihrer De- mut, dass sie »nicht« alles wissen – und deshalb auf die Expertise von anderen angewiesen sind. Eine »Alphatier«-Mentalität kann zu Selbstüberschätzung führen, eine demütige Führungshal- tung zu Erkenntnis. Die Stärke des Demütigen liegt in seiner Akzeptanz des eigenen Nicht-Wissens sowie in seiner Fähigkeit, durch Offenheit und Interesse an Mitarbeitern wissender zu werden. Robert Greenleaf der 1964 das Center for Servant Leadership gründete, in dem er die Wichtigkeit ethisch hoher Standards in der Führung von Menschen propagierte, formulierte seine Idee zu dem, was Henry J. Kaiser an den Tag legte, so: „The leader needs […] to have a sense for the unknowable and be able to foresee the unforeseeable. Leaders know some things and foresee some things which those they are presuming to lead do not know or foresee as clearly. […] As a practical matter, on most important decisions there is an information gap. […] The art of lea- dership rests, in part, on the ability to bridge that gap by intuition, that is, a judgment from the unconscious process. The person who is better at this than most is likely to emerge as the leader because of the ability to contribute something of great value“ (Greenleaf 2002, S. 35 f.).
Um fähig zu sein, das Unvorhersehbare antizipieren zu können, bedarf es Informationen, Kreati- vität sowie die Bereitschaft, sich irritierbar zu halten. Es bedarf des Wissens darum, dass Erfah- rungslernen insofern zwei Seiten hat, als es einerseits zwar wichtig ist, aus Vergangenem Schlüsse zu ziehen, es aber auch Gefahren birgt, in die Zukunft zu schauen auf Basis eines Wissens aus der Vergangenheit. Henry J. Kaiser wusste, dass aus dem Erfolg, den er hatte, nicht per se auf zukünf- tigen Erfolg geschlossen werden konnte. Viele Menschen neigen dazu, Erfolge zu verallgemeinern und sie in die Zukunft fortzuschreiben. Sie nehmen an, dass das, was sie »heute« so erfolgreich macht, ihnen auch morgen und übermorgen Erfolg garantieren wird. Dass das keineswegs immer so ist, haben Firmen wie Nokia ebenso bewiesen wie die Kaufhausketten Hertie und Karstadt. Disruption durch technischen Wandel, und dadurch Änderungen im Konsumverhalten, waren so anders als bisher, dass die Manager sie in diesem Ausmaß nicht vorhergesehen bzw. in der Trag- weite falsch eingeschätzt hatten. Beim finnischen Telekommunikationsunternehmen Nokia, dem weltweiten Handy-Marktführer in den 2000er Jahren, wurde der Smartphone-Trend verschlafen. Apple und SAMSUNG zogen an den einst erfolgsverwöhnten Finnen vorbei. Die Konzernlenker von Hertie und Karstadt verschliefen den Trend, dass ab den frühen 2000er-Jahren immer mehr Kunden Waren online bestellten, statt weiterhin ein klassisches All-in-one -Kaufhaus aufzusuchen. Ähnliche Geschichten von einst erfolgreichen Unternehmen, deren Top-Manager bedeutende Trends nicht erkannten und dadurch Marktanteile verloren (oder insolvent wurden), gibt es viele. Selbstkritik ist trotz des evidenten Scheiterns von Top-Managern dann doch selten zu vernehmen, denn das eigene Vorgehen war, so wird oft beflissentlich versichert, keinesfalls falsch. Mistakes Were Made (but not by me) - so das unter Managern verbreitete Motto, dem Tavris & Aronson (2007) ein ganzes Buch gewidmet haben. Der Plan stimmte, doch es haperte an der Kommunika- tion. Das Versagen wird nicht den eigenen Fehlern zugeschrieben, sondern anderen. Henry J. Kai- ser war kein solcher Manager. Er wusst um seine Fehlbarkeit und reflektierte, dass das, was ihn erfolgreich machte, später vielleicht nicht mehr so sein müsste. Er war sich im Klaren darüber, dass Bestehendes nicht einfach in die Zukunft extrapoliert werden kann. Er wusste um die Not- wendigkeit beständiger Innovation. Er erkannte, dass es zwecks Fortschritts des Einschlagens noch nicht gegangener Wege bedurfte. Von Demut zeugt das, weil Kaiser damit auch zu verstehen gab, dass er sich seiner Fehlbarkeit bewusst war. Kaiser wusste, dass er immer weiter an sich würde arbeiten müssen, dass seine bestehende Expertise auch eine Gefahr birgt: Die der Selbst- überschätzung. Henry J. Kaiser negierte keinesfalls die eigene Expertise. Er wusste, dass er eine solche hatte, denn ohne sie wäre er nicht so erfolgreich geworden. Kaiser gestand aber offen, dass er selbst nicht das Maß aller Dinge sei, indem er postulierte, dass es Menschen gäbe, die klüger seien als er, dass er sich deshalb gerne mit diesen umgebe und ihnen zuhöre. C. S. Lewis sagte einst, dass Demut nicht bedeute, weniger von sich selbst zu denken, sondern, weniger an sich selbst zu denken (zit. nach Mai 2019). Das legte Kaiser an den Tag, indem er die Klugheit anderer Menschen anerkannte. Er war bereit, anderen zuzuhören und deren Expertise anzuneh- men, um so sicherzustellen, dass das eigene Unternehmen weiterhin erfolgreich sein wird. Das stellt genau jene Konvergenz von Selbstbewusstsein und Demut dar, auf die Lewis rekurriert. Zu- dem zeugt sie von der eigenen Klugheit, in der sich Henry J. Kaiser nicht sonnte. Kaiser fiel nicht dem oft vorkommenden Effekt anheim, sich selbst zu überschätzen und zu glauben, alles schon zu wissen. Er zeigte eine hohe Fehlbarkeitsreflexivität.
March & Levinthal (1993, S. 96) schildern die Wichtigkeit einer solchen Reflexionsfähigkeit. Sie schreiben: „Experience is often a poor teacher, being typically quite meager relative to the com- plex and changing nature of the world in which learning is taking place.” Weiter erklären sie:
„Where situations or proper responses are numerous and shifting, it is harder to specify and re- alize optimal inventories of knowledge. By the time knowledge is needed, it is too late to gain it; before knowledge is needed, it is hard to specify precisely what knowledge might be required or useful. It is necessary to create inventories of competencies that might be used later without knowing precisely what future demands will be.” Darüber, wie wichtig auch das »Zuhören« ist, das Kaiser unternahm, hat Robert Greenleaf (2002, S. 31) geschrieben. Er meint: Only „a true natural servant automatically responds to any problem by listening first. When one is a leader, this disposition causes one to be seen as servant first. This suggests that a non-servant who wants to be a servant might become a natural servant through a long arduous discipline of learning to listen, a discipline sufficiently sustained that the automatic response to any problem is to listen first. I have seen enough remarkable transformations in people who have been trained to listen to have some confidence in this approach. It is because true listening builds strength in other people.“ Es gibt Manager (darunter der derzeitige US-Präsident), die anderen kaum je wirklich zuhören, die stattdessen viel reden, sich gerne reden hören und sich als diejenigen auserwählten ansehen, die im Zentrum zu stehen haben, die den Weg zu weisen haben. Kurzum: Die zu sagen haben, wo es langgeht. Henry J. Kaiser war keiner dieser Menschen. Er bewies schon früh, dass Demut und wirtschaftlicher Erfolg keine Gegensätze sein müssen. Darauf, dass dem so ist, ver- weist auch Kristian Furch. Er meint, die zentrale Frage müsse heißen: Wie sollte man langfristig überhaupt erfolgreich Menschen führen können, ohne dabei demütig zu sein? In Demut macht stark (2008) legt Furch dar, dass gerade eine reflektierte, demütige Haltung Führungskräften hel- fen kann, ohne Angst und Selbstüberschätzung zu führen. Sie könne helfen, zu ausgewogenen Entscheidungen zu gelangen, was sich positiv auf die Geschicke des Unternehmens auswirkt. In Furchs Worten: „Wären wir schonungslos ehrlich mit uns selbst, müssten wir erkennen: Entweder jemand hilft uns bei dieser Aufgabe [Führung], oder wir verzehren uns in Stress und innerer An- spannung –, es sei denn wir verdrängen die wesentlichen Fakten“ (ebd., S. 24). Freilich ist es für Führungskräfte essenziell, bestimmte Fakten auszublenden, um überhaupt entscheiden zu kön- nen. Dietrich Dörner spricht in D ie Logik des Misslingens (2003) in diesem Zusammenhang davon, dass reduktive Hypothesen aufgestellt werden müssen, die eben nur einen Teilbereich der kom- plexen Wirklichkeit beleuchten: „Wenn ich eine reduktive Hypothese aufstelle und alles auf eine zentrale Variable zurückführe, mache ich mir nicht nur das Denken leichter, sondern es ergibt sich daraus auch das beruhigende Gefühl, die Dinge im Griff zu haben“ (ebd., S. 311).
Für Führungskräfte ist das überlebenswichtig. Für sie gilt die Devise: Die Situation beobachten, Informationen sammeln, mit Erfahrungen abgleichen, die richtigen Fragen stellen und entschei- den. So ergibt sich das handlungsleitende Gefühl von Kompetenz und Sicherheit, denn man hat das Problem durchschaut und auf den Kern reduziert. Dinge, die als irrelevant oder wirkungsarm betrachtet werden, werden ausgeblendet. Ein solches Verhalten ist vernünftig, da Handeln nur so möglich wird. Würde man versuchen, jede Wechselwirkung möglicher Handlungen in die Situ- ationsanalyse mit einfließen zu lassen, käme das einem Offenbarungseid gleich. Ein Analyseer- gebnis wie »alles korreliert irgendwie mit allem« ist kein befriedigendes Ergebnis. Problematisch ist allerdings, dass reduktive Hypothesen auch gefährlich werden können, wenn das Ausmaß der Reduktion so groß wird, dass »zu sehr« vereinfacht wird. Karl E. Weick und Kathleen Sutcliffe sprechen in Managing the Unexpected (2007) diesbezüglich von „biased problem definitions“, die dazu führen, dass bestimmte Entscheidungs- und Handlungsschemata, über die Führungskräfte verfügen, gerade unter Stress immer wieder zur Anwendung kommen, ohne dass hinreichend geprüft wird, ob diese mit Bezug auf die sich verändernde Umwelt überhaupt noch praktikabel sind. Das führt zu Problemen: „This biased search sets at least two problems in motion. First, you overlook accumulating evidence that events are not developing as you thought they would. Sec- ond, you tend to overestimate the validity of your expectations. Both tendencies become even stronger if you are under pressure. As pressure increases, people are more likely to search for confirming information and to ignore information that is inconsistent with their expectations. […]
Furthermore, people tend to look for confirmation that their existing routines are correct. […]
What is missing are continuing efforts to update the routines and expectations and to act in ways that would compel such updating” (ebd., S. 26). But what compels such updating? Was veranlasst eine Führungskraft, bestehende Entscheidungs- und Verhaltensmuster zu hinterfragen sowie ggfs. anzupassen? Oder anders gefragt: Woher weiß man, wann man »zu sehr« vereinfacht? Wo- her weiß man, dass man kognitive Dissonanzen dadurch auflöst, dass man sich die Welt seiner eigenen Logik nach uminterpretiert? Häufig erfährt man es erst dadurch, dass man - manchmal schmerzhaft - von anderen darauf aufmerksam gemacht wird. Weil auch die beste Führungskraft allein nicht alles überblicken kann und Gefahr läuft, sich durch Reduktion eine zu sehr verengte »Wirklichkeit« zu schaffen, bedarf eine Führungskraft immer der Unterstützung durch andere. Wäre dem nicht so, machte der Ausdruck Führung keinen Sinn, weil ja niemand da wäre, auf den es sich bezöge. Es ist ein Akt der Demut, sich und anderen einzugestehen, dass man Hilfe braucht, nicht alles weiß, von der Expertise anderer abhängig ist. Dafür muss man das eigene Ego zurück- stellen und anerkennen, dass Andere einen aufmerksam machen können auf blinde Flecken in der eigenen Situationseinschätzung. Andere Menschen können kritische Fragen stellen. Sie kön- nen Anregungen geben, Dinge auch anders zu betrachten, können andere Sichtweisen eröffnen und andere Bearbeitungswege aufzeigen. Man muss sie nur auch lassen. Denn sie werden all dies kaum tun, wenn man sie - gerade als Führungskraft - spüren lässt, dass man an ihrem Wissen, an ihrer Meinung, an ihrer Expertise kein Interesse hat.
Demut kann helfen, diese Ignoranz und falsche Selbstgewissheit zu vermeiden. „Demut bedeutet in diesem Sinne: Wir müssen uns nicht um alles selbst kümmern. Wir können es nicht einmal. Manches ist uns als Rahmen gesetzt, manches kann von anderen besorgt werden. Vieles, viel mehr als wir denken, werden wir nur dem anvertrauen können, der größer und genialer ist als wir selbst – ob wir das wollen oder nicht“ (Furch 2008, S. 28). Ein weiterer Punkt, der für die Demut spricht, ist, dass Demut nicht nur vor der Gefahr allzu reduktiver Hypothesen schützt, sondern auch davor, sich selbst zu überschätzen. „Der Beginn der Selbstüberschätzung, so könnte man sagen, ist die Unterschätzung der Komplexität des Lebens“ (ebd., S. 33). Gerade wenn sich Erfolge akkumulieren und über einen längeren Zeitraum hinweg konstant auftreten, wächst die Gefahr, auf Basis der Erfahrungen den Fortlauf dieser Positiventwicklung zu generalisieren. Es wächst die Gefahr, den Erfolg verkürzt primär dem »eigenen« Können und der »eigenen« Weisheit zuzu- schreiben, wie James March und Daniel Levinthal in The Myopia of Learning (1993, S. 209) darle- gen: „Confidence grows rapidly as learning produces increasing numbers of success. [...] Persis- tent success leads to a tendency to underestimate the risks [...].“ Da der konstante Erfolg blind machen kann für die Risiken des Scheiterns, wird of nicht bedacht, dass mitunter einfach nur viel Glück und Zufall mit im Spiel waren und die Entwicklung auch einen anderen Verlauf hätte neh- men können. „The consequence is that organizations systematically under-sample failure. […] In short, their past successes give executives an illusion of control” (ebd., S. 216). Demut kann Füh- rungskräfte davor schützen, der Illusion von Kontrolle und Planbarkeit zu verfallen. Der Demütige weiß, dass er nicht die vollständige Kontrolle über seine Umwelt besitzt, dass er nicht allmächtig ist, dass er nicht allein für Erfolge verantwortlich ist. Gerade »Alphatiere« haben es Kristian Furch zufolge besonders schwer, ihre Selbstüberschätzung zu überwinden. „Sie sind derart davon über- zeugt, die ‚Regeln des Lebens’ verstanden und in der richtigen Weise für sich nutzbar gemacht zu haben, dass sie oft nicht mehr bereit sind, einen notwendigen Paradigmenwechsel zu vollziehen. [...] Das Problem ist dabei nicht die starke Persönlichkeit des Alphatiers. Das Problem ist die Un- belehrbarkeit “ (Furch 2008, S. 34). Demut ermöglicht es auch vermeintlichen» Alphatier«-Mana- gern, Unbelehrbarkeit zu überwinden. Sie schafft die Basis dafür, anzuerkennen und wertzuschät- zen, dass andere Menschen eine ebenso wichtige Rolle spielen bei Erfolgen, wie man selbst. Das anzuerkennen muss keinesfalls mit einer Schwächung des eigenen Selbstwertgefühls einherge- hen. Denn: „Einer wirklich starken Persönlichkeit steht Demut nicht im Wege. Im Gegenteil, echte Demut setzt in gewisser Hinsicht sogar persönliche Stärke voraus. Nicht ohne Grund steckt im Wort Demut das Wort Mut. Demut heißt nicht, sich zu verstecken und auch nicht, passiv zu sein (wobei letzteres manchmal einen sehr positiven Effekt haben kann, etwa um Mitarbeitenden Frei- raum zu ermöglichen). Für den, der schwach und aufgrund großer Selbstzweifel passiv oder ent- scheidungsschwach ist, ist Demut nicht eigentlich Demut, sondern Unsicherheit und mangelnde Selbstannahme. Demut ist richtig ‚echt’, wenn ein Starker seine Knie beugt. Wenn Jemand, der weiß, was er kann, zusätzlich lernt, was er alles nicht kann, und sich daher auf sein Können, seine Stärke nichts (mehr) einbildet“ (ebd., S. 36 f.).
Hinzu kommt, dass Demut helfen kann, unabhängiger zu werden von Menschen und Umständen. Auf den ersten Blick scheint das natürlich paradox, da ja gerade erst dargelegt wurde, dass Demut unter anderem dadurch zum Ausdruck kommt, dass die eigene Abhängigkeit von anderen Men- schen anerkannt wird. Wie kann Demut da gleichzeitig »unabhängig« machen? Die Antwort lau- tet: Dadurch, dass man erkennt, dass der eigene Selbstwert »immer« besteht, unabhängig davon, welchen Stand man in der Gesellschaft innehat, welche Position man bekleidet oder welche Titel und Bezeichnungen man führt. Demut kann es ermöglichen, zu erkennen, dass man selbst nicht besser, aber auch nicht schlechter, nicht mehr, doch auch nicht weniger „wert“ ist als andere Menschen. Ganz gleich, wer man ist, ganz gleich, was man tut, ganz gleich, was man verdient. Demut kann helfen, „Menschen aus der Pflicht zu entlassen, uns Selbstwert zu verschaffen. Wir können den Druck von unseren Mitarbeitern nehmen, uns bestätigen zu müssen, und auch den, uns ihren ‚Wert’ durch ihre Leistung immer wieder nachzuweisen. Wenn wir Menschen nicht län- ger benutzen, um uns unseres Wertes zu versichern, dann sind wir von ihnen unabhängig“ (ebd., S. 43). Gemeint ist also keine Unabhängigkeit im Sinne von »Nicht-Angewiesen-Sein« auf andere, sondern Unabhängigkeit bezogen auf Wertmaßstäbe. Wird man sich bewusst, dass der eigene Selbstwert »nicht« davon abhängt, was andere von einem denken, fällt es deutlich leichter, sich auf die zu bewältigenden Aufgaben zu konzentrieren, ohne in mikropolitische Machtspiele zu ver- fallen. Das Zurschaustellen des eigenen Egos wird unwichtig, es muss keine Energie mehr inves- tiert werden in die Imagepflege. Es fällt leichter, mit anderen zu kooperieren, wenn man seinen Wert nicht an ihnen misst, sondern neidlos anerkennt, dass andere etwas besser erledigen, was sie eben nicht besser im Sinne von »wertvoller« macht als einen selbst. Es fällt somit leichter, zu Selbstreflexion zu finden, ausgeglichener zu sein, und Situationen realistischer, frei von Vorurtei- len, Imagesorgen und Zwängen, einzuschätzen. Der zur Demut Entschlossene ist frei dadurch, dass er sich nicht abhängig macht von seinem Job, seinem Image, seinem Standing im Unterneh- men. Diese Freiheit an den Tag zu legen hört sich allerdings leichter an, als es ist. Es birgt einige Gefahren. Der Demütige muss schließlich ganz real die Miete bezahlen, was schlecht möglich ist, wenn er aufgrund seiner demütigen Unangepasstheit gefeuert wird. Der Demütige kann und wird irritieren. Er wird einige Kollegen vor den Kopf stoßen. Doch gerade bei strategischen Entschei- dungsfindungen können solche Irritatoren helfen. Denn sie sind ehrlich. Manchmal schmerzhaft ehrlich. Sie beugen sich keiner Meinungsdiktatur. Sie sind keine Ja-Sager, sondern sagen, was sie denken, selbst wenn sie andere dadurch vor den Kopf stoßen. Solche Irritatoren können Struktur- blindheit verhindern. Sie können dafür sorgen, dass obsolete Prozeduren reflektiert und ggfs. ver- ändert werden. Sie können zu einem sorgfältigeren Abwägen der Eventualitäten anregen. Sie kön- nen inspirieren und neues initiieren. Sie können chronischen Erfolgsverallgemeinerungen entge- genwirken und die Gruppe vor Selbstüberschätzung bewahren. In diesem Sinne kann Demut hel- fen, der Realität ins Auge zu sehen. Eine demütige Haltung unterbricht den Zwang, alles durch die rosarote Brille des eigenen Wunschdenkens sehen zu wollen. Demütig sein heißt, zu akzeptieren, was ist, ohne das dann so lange umzuinterpretieren, bis es einem passt. Demut erdet, meint Kris- tian Furch (2008, S. 58 f.). Sie „bahnt den Weg in die Wirklichkeit, in die Gegenwart dessen, was wirklich wahr ist, ob es uns gefällt oder nicht. [...] Wir entdecken [durch Demut] die Realität. Diese Wahrheit macht uns frei, denn nun können wir - in aller Freiheit - angemessen und kreativ auf diese Situation reagieren“ (ebd., S. 58 f.).
Als Konsequenz aus dem bisher dargelegten ergibt sich, dass Demut helfen kann, die Teamfähig- keit zu steigern. Denn ist man sich erst einmal bewusst, dass man sich irren kann, dass der eigene Weg vielleicht nicht der optimale ist, fällt es leichter, die Hilfe von anderen anzunehmen und wertzuschätzen. Wer Mitarbeiter nicht nur als zu Führende betrachtet, sondern als kreative Sub- jekte begreift, die in ihrem jeweiligen Arbeitsgebiet über mehr Detailwissen verfügen als man selbst, und wer dieses Mitarbeiterwissen aktiv einfordert und annimmt, kann eher damit rechnen, dass Mitarbeiter gewillt sind, ihre Expertise zu teilen und im Sinne des Unternehmens einzuset- zen. Kurzum: „Die Lebenshaltung der Demut hilft uns, in einer Gruppe stets auch den Einzelnen zu sehen, seine Bedürfnisse und Beiträge im Gruppengefüge zu erkennen und das Miteinander der ganzen Gruppe zielgerichtet zu organisieren“ (ebd., S. 69 f.). Wertgeschätzte Mitarbeiter er- fahren, dass sie einen Unterschied machen. Sie sehen, dass es nicht belanglos ist, ob sie engagiert arbeiten oder Dienst nach Vorschrift schieben. Die Indifferenzzone wird dadurch kleiner – und die Leidenschaft wächst. Das heißt keinesfalls, dass ein Mehr an Demut automatisch dazu führt, dass alle Mitarbeiter effektiv und effizient zusammenarbeiten. Das wäre naives Wunschdenken. De- mut hilft, Konflikte durch mehr Ehrlichkeit zu lösen, sie verhindert diese aber nicht. Keine Füh- rungsideologie, kein einzelner Führungsstil und keine noch so verlockenden Incentives können dies gewährleisten. Wo immer Menschen zusammenkommen und zusammenarbeiten, ergeben sich hin und wieder Konflikte. Fehlkommunikationen lassen sich nie ganz ausschließen. Die unter- schiedlichen Persönlichkeiten, Fähigkeiten und Bedürfnisse von Menschen bedingen, dass sie sich nicht immer gut verstehen, ganz gleich, wie demütig sie auch sein mögen. Mehr Demut an den Tag zu legen kann helfen, Konflikte zu minimieren. Ganz verhindern lassen sich diese nie – und das ist auch gut so. Eine konfliktfreie Umgebung wäre nämlich gar nicht wünschenswert. Konflikt- frei sind Interaktionen, denen gegenüber die Mitarbeiter indifferent sind (Motto: »Das ist mir völlig egal«). Ihnen fehlt der emotionale Bezug. Ohne Leidenschaft gibt es kein Leid, also auch keine Konflikte. Gänzlich konfliktfreies Arbeiten ist oft Dienst-nach-Vorschrift-Handeln, das Un- ternehmen zu vermeiden suchen. Überdies sind Konflikte nicht selten der Ausgangspunkt von Innovationen. Man regt sich über etwas auf, was nicht klappt – und wird kreativ, um ein Ergebnis herbeizuführen, wie es doch klappt. Es ist für ein Unternehmen daher lebensgefährlich, wenn keine (produktiven) Konflikte mehr existieren. Konflikte gehen meist mit kritischen Diskussionen einher. Diese sind notwendig, um irritierbar zu bleiben, um sich somit „immer wieder an die wech- selnden Bedingungen eines sich wandelnden Marktes anzupassen“, wie Dörner (2003, S. 283) schreibt. Demut hilft, diese notwendige Anpassung zu vollziehen. Einfach deshalb, weil das de- mütige Sich-bewusst-Machen der eigenen Fehlbarkeit einen empfänglich macht für Veränderun- gen in der Umwelt oder Verstimmungen in der Belegschaft. Wie schon erwähnt: Weitsichtige Führer umgeben sich mit Menschen, die klüger sind als sie selbst. „»Führer befiehl, wir folgen dir!«, das ist die Devise der Dummheit“ (ebd., S. 289).
Weitsichtige, demütige Führer definieren ihren Selbstwert nicht über den Vergleich mit anderen. Sie haben es schlicht nicht nötig, ihr Selbstwertgefühl durch die Selbsterhebung über ihre Mitar- beiter zu konstituieren. Demütige Führer wollen keine kritiklosen Untergebenen, die zu allem Ja und Amen sagen. Denn sie wissen, dass auch sie nicht davor gefeit sind, ggfs. in die falsche Rich- tung zu steuern. Demut ermöglicht es Führungskräften, von anderen zu lernen und das eigene Handeln kritisch(er) zu betrachten. Wer Demut zeigt, dem fällt es leichter, sagen zu können: »Ich habe mich geirrt. Ich lag falsch«. Einem hochmütigen Führer würde es schwerfallen, sich das ein- zugestehen, geschweige denn, es anderen gegenüber zuzugeben. Demut eröffnet eine differen- zierte Sichtweise. Sie hilft, keinem Schwarz/Weiß-Denken zu verfallen. Denn das wäre für Unter- nehmen in einem hochgradig kompetitiven Weltmarkt voller Widersprüchlichkeiten und Grau- schattierungen fatal. Doch noch etwas anderes spricht für die Demut. Sie macht nicht nur ehrlich und vorsichtig, sondern schützt auch vor Machtmissbrauch. Führungsverantwortung geht mit Macht einher. In Macht und Organisation (1979, S. 39) definieren Michel Crozier und Erhard Fried- berg die Macht als asymmetrische Beziehung, in der einer Person die Rolle des „Machthabers“, der andere die des „Machtunterworfenen“ zugeschrieben wird. Das Ausmaß der Macht definiert sich über die Möglichkeit, auf andere Individuen einzuwirken. „Die Macht ist also letztlich in dem Freiraum angesiedelt, über den jeder der in eine Machtbeziehung eingetretenen Gegenspieler verfügt, das heißt, in seiner mehr oder weniger großen Möglichkeit, das zu verweigern, was der andere von ihm verlangt“ (ebd., S. 41). Nun kann es ein erhabenes Gefühl sein, mehr entscheiden zu dürfen, für andere weniger austauschbar zu sein, kurz: mehr Macht zu besitzen. Doch wer Spaß an der Macht hat, wer sich an ihr berauscht, der ist missbrauchsgefährdet. Und wer sich bewusst wird, dass er missbrauchsgefährdet ist, wird eher bereit sein, ein Stück der eigenen Macht aufzu- geben und Verantwortung zu delegieren, um im Interesse des Unternehmens zu gewährleisten, dass ausgewogene Entscheidungen von den Menschen getroffen werden, die aufgrund ihrer Fachkenntnis dazu am besten in der Lage sind, und nicht von denen, die allein aufgrund ihrer Position dazu befugt sind. „Wer [...] aus einer demütigen Haltung heraus eine natürliche Distanz zur Macht hat, obwohl er an sich eine starke Persönlichkeit ist - der ist zur Verwaltung von Macht erst wirklich in der Lage. Es ist ein Ausdruck von Stärke, distanziert und maßvoll mit Dingen um- zugehen, die besonders verlockend sind und daher mindestens zum interessengeleiteten Ge- brauch, wahrscheinlich auch zum Miss brauch einladen“, meint Kristian Furch (2008, S. 80). Mit Demut geht die Selbsterkenntnis einher, dass man ebenfalls zu Machtmissbrauch neigen könnte und daher frühzeitig dafür Sorge tragen muss, dass eben dies nicht geschieht. Führungskräfte haben die Aufgabe, so meint Anselm Bilgri (2012), „eine Kultur des Dienens zu initiieren, sie müs- sen dienend mit gutem Beispiel vorangehen. Wenn Führungskräfte ihren Mitarbeitern dienen, dann sorgen sie dafür, dass jeder gut informiert ist und seine Arbeit gut erledigen und die Ziele nachvollziehen kann.“
Demütig zu führen heißt demnach: Sich nicht über andere erheben, sondern die herausgehobene Stellung, die man hat, zu nutzen, um für die Mitarbeitenden da zu sein. Das funktioniert, wenn man als Führungskraft hinter den Mitarbeitenden steht. Auch darin zeigt sich Demut. Demütig zu führen heißt, Präsenz und echtes Interesse zeigen. Es heißt aber genauso, Verantwortung abzu- geben. Zur Demut gehört, Vertrauen in die Kompetenz der Mitarbeitenden zu haben. Im Wissen darum, dass man fehlbar ist, wird eine demütige Führungskraft aus Interesse am Erfolg der Orga- nisation darauf schauen, was die besonderen Fähigkeiten eines jeden Einzelnen im Unternehmen sind. Eine gute Führungskraft fordert und fördert Mitarbeiter. Sie ist bestrebt, eine möglichst gute Passung vom Können des Einzelnen und vom Bedarf der Organisation zu erreichen. Auch weiß eine demütige Führungskraft darum, dass nicht ein Einzelner für den Erfolg der Organisation ver- antwortlich ist, sondern dass die Personen auf allen Hierarchieebenen dazu beitragen, dass das Unternehmen prosperiert. Wolfgang Huber (2015, S. 25 f.), der ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, bringt es so auf den Punkt: „Führung hat mit Zielen zu tun – und mit Menschen. Führung hat mit Zielen zu tun, die in der Zukunft erreicht werden sollen. Niemand kann die Zukunft mit Sicherheit voraussagen; Führungsentscheidungen entbehren des- halb einer letzten Sicherheit. Manchmal erweisen sich ‚Bauchentscheidungen‘ als richtig und den präzise kalkulierten, auf Daten gestützten Entscheidungen als überlegen. Noch so sorgfältige Vor- bereitung kann in die Irre führen; ein andermal hat leichtsinnige Oberflächlichkeit verheerende Konsequenzen. Doch es kann auch umgekehrt sein. Ohne Gottvertrauen und Demut kommt nie- mand aus – selbst wenn ihm diese Denkweise ganz fremd ist.“
Humility + Will = Level 5 Leadership
Ein in Sachen Führung in Demut vielfach zitierter Autor ist Jim Collins. Vor bald 20 Jahren veröf- fentlichte er das Buch Good to Great (2001), in welchem er auf der Basis einer fünfjährigen Untersuchung der Frage nachgeht, wodurch erfolgreiche Unternehmen zu hervorragenden Un- ternehmen werden. Collins (2001a) meint dazu: „My research team and I set out to answer one question: Can a good company become a great company, and, if so, how? […] To answer that question, we looked for companies that had shifted from good performance to great performance – and sustained it. We identified comparison companies that had failed to make that sustained shift. We then studied the contrast between the two groups to discover common variables that distinguished those who made and sustained a shift from those who could have but didn’t. […] We began with 1435 companies that appeared on the Fortune 500 from 1965 to 1995; we found 11 good-to-great examples. That’s not a sample; that’s the total number that jumped all our hur- dles and passed into the study. Those that made the cut averaged cumulative stock returns 6.9 times the general stock market for 15 years after the point of transition. […] For each good-to- great example, we selected the best direct comparison, based on similarity of business, size, age, customers, and performance leading to the transition. […] With 22 research associates working in groups of four to six at a time from 1996 to 2000, our study involved a wide range of both qualitative and quantitative analyses.” Obwohl er den Fokus der Untersuchung nicht explizit auf die Unternehmensleiter richtete, stellte Collins fest, dass die Chief-Executive-Officers (CEOs) der jeweiligen Unternehmen einen entscheidenden Einfluss auf den Unternehmenserfolg hatten. Ins- besondere kam er zum Ergebnis, dass alle CEOs der erfolgreichsten 11 Unternehmen ähnliche Verhaltensweisen und Eigenschaften zeigten:
Eine paradoxe Mischung aus persönlicher Bescheidenheit einerseits und rigoros-professionellem Willen andererseits. „This rare combination [deep personal humility with intense professional will] also defies our assumptions about what makes a great leader. […] They routinely credit oth- ers, external factors, and good luck for their companies’ success. But when results are poor, they blame themselves. They also act quietly, calmly, and determinedly - relying on inspired standards, not inspiring charisma, to motivate” (Collins 2001a). Ebenso stellte Collins fest, dass die erfolg- reichsten Unternehmensführer der breiten Öffentlichkeit zumeist kaum bekannt sind, weil es sie nie auf die Titelblätter der bekannten Business-Magazine drängt. Sie haben es schlicht nicht nötig, ihr Selbstwertgefühl durch Publicity zu stärken, denn sie finden ihren Selbstwert in sich selbst, unabhängig von äußeren Einflüssen. Collins bezeichnet diese erfolgreichen Führungskräfte als Level 5 Leaders. Er schreibt über sie - und über die Organisationen, die sie führen oder in denen sie tätig sind - folgendes: „‘Level 5’ refers to the highest level in a hierarchy of executive capabili- ties that we identified during our research. Leaders at the other four levels in the hierarchy can produce high degrees of success but not enough to elevate companies from mediocrity to sus- tained excellence. […] And while Level 5 leadership is not the only requirement for transforming a good company into a great one […] our research shows it to be essential. Good-to-great trans- formations don’t happen without Level 5 leaders at the helm. […] Level 5 leaders are a study in duality: modest and wilful, shy and fearless” (ebd.). Aber was genau hat es auf sich mit diesen Level 5 Führungskräften? Collins und seine Kollegen klassifizierten fünft Entwicklungsstufen (Le- vel), die mit je eigenen Eigenschaften/ Verhaltensweisen der Führungskraft einhergehen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Was einen Führer des Level 4 von einem herausragenden Level 5 Leader unterscheidet, ist Collins zufolge nicht mehr Fachwissen oder Charisma, sondern vor allem die Einstellung bzw. das, was aufgrund des gezeigten Verhaltens als wahrscheinliche Einstellung interpretiert werden kann. Le- vel 5 Leader zeichnen sich einerseits durch ihre hohe Disziplin, Hingabe, Leistungsfähigkeit, -be- reitschaft und Kompetenz aus, andererseits auch dadurch, dass sie bescheiden sowie fähig sind, gut zuzuhören. Als Kern-Charakteristika benennt Collins folgende:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Wichtig ist dabei, zu verstehen, dass ein Level 5 Leader nicht zwangsläufig ein CEO oder sonst ein Manager auf dem hierarchischen Top-Level der Organisation sein muss. In seiner Studie betrach- tete Collins zwar speziell die CEOs, und sicher bedarf es, damit eine erfolgreiche Organisation zu einer herausragenden werden kann, eines Level 5 Leaders an deren Spitze. Schließlich werden dort die strategische Unternehmensausrichtung entschieden und es wird dort die gesamte Aus- richtung für die Führungs-, Personalakquise-, entwicklungs- und Organisationskultur gelegt. Ein Level 5 Leader muss jedoch nicht immer ein CEO sein. Auch ein Team- oder Bereichsleiter auf einer unteren Hierarchie-Stufe kann es sein, wenn er die richtige Einstellung mitbringt. Dessen Einfluss auf die strategische Unternehmensausrichtung mag beschränkt sein, er kann in der Inter- aktion mit Menschen in seinem Team oder Bereich allerdings all das an den Tag legen, was auch Level 5 Leader in der höchsten Etage auszeichnet. Was das genau ist, lässt sich als eine paradoxe Mischung beschreiben. „Humility + Will = Level 5“ – so Collins Gleichung. Level 5 Leader sind ge- erdet und bescheiden dergestalt, dass sie sich Erfolge nicht persönlich zuschreiben, sondern an- erkennen, dass viele Faktoren, u. a. die eigenen Mitarbeitenden, Erfolge erst ermöglichen. Sie schätzen die Mitarbeitenden auf allen Hierarchie-Leveln. Gleichsam haben Level 5 Leaders hohes Selbstvertrauen, ohne dadurch arrogant zu werden. Sie können hartnäckig, ja gar verbissen, sein, wenn sie von der Richtigkeit einer Sache überzeugt sind. Sie wollen und können ihren Willen durchsetzen. Gleichsam können sie auch sehr dialogfähig sein, wenn die Situation es erfordert, um einen Mehrwert für die Organisation zu generieren.
Level 5 Leader können indes nicht nur gut reden, sondern auch zuhören. Wenn sie unbedingt etwas durchsetzen wollen, liegt das nicht an einer arroganten Ich-habe-immer-Recht-Attitüde. Es liegt daran, dass sie sich Informationen eingeholt und diese mithilfe anderer kontextualisiert ha- ben. Wenn Level 5 Leader eine Ich-habe-Recht-Überzeugung an den Tag legen und verfolgen, liegt das daran, dass sie Mitarbeitenden aufmerksam zugehört und Schlüsse gezogen haben, die sie zu ihrer Einstellung gebracht haben. Die bisweilen zu beobachtende Verbissenheit von Level 5 Füh- rungskräften zeugt vom unbedingten Willen, das Beste für die eigene Organisation zu erreichen – und das nicht nur im Alltagsgeschäft, sondern auch in extremen Situationen, die sich dadurch auszeichnen, dass sie a priori keine umfassende Informationsakquise erlauben und dass schnell gehandelt werden muss. Level 5 Leader beherrschen dies souverän, weil sie trotz ihrer Erfolge immer auch reflektieren, was alles schiefgehen könnte. Sie verweigern sich vehement allzu simp- lifizierenden Erklärungen für beobachtete Phänomene, erwarten bzw. antizipieren Wechselwir- kungen von Entscheidungen und spielen Ideen kreativ durch. Dabei behalten sie stets die Boden- haftung. Auch sind sie demütig genug, Aufgaben schnell und konsequent an jene Mitarbeitende zu delegieren, die dafür kompetenter sind als sie selbst. Die bereits zitierten Kathleen Sutcliffe und Karl E. Weick (2015, S. 45 ff.) sprechen davon, dass es fünf zentraler Fähigkeiten bzw. Hand- lungs- und Denkmuster bedürfe, um Unerwartetes souverän managen zu können, um also erfolg- reich auch potenziell existenzbedrohende Zustände zu meistern und eine High-Reliability-Orga- nization (HRO) werden zu können. Level 5 Leader legen sie an den Tag. Es sind die folgenden:
- Preoccupation with Failure
Führungskräfte, die Unerwartetes managen können, sind besessen von Fehlern. Von sol- chen, die schon passiert sind, wie auch von solchen, die fast geschehen wären, jedoch gerade noch so verhindert werden konnten. Solche Führungskräfte reagieren auf Beinahe- Unfälle »nicht« mit einer Aussage wie „Ist-ja-nochmal-gut-gegangen“. Sie reagieren der- gestalt, dass sie systematisch erheben, warum es fast zu einem Fehler kommen konnte und was getan werden kann, damit das zukünftig nicht mehr passiert. War es menschli- ches Versagen? Technisches? Oder eine Kombination?4 Führungskräfte, die potenzielle Fehlerquellen reflektieren, denken über mögliche Wechselwirkungen nach und holen sich Input von Menschen auf allen Hierarchie-Leveln ein, wenn diese mehr Fachexpertise zu einem relevanten Thema haben. Was kann alles schief gehen? Was haben wir nicht be- dacht? Was passiert, wenn XYZ eintrifft? Wie gehen wir dann vor? – Solche und ähnliche Fragen sind handlungsleitend für Level 5 Leader.
- Reluctance to Simplify
Gregory Bateson (1983, S. 488) zufolge ist eine Information ein „Unterschied, der bei ei- nem späteren Ereignis einen Unterschied macht.“ Um Unerwartetes managen zu können, muss eine Führungskraft antizipieren, welche Informationen bedeutend sein können, was also später einmal einen Unterschied machen könnte. Eine Eigenschaft von Level 5 Füh- rungskräften ist es, Sachverhalte adäquat reflektieren, kontextualisieren und vereinfa- chen zu können, wobei es sie gerade auszeichnet, dass sie den Spagat bewerkstelligen, aus einer Vielfalt an Informationen schnell das Wesentliche herauszufiltern und es hinrei- chend - aber »nicht zu sehr« - zu vereinfachen. Level 5 Leader geben sich nicht mit Über- Simplifikationen zufrieden. Sie fragen, wenn sie eine Erklärung gefunden haben: Kann es noch einen anderen Grund geben? Ist das alles? Haben wir alles Wichtige bedacht? Sie vereinfachen, um handlungsfähig zu bleiben, tun das aber dosiert, im gebotenen Maße (vgl. dazu auch Dörner 2003). Sie können schnell Wesentliches von Unwesentlichem un- terscheiden und kluge Entscheidungen auf Basis unvollständiger Informationen treffen.
- Sensitivity to Operations
Level 5 Leader verfügen über ein hohes Maß an Situations- und Prozess-Bewusstsein. Sie haben ein gutes Gespür dafür, wie sich ihr Handeln und das Agieren anderer auswirkt. Sie sind sich Wechselwirkungen bewusst, können diese antizipieren, pro aktiv tätig werden und schnell reagieren, wenn die Situation es verlangt. Level 5 Leader handeln systemisch. Wenn das System sich ändert, sind Level 5 Leader imstande, sich mit ihm zu ändern und die Notwendigkeit von Änderungen ihren Mitarbeitenden schnell deutlich zu machen.
Sensitivity to Operations beinhaltet das Wissen darum, dass auch kleine Veränderungen große Auswirkungen haben können. Daher sind Level 5 Leader souverän im Entdecken und Bedeutungszumessen schwacher Signale. Sie sind fähig, vermeintliche Nebensäch- lichkeiten ob deren potenzieller Bedeutsamkeit zu eruieren und entsprechend zu handeln. Weick & Sutcliffe (2015, S. 78 f.) beschreiben das als „a mix of awareness, alertness, and action that unfolds in real time and that is anchored in the present.“ Sie bezeichnen diese hohe Sensibilität als „watchfulness for moment-to-moment changes in conditions“. Level 5 Leader bringen das mit.
- Commitment to Resilience
Level 5 Leader legen Resilienz an den Tag. Wenn das Unternehmen in stürmische Fahr- wasser gerät, bring sie das nicht aus der Fassung. Level 5 Leader bleiben souverän hand- lungsfähig auch dann, wenn sie mit Schwierigkeiten und Hürden konfrontiert sind, welche sie mittels bestehender Handlungsmuster und Konzepte nicht zu lösen imstande sind. Resiliente Führungskräfte zeichnet aus, dass sie Hürden und Probleme als Lernmöglichkeit für sich und ihre Organisation sehen. Level 5 Leader zeichnet dabei aus, dass sie auch bei begrenzter Informationslage entschlossen handeln und immer wieder prüfen, welche Auswirkungen ihre Handlungen haben. Zudem sind sie bereit, im Bedarfsfall gegenzusteu- ern und ihre Strategie zu ändern. Sie sind nicht ideologisch, sondern pragmatisch. Sie agie- ren nach dem Motto: What works, works. Sie sind proaktiv, aktiv und reaktiv. Mal mehr das eine, mal das andere, je nach Bedarf. Karl E. Weick benennt als eine zentrale Fähigkeit solcher Ausnahme-Führungskräfte, dass sie fähig und willens sind, ihre Werkzeuge (meta- phorisch wie real) abzuwerfen, wenn die Situation es verlangt. Level 5 Leader hängen nicht sklavisch an althergebrachten Traditionen und Denkmustern. Auch ist ihnen das Law of Instrument fremd. Sie tun, was sie in einer Situation jeweils für richtig halten, wobei ihr Denken nicht von Tradition, sondern von Notwendigkeit bzw. Sachdienlichkeit geprägt ist. Was haben wir hier? Was bewirkt das? Was haben wir bisher getan? Warum funktioniert das (nicht mehr)? Was können wir nun tun? – solche Fragen leiten ihr Handeln.
- Deference to Expertise
Die Demut von Level 5 Führungskräften, die Unerwartetes managen können, zeigt sich darin, dass sie bereit sind, Führungsverantwortung abzugeben an Personen, die für die jeweilige Aufgabenerledigung kompetenter sind bzw. mehr Wissen dafür mitbringen – und zwar unabhängig vom Hierarchie-Level. Entscheidungskompetenz wird unabhängig vom Rang und Status auf die Person übertragen, die mit dem jeweiligen Problem am bes- ten vertraut ist. Dirk Baecker benenne das in Postheroisches Managem ent (1994, S. 47) als „vagabundierendes Führungsverhalten.“ Führungskräfte, die ihm anhängen, haben demnach „nur noch, aber wesentlich, die Aufgabe zu sichern, dass das Zepter tatsächlich dorthin kommt, wo die Kompetenz sitzt, und anschließend nicht usurpiert, sondern weitergegeben wird.“ Abgesehen davon, dass ein solches Vorgehen der eigentlichen Auf- gabenerledigung dienlich ist, ist ein positiver Nebeneffekt, dass der Erhalt des Kompetenz- Zepters, die erlebte „Deference to Expertise“ ein Autonomieempfinden beim Empfänger evozieren und ihm Wertschätzung signalisieren kann.4
Level 5 Leaders legen die oben genannten Eigenschaften an den Tag. Ganz wie Henry J. Kaiser sind Level 5 Leader kompetent, selbstbewusst, weitsichtig und kommunikativ, mit einem Schuss Demut – so ließe sich es sich salopp zusammenfassen.5 Besonders interessant ist dabei, dass es gerade die hohen Ambitionen sind, unbedingt persönlich mehr erreichen zu wollen, die verhin- dern können, dass ein effektiver Führer (Level 4) zu einem herausragenden Führer (Level 5) wird. Denn hier kommt die Kombination von Willensstärke »und« Demut ins Spiel, die sich gerade nicht durch ein mehr an Einsatz und Leistungsbereitschaft erreichen, schon gar nicht trainieren lässt. Doch was genau hat es auf sich mit dieser Kombination von Demut und Bescheidenheit einerseits sowie Willensstärke andererseits? Zunächst kann festgehalten werden, dass Level 5 Leaders ihre eigene Rolle, ihr eigenes Zutun am Erfolg des Unternehmens, systematisch herunterspielen. Sie verweisen eher auf den Gruppenerfolg und auf die gute Arbeit anderer. „Indeed, throughout our interviews with such executives, we were struck by the way they talked about themselves. They’d go on and on about the company and the contributions of other executives, but they would in- stinctively deflect discussions about their own role. […] One Level 5 leader even asserted, ‘There are a lot of people in this company who could do my job better than I do’”, erklärt Collins (2001a).
Dass Level 5 Führungskräfte diese Positivattribuierung anderer wirklich ernst meinen, zeigt sich dadurch, dass sie viel Verantwortung delegieren, was ihnen deutlich leichter fällt als egozentrier- ten »Alphatier«-Managern. Während letztere ein Delegieren von Verantwortung oft mit einem Machtverlust assoziieren, geht es den Level 5 Führern nicht um selbstzweckhafte Macht, sondern um das, was am besten für das Unternehmen ist. „They channel ambition into the company, not the self“ (ebd.). Hinzu kommt, dass Level 5 Führungskräfte eine unglaubliche Willensstärke und Entschlossenheit zeigen. Sie erkennen zwar an, dass andere einen ebenso wichtigen - oder sogar wichtigeren - Beitrag zu Unternehmenserfolg leisten wie sie selbst, doch bedeutet dies keines- wegs, dass sie deshalb auch einen stark kooperativen Führungsstil zeigen müssen (was aber durchaus oft vorkommt). Level 5 Leader holen sich konstant Input und nutzen die Anregungen ihrer Mitarbeiter. Doch haben sie durch vorsichtiges Abwägen einmal eine Entscheidung gefällt, so lassen sie sich von ihrer Meinung kaum mehr abbringen und leiten alles ihnen Mögliche in die Wege, um dies durchzusetzen. Level 5 leaders „demonstrate an unwaivering resolve to do what- ever must be done to produce the best long-term results, no matter how difficult. They set the standards of building an enduring great company and will settle for nothing less” (ebd.). Das geht laut Collins so weit, dass Level 5 Leader ihre eigenen Familienangehörigen entlassen, wenn diese nicht die geforderte Performance zeigen. „When George Cain became CEO of Abbot Laboratories [...], he didn’t have the kind of inspiring personality that would galvanize the company. But he had something much more powerful: inspired standards. He could not stand mediocrity in any form and was utterly intolerant of any who would accept the idea that good is good enough.” Cain entließ mehrere Verwandte aus dem Familienbetrieb und stellte die besten Leute ein, die er finden konnte, unabhängig von persönlichen Vorlieben oder Freundschaften. Der Erfolg gab ihm Recht: „From its transition in 1974 to 2000, Abbott created shareholder returns that beat the market 4.5:1, outperforming industry superstars Merck and Pfizer by a factor of two.“ (ebd.) Level 5 Leaders zeichnen sich ferner dadurch aus, dass sie andere für Erfolge, sich selbst hingegen für Misserfolge, verantwortlich machen. Sie sehen sich selbst nicht in einer hervorgehobenen Posi- tion. Sie schreiben »ihre« Erfolge grundsätzlich anderen Menschen und äußeren Faktoren zu.
„Level 5 leaders, inherently humble, look out the window to apportion credit - even undue credit - to factors outside themselves. If they can’t find a specific person or event to give credit to, they credit good luck. At the same time, they look in the mirror to assign responsibility, never citing bad luck or external factors when things go poorly” (ebd.).
Level 5 Leaders ordnen ihren Eigennutz dem Nutzen des Unternehmens unter. Da sie keine über- steigerten Ambitionen für sich selbst haben, sondern eher um das Wohlergehen des Unterneh- mens besorgt sind, wählen sie meist hervorragende Nachfolger aus. Denn Level 5 leaders betrach- ten das Unternehmen nicht als Instrument des eigenen Machterhalts. Vielmehr wollen sie ihrem Unternehmen bestmöglich dienen, auch dadurch, dass sie dafür Sorge tragen, dass das Unterneh- men auch nach ihrem Abgang weiterhin erfolgreich geführt wird. „Level 5 leaders want to see their companies become even more successful in the next generation and are comfortable with the idea that most people won’t even know that the roots of that success trace back to them. As one Level 5 CEO said, ‘I want to look from my porch, see the company as one of the great compa- nies in the world someday and be able to say, ‘I used to work there’” (ebd.). Hier zeigt sich wahre Demut, denn der Manager stellt sich gerade »nicht« vor, wie er stolz ist auf »seine« Leistung, dieses Unternehmen geleitet zu haben. Er stellt sich schlicht vor, wie er, sicher auch stolz, nur eben auf die »Unternehmensleistung«, sagt: Ich habe dort »gearbeitet«. Ich war dort tätig und »das« war toll, nicht »ich« war toll – so die Überzeugung von Level 5 Leadern. Der demütige Ma- nager hebt die kollektive Leistung hervor, doch weiß er durchaus um die eigene Wichtigkeit für das Unternehmen. Denn wäre es ihm egal, wer an der Spitze steht, würde er kaum so sorgfältig nach gut qualifizierten, geeigneten Nachfolgern suchen. Doch eine Level 5 Führungskraft würde sich die eigene Wichtigkeit nicht eingestehen bzw. sie würde diese aufgrund ihrer Bescheidenheit nie zugeben: „According to our research, the Level 5 leaders were responsible for their compa- nies’ transformations. But they would never admit that. We can’t climb inside their heads and assess whether they deeply believed what they saw through the window and in the mirror. But it doesn’t really matter, because they acted as if they believed it, and they acted with such consistency that it produced exceptional results” (ebd.). Nun bleibt noch eine Frage offen: Wie wird man überhaupt ein Level 5 Leader? Kann man so etwas werden? Oder ist man es, oder man ist es nicht? Collins und Kollegen liefern darauf keine Antwort: „Our research, frankly, did not delve into how Level 5 leaders come to be, nor did we attempt to explain or codify the nature of their emotional lives. We speculated on the unique psychology of Level 5 leaders. Were they ‘guilty’ of displacement - shifting their own raw ambition onto something other than themselves?
Were they sublimating their egos for dark and complex reasons rooted in childhood trauma? Who knows? [...] We could speculate on what that inner box might hold, but it would mostly be just that: speculation” (ebd., S. 10-11). Wenn aber alles, was die innere Verfasstheit solcher Menschen anbelangt, nur Spekulation ist, wenn nicht sicher ist, was Level 5 Führer »wirklich« denken und weshalb sie so denken, wie kann man dann wissen, welche innere Einstellung man selbst ent- wickeln muss, um ein solcher Ausnahmeführer zu werden? Die Antwort ist, dass man es nicht mit Sicherheit wissen kann. Mit Collins Worten: „We would love to be able to give you a list of steps for getting to Level 5 […] but we have no solid research data that would support a credible list” (ebd.). Das ist nun natürlich unbefriedigend. Es existiert dennoch eine praktikable Möglichkeit, sich dem Ideal eines Level 5 Leaders anzunähern. Durch »Imitation«. Frei nach dem Motto: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Wenn man nicht weiß, was für Einstellungen man entwickeln muss, ist der erfolgversprechendste Weg, ein Level 5 Leader zu werden, sich so zu verhalten, als wäre man einer. Und selbst wenn sich das nicht sofort - oder gar nie - als zielführend erweist, was hat man schon zu verlieren, wenn man neuen Aufgaben mit einer demütigen Entschlossenheit begegnet und das eigene Ego etwas zurückfährt? Allenfalls etwas Hochmut.
(Do not) fake it – Falsche Demut und Paradoxien
Bisher dargelegt wurde, weshalb es für Führungskraft sinnvoll sein kann, Demut zu zeigen. Es wurde auf die positiven Seiten der Demut eingegangen. Es stellt sich jedoch die Frage, ob Demut wirklich per se immer erstrebenswert ist, oder ob sie nicht vielleicht gar auch schaden kann. Einige Fakten und theoretische Überlegungen sollen, gerade nach den vorangegangenen Lobpreisungen auf die Demut, hier diesbezüglich Erwähnung finden. Wie schon beschrieben kam Jim Collins in seiner Untersuchung aus 2001 zum Ergebnis, dass von den 1435 Fortune 500 Companies ganze 11 von bescheidenen, demütigen Level 5 CEOs geführt wurden. Das heiß im Umkehrschluss hin- gegen auch, dass 1424 der Companies von CEOs geführt wurden, die sich nicht unbedingt durch Demut und Bescheidenheit auszeichnen. Und dennoch waren diese 1424 Unternehmen »auch« sehr erfolgreich. Sie waren nicht »so« erfolgreich wie die Unternehmen mit Level 5 Leadership, aber in den Fortune 500 werden immerhin die erfolgreichsten Unternehmen der Welt gelistet. Auch diese 1424 Unternehmen erzielten, verglichen mit der Gesamtwirtschaft, deutlich über- durchschnittliche Ergebnisse. Ein weiteres Indiz dafür, dass man es auch ohne Demut weit bringen kann, brachten Paul Babiak, Craig Neumann & Robert Hare in ihrer Untersuchung Corporate P s ychopathy: Talking the Walk (2010) ans Licht. Sie konnten nachweisen, dass in Top-Positionen in der Wirtschaft etwa dreieinhalbmal so viele Psychopathen wie im Durchschnitt der Bevölke- rung zu finden sind. Robert Hare, international anerkannter Experte in der Erforschung der Psy- chopathie, führte schon vorher Untersuchungen durch, die Ähnliches zeigten. Er sagte bereits 2002, dass längst nicht alle Psychopathen im Gefängnis säßen oder kriminell seien. Manche fän- den sich auch in herausgehobenen Führungspositionen (vgl. ebd. S. 174). Konkret schreiben Ba- biak, Neumann & Hare (ebd, S. 188 f.): „Interestingly, some with very high psychopathy scores were high potential candidates and held senior management positions: vice-presidents, supervi- sors, directors. This provides support for the argument that somepsychopathic individuals ma- nage to achieve high corporate status […] Perhaps the most dramatic results of this study had to do with how the corporation viewed individuals with many psychopathic traits. That is, high psy- chopathy totalscores were associated with perceptions of good communication skills, strategic- thinking, and creative/innovative ability and, at the same time, with poor managementstyle, fai- lure to act as a team player, and poor performance appraisals (as rated by their immediate bos- ses). These latter associations were rather strong.“ Eine nicht pathologische Ausprägung dessen, was Psychopathen zeigen, ist Narzismuss. Dass sich Demut und Narzissmus nicht ausschließen, zeigten Bradley Owens, Angela Wallace & David Waldman (2015) in Leader narcissism and follo- wer outcomes: The counterbalancing effect of leader humility. Die Forscher erklären:
„Although an examination of leaders who are narcissistic yet humble may seem oxymoronic and even paradoxical, researchers have suggested that seemingly contradictory personal attributes may exist simultaneously and may actually work together to produce positive outcomes. Results from survey data from followers and leaders working for a large health insurance organization showed that the interaction of leader narcissism and leader humility is associated with percepti- ons of leader effectiveness, follower job engagement, and subjective and objective follower job performance. Together, these results suggest that narcissistic leaders can have positive effects on followers when their narcissism is tempered by humility.“ Es ist also keinesfalls so, dass »nur« Demut und Bescheidenheit Erfolgsgaranten wären. Dass Hochmut und Arroganz das eigene Fort- kommen auch recht gut befördern können und zudem mitunter noch mit großem Unternehmens- erfolg einhergehen, haben diverse Manager, die wegen Untreue, Abgasmanipulationen, Steuer- hinterziehung und anderen Taten angeklagt wurden, zur Genüge bewiesen. Und diese Liste ließe sich noch lange fortsetzen. Es stimmt zwar: Demut kann davor schützen, den Gefahren von Er- folgsverallgemeinerung und Selbstüberschätzung zu erliegen. Doch können Erfolgsverallgemei- nerung und Selbstüberschätzung ja auch positiv wirken. Die Menge macht - wie so oft - das Gift. Ein positiver Aspekt dessen, sich eines Zuviels an Demut zu verweigern und sich ggfs. gar selbst zu überschätzen, kann insofern positiv wirken, als Selbstüberschätzung es überhaupt erst ermög- licht, sich Aufgaben anzunehmen und Ziele in Angriff zu nehmen, denen man sich mit einem we- niger ausgeprägten Ego vielleicht nie gestellt hätte. Wer sich selbst überschätzt, kann scheitern – aber auch gewinnen. Doch wer mit einer realistisch demütigen Haltung und dem Bewusstsein der eigenen Fehlbarkeit und des unendlichen Zurückbleibens hinter dem eigenen Ideal „gesegnet“ ist und daher seine Erfolgschancen immer gleich realistisch einschätzt, (was manchmal auch realis- tisch schlecht bedeutet), der wird vielleicht eher seltener gewinnen, einfach weil er es dank seiner Demut gar nicht erst versucht. Warum auch? – so könnte der Demütige fragen. Es ist ja ohnehin alles in Gottes Hand. Darauf, dass Selbstüberschätzung in Folge von Hochmut positiv wirken kann, geht auch die Journalistin Tina Groll (2015) - bezugnehmend auf die Forschungsergebnisse der oben bereits zitierten Babiak et al. und Owens et al. - in einem Artikel auf ZEIT-Online ein. Groll schreibt, es hätten „Vorgesetzte dann die engagiertesten Mitarbeiter und besten Unternehmens- ergebnisse, wenn sie leicht narzisstische Persönlichkeitsmerkmale aufweisen – aber trotzdem De- mut zeigen können. Dazu gehört etwa, Fehler eingestehen zu können, Dankbarkeit für die Leis- tung der Mitarbeiter zu zeigen oder anzuerkennen, wenn die Untergebenen mehr wissen als der Chef selbst. […] Fehlt dem Chef ein narzisstischer Geltungsdrang und verzichtet er völlig auf Alpha- Gehabe, spornt das die Mitarbeiter offenbar nicht zu Höchstleistungen an. Ebenso verweigern sich viele Beschäftigte, wenn der Chef seinen Narzissmus völlig auslebt und wenig Empathie und Gespür für die Mitarbeiter mitbringt. […] Chefsein erfordert eine Prise Egoismus und Geltungs- drang. […] Es braucht starke und angstfreie Typen, die Gruppen leiten. […] Für die heutige Arbeits- welt gilt indes: Ohne Empathie geht es nicht.“ Doch auch Empathie kann eine Schattenseite ha- ben, zumal die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen, auch ermöglicht, andere zu manipu- lieren (umfassend dazu siehe Breithaupt 2017).
Ein potenziell positiver Aspekt von Selbstüberschätzung ist, dass erste Erfolge, die aus einer sol- chen resultierten können, nicht selten Anknüpfungspunkte für ein weiterführendes Bestreben schaffen, noch besser zu werden und noch mehr zu erreichen. Ganz im Sinne des Gleichnisses von den anvertrauten Talenten im Matthäus-Evangelium, wo es heißt: „Denn wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe.“ Es kann sich gut anfühlen, es kann das Selbstwertgefühl stärken, sich ein Mehr an Erfolgen zuzuschreiben, sich selbst also einzureden, dass man die Kontrolle über die Dinge habe und es (was auch immer) selbst geschafft habe. Dass dies nicht immer stimmt, steht außer Frage. Nichtsdestotrotz kann die mögliche erbauende Wirkung solcher Gedanken kaum in Abrede gestellt werden. Hinzu kommt, dass Demut sich auch vortrefflich eignet, die Über- nahme von Verantwortung für die Resultate des eigenen Handelns zu negieren, frei nach dem Motto: Ich Demütiger, ich weiß ja, dass ich nichts bin. Und ich bin ja nicht verantwortlich. Das ist halt Gottes Wille, dass ich durch die Prüfung gefallen bin, das Haus abgebrannt ist, die Frau mich verlassen hat usw. Natürlich ist das, wenn Demut Wahrheit ist, falsche Demut, oder einfach Dummheit. Dennoch besteht die Gefahr, in aller Demut solche Überlegungen durchzuspielen. Doch selbst wenn man das nicht tut, könnte es sein, dass man, wenn man ernsthaft nach mehr Demut strebt, vielleicht einmal ermessen will, wie demütig man nun eigentlich geworden ist.
„ Habe ich schon Fortschritte gemacht?“ - das ist eine legitime Frage. Doch auch hier fällt die Ant- wort nicht leicht, denn was hat man schon für Indikatoren zur Messung der eigenen Demut? Sicher, man kann Bilanz ziehen und sich vor Augen führen, wie oft man wann und zu welchen Anlässen den Hochmut unterdrückt und sich gezwungen hat, ganz demütig zu denken, „das ist nicht allein mein Erfolg, ich bin nicht verantwortlich, ich habe das ja gar nicht verdient usw.“ Und vielleicht hat man es manchmal sogar wirklich gedacht und musste gar nichts bewusst unterdrü- cken. Das wäre noch besser. Einfacher wäre es wohl, das eigene Verhalten mit dem von anderen zu vergleichen. Das jedoch führt wieder zu einem Problem: Denn zum einen weiß man, wenn Demut eine Geisteshaltung ist, ohnehin nie, ob andere Menschen, die man zum Vergleich heran- ziehe, überhaupt demütig sind, geschweige denn, in welchem Ausmaß. Über ihre inneren Zu- stände kann man nur spekulieren. Zum anderen kann das eigene Streben nach einer Zustands- bestimmung über einen Vergleich mit anderen wieder als Überheblichkeit ausgelegt werden. Wenn man andere Menschen als Maßstab der eigenen Demut heranziehe, läuft man schließlich Gefahr, sich im Ausmaß der eigenen Demut eventuell über ihnen zu verorten. Und schon ist das ganze Streben nach mehr Demut wieder zunichtegemacht, weil man mich über andere erhöht hat. Kurzum ist es wirklich nicht leicht, mehr Demut anzustreben.
Noch diffiziler wird die Beurteilung der Demut, wenn man das Augenmerk auf die Bereiche Politik oder Wirtschaft richtet. Gerade von den Eliten in beiden Feldern wird häufig Demut gefordert, doch wird es gleichsam längst nicht immer wertgeschätzt, wenn ein Politiker oder Manager sich tatsächlich demütig gibt. Denn bei so etwas schwingt gleich der Zweifel mit, ob das, was da prä- sentiert, gesagte oder getane wird, auch wirklich ernst gemeint ist, ob es also echte Demut ist – oder nur Show, die dem Impression Management dient. Sogleicht wird die Demut unter den Ver- dacht der Heuchelei gestellt. Und Heuchelei ist natürlich hoch verwerflich. Politiker und Manager haben Vorbilder zu sein. Die dürfen nicht heucheln. Nur warum eigentlich nicht? Was macht Heu- chelei so verwerflich? Heuchelei bezeichnet allgemein hin, etwas zu sagen und dann konträr zu handeln bzw., etwas zu sagen, dann einmal danach zu handeln (oder so zu tun), an anderer Stelle aber wieder entgegengesetzt zu agieren. Demut - verstanden als Akzeptieren von Wahrheit - und Heuchelei sind somit unvereinbar, denn der Heuchler biegt sich seine Wahrheit ja gerade so zu- recht, bis sie ihm passt. Glaubt man dem bekannten Globalisierungskritiker Jean Ziegler, so be- treiben fast alle multinationalen Konzerne ein manchmal geradezu gigantisches Ausmaß an Heu- chelei. Im Buch Das Imperium der Schande (2008) legt Ziegler am Beispiel des Weltkonzerns Nestlé dar, wie das Unternehmen sich einerseits rühmt, den Zugang zu Trinkwasser und Milch- pulver in Afrika zu verbessern, es andererseits durch eine extrem rigide Preisgestaltung für viele Menschen in armen Regionen unmöglich macht, die Produkte zu konsumieren. Zur gleichen Zeit verkündet der ehemalige CEO von Nestlé, Peter Brabeck, allen Ernstes, er halte es für eine „ext- reme Ansicht“, dass es ein Grundrecht auf Wasser gäbe. Stattdessen solle es einen Marktwert haben, um die Wertschätzung für Wasser zu erhöhen.6 Und während Nestlé, Mars, Mondelez, Ferrero u. a. in den Industrieländern Werbekampagnen für ihr - verschwindend geringes - Kontin- gent an Fairtrade-Bio-Schokolade laufen lassen, setzen sie bzw. ihre Zulieferer beim regulären Kakaoanbau gesundheitsschädliche Pestizide ein – und auch von Kinderarbeit auf Kakaoplantagen wird in journalistischen Reportagen berichtet.7 Viele Konzerne rühmen sich für ihr soziales Enga- gement, wobei die Realität häufig so aussieht, dass unter 1 % des Gewinns in Hilfsprojekte inves- tiert, allerdings ein Vielfaches dessen für die Vermarktung des vermeintlich sozialen Engagements gesteckt wird. Ist das nicht heuchlerisch? Zweifellos. Aber kann man es Konzernleitern verdenken, dass sie nicht demütig vor die Fernsehkameras und fragwürdige Geschäfte gestehen? Wohl kaum. Denn führt man sich einmal vor Augen, mit welch widersprüchlichen Anforderungen viele Unter- nehmen konfrontiert sind, wird deutlich, dass sich mit vermeintlichen Weisheiten wie »Demut macht stark« oder »Die Letzen werden die Ersten sein« kaum solide wirtschaften lässt. Vielmehr sind Scheinheiligkeit und Heuchelei manchmal erforderlich. Natürlich ist es der Wunsch eines je- den Unternehmens, widersprüchliche Anforderungen aufzulösen. In einer überaus inkonsisten- ten, irrationalen Umwelt macht es allerdings überhaupt keinen Sinn, einer einmal ausgegebenen Linie für alle Zeit bedingungslos treu zu bleiben, wie Stefan Kühl in seinem Artikel Lob der Heu- chelei in der Zeit (2007, Nr. 39, S. 16) schreibt:
„Damit würde man dann zwar dem Anspruch von Reinheit und Konsistenz genügen, gleichzeitig aber in vielen Gruppen an Unterstützung verlieren. Die Logik ist simpel: Entscheidet man sich grundlegend für die eine, dann bleibt die andere Seite notgedrungen unbefriedigt - ein hohes Risiko für Organisationen.“ Anstand, Bescheidenheit, Demut, oder allgemein »mehr Werte« sind leicht gefordert, doch nicht so leicht mit realen Anforderungen zu vereinbaren. Einerseits sollen Unternehmen ihre Arbeitskräfte gut entlohnen, anderseits auch gute Gewinne abwerfen. Unter- nehmen sollen sozial verantwortlich handeln, ebenso konkurrenzfähig sein, auch gegenüber Kon- kurrenten, die Sozialstandards verletzen und sich dadurch einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Der demütige Unternehmensmanager handelt moralisch integer. Diese gelebte Moral ist in der Wirtschaft allerdings nicht umsonst zu haben. Moralität kostet Geld, welches letztlich in das Pro- dukt oder die Dienstleistung eingepreist wird, die ein Unternehmen anbietet. Hohe moralische Standards (bessere Arbeitsbedingungen, höhere Löhne, mehr Umweltschutz etc.) zu setzen be- wirkt in der Regel, dass das Produkt bzw. die Dienstleistung teurer wird. Wenn das geschieht, zeigt sich, dass viele Verbraucher nicht minder heuchlerisch sind als Unternehmen. Viele Kunden behaupten, dass sie bereit wären, für fair produzierte Waren mehr zu zahlen. Häufig ist die Rea- lität eine andere. Selbst wenn neben der Packung des regulär produzierten Kaffees die mit dem fair produzierten liegt, greift das Gros der Verbraucher, darunter selbst die Gutverdiener, doch zum günstigeren Produkt – vor allem die preissensiblen deutschen Verbraucher. Betrachtet man das Beispiel Nestlé von diesem Blickpunkt, wird deutlich, dass das Unternehmen zwar heuchelt, dass es aber kaum eine Möglichkeit gibt, anders zu handeln. Nicht über Demut, sondern nur über Heuchelei gewinnt und hält man Kunden mit verschiedensten Präferenzen. So kommt man gleich- sam der Konkurrenz zuvor. Nur Heuchelei gestattet es, allen Konsumentengruppen das zu bieten, was diese verlangen. Nestlé bietet, um bei dem Beispiel zu bleiben, Fairtrade - Bio-Schokolade für Kunden, die sozialverträglich produzierte, biologische Produkte nachfragen – und bereit sind, da- für zu zahlen. Ebenso hat der Konzern günstigere Massenware im Angebot, die weder biologisch noch besonders sozialverträglich produziert wird – für jene weit größere Kundengruppe, die »nicht« bereit oder fähig ist, für nachhaltige Ware mehr zu zahlen. Und dann gibt es auch noch die selektiven Moralisten unter den Verbrauchern. Das sind jene, die zwar bei ihren Bananen oder dem Kaffee darauf achten, dass diese fair gehandelt und biologisch produziert werden, denen es aber davon abgesehen herzlich egal ist, unter welchen Bedingungen ihre Konsumgüter produziert werden. Von der urbanen LOHAS-Klientel, das mit dem Porsche Cayenne zum Bio-Supermarkt fährt, ganz zu schweigen.8 Diese - teils vielleicht zugespitzten - Beispiele zeigen, dass Heucheleien von Unternehmen seitens vieler Verbrauchern oft nur vordergründig missbilligt werden. Das reale Konsumhandeln vieler Verbraucher spricht eine andere Sprache, denn die Unternehmen liefern letztlich, was Verbraucher wünschen. Wer heuchelt, so stellt sich daher die Frage, eigentlich mehr? Kunde oder Unternehmen? Hier passt vortrefflich der Ratschlag Jesu aus der Bergpredigt:
„Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge. Und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen“ (Matthäus 7, 5).
Noch ein weiterer Punkt sei hier angesprochen, der die Tugendhaftigkeit der Demut ein wenig relativiert: Die Frage nach dem Ergebnis der Demut. Die möglichen Vorteile, die Demut mit sich bringen kann, wurden schon thematisiert. Doch welche Rolle spielt die Haltung der Demut eigent- lich bei der Beurteilung des Ergebnisses? Oder anders gefragt: Zählt das Ergebnis nicht mehr als die Haltung? Haltung steht, so beschreiben es Königswieser & Hillebrand in ihrer Einführung in die systemische Organisationsberatung (2017, S. 39), „in enger Verbindung mit unserer Identität, dem Charakter, den Einstellungen, Wahrnehmungsweisen und Wirklichkeitskonstruktionen. Hal- tung steuert unsere Denk- und Verhaltensweisen, liegt ihnen zugrunde, ist aber auch wieder ihr Ergebnis.“ Haltung sei, so Königswieser & Hillebrand, „die Art und Weise, wie wir uns zu uns selbst und zu unserer Umwelt in Beziehung bringen, wie wir uns mit unserer Aussen- und Innenwelt auseinandersetzen, wie wir Beziehung gestalten, in welchen ‚Schienen‘ wir denken und wahrneh- men.“ Sie bestimmt letztlich, „was wir ‚wahrnehmen‘ oder für falsch halten.“ Zu fragen ist hier jedoch: Was zählt mehr? Die Haltung, oder die Tat? Ist es nicht wichtiger, zu beurteilen, was am Ende herauskommt, statt den Fokus darauf zu richten, mit welcher Geisteshaltung etwas getan wurde? Auch ein demütiger Mensch kann schlechte Taten vollbringen, selbst wenn er Gutes intendiert. Ebenso kann ein hochmütiger Mensch viel Gutes vollbringen, auch wenn er das nur aus Eigennutz tut. Ist die Tat eines Demütigen, der Gutes tut, aber nur deshalb höher einzuschät- zen, weil er demütig ist – oder sich so gibt?9 Es kann vermutet werden, dass sich zahlreiche Kon- zerne im Zuge ihrer Corporate-Social-Responsibility-Kampagnen der Demut nicht (primär) aus ge- nuiner Überzeugung bedienen, nicht aufgrund ethischer Werte, sondern eher aus legitimatori- schen Gründen. Die Umwelt verlangt es, die Konzerne passen sich an. Sie tun, was Stakeholder von Ihnen erwarten. Die Konzernleiter argumentieren demütig, sie seien sich ihrer sozialen Ver- antwortung bewusst und setzen sich deshalb für bessere Arbeitsbedingungen und allgemein für soziale Projekte ein. Denn schließlich sei man als Teil der Gesellschaft auch dieser verpflichtet. Der ehemalige Porsche-Manager Wendelin Wiedeking schreibt in seinem Buch Anders ist Besser (2006, S. 18) zum Nutzen erfolgreicher CSR: „Soziale Verantwortung und Gewinnorientierung ge- hen eine höchst vorteilhafte Symbiose ein, und das Unternehmen thesauriert darüber hinaus so- ziales Kapital durch Glaubwürdigkeit bei den Kunden und in der Öffentlichkeit.“ Vermutlich ist es eher Legitimationskitsch als die Akzeptanz wahrer sozialer Verantwortung, wenn den Kunden suggeriert wird, sie unterstützen durch Biertrinken den Erhalt des Regenwaldes, ermöglichten durch Hamburger-Essen den Bau von Kinderheimen in Afrika, trieben durch den Kauf von CDs den Wiederaufbau in Tsunami-Gebieten voran oder trügen durch den Konsum eines bestimmten Weins dazu bei, Menschen zu unterstützen, die durch die Corona-Krise ihren Job verloren haben.
Das beste Beispiel für solche Offerten liefert das Unternehmen, das wie kein anderes von der aktuellen Corona-Krise profitiert: Amazon. „AmazonSmile ist ein einfacher Weg für Kunden, mit jedem Einkauf über Amazon einer sozialen Organisation ihrer Wahl etwas Gutes zu tun - ohne zusätzliche Kosten für Kunden oder Organisationen“ – das schreibt der Internet-Gigant auf seiner Homepage bzgl. des Smile-Programms, durch dessen Nutzung Amazon „0,5 % der Einkaufssumme aus eigener Tasche an eine vom Kunden gewählte soziale Organisation weitergibt.“ Das ist zwei- fellos eine tolle Sache. Zweifellos geschieht es aber auch aus legitimatorischen Gründen. Amazon will das eigene Image dadurch aufpolieren. Zu fragen ist nun allerdings: Ja und? Selbst, wenn es eigennütziger Legitimationskitsch ist, der das soziale - und in Folge auch reale - Kapital vermehren soll, was ist so schlimm daran? Konzerne, die sich einer CSR-Strategie wie der von Amazon bedie- nen, tun ja real durchaus Gutes. Sie spenden an wohltätige Organisationen. Warum auch immer. Natürlich: Die Konzerne heucheln und bedienen sich dabei falscher Demut nur deshalb, da es von ihnen erwartet wird, weil es die Rendite zu steigern verspricht. Aber dennoch: Sie »tun« Gutes. Selbst wenn sie es eigennützig tun, weil es sich finanziell auszahlt, gilt: Solange überhaupt in der Form gehandelt wird, dass neben dem reinen Erwirtschaften von Profiten auch ein positiver Ge- samtnutzen für die Gesellschaft entsteht, ist es müßig, über die Haltung zu streiten, mit der ein bestimmtes Ergebnis erzielt wurde. Entscheidend ist, was am Ende rauskommt. Der Demütige muss individuellem Vorteilsstreben gegenüber skeptisch sein, denn dieses kann zu Hochmut und Egoismus verführen. Das Negieren von Eigennutz ist aber naiv. Es geht nicht nur am individuellen Vorteilsstreben eines jeden Menschen vorbei, es widerspricht auch der ökonomischen Logik und führt in einem marktwirtschaftlichen Wirtschaftssystem schnell in den Ruin. Was also bringt dann noch die Demut? Wer ob seiner Bescheidenheit und demütigen Maßhaltung pleitegeht, der kann überhaupt gar niemandem mehr helfen, weder sich, noch den Mitarbeitern, noch der Gesell- schaft. Hauptsache demütig, das ist deutlich zu kurz gedacht. Angebracht ist, nicht in ein Schwarz/Weiß-Denken im Sinne von „Demut ist gut, Heuchelei ist schlecht“ zu verfallen. Daher sollten wir uns zurückhalten in Anklagen, wenn wir beim Schauen der Nachrichten mal wieder reflexartig über die Heuchelei von Managern herziehen. Insbesondere sollten wir uns davor hü- ten, Unternehmen per se unter den Generalverdacht zu stellen, doch nur Profit ohne Skrupel erwirtschaften zu wollen. Denn, so schreibt der Wirtschaftsethiker Karl Homann: Nur „die Unter- nehmen verfügen über das erforderliche Kapital und über das notwendige Know-how, wie man gesellschaftliche Interaktionsprozesse effizient organisiert“ (2007, S. 34). Unternehmen werden sich aber nur dann einbringen, wenn auch sie Vorteile zu erwarten haben. Wer allzu anklagend an sie herantritt und „Unternehmen als Gegner einstuft, deren Aktivitäten man ‚bändigen’ müsse, verliert den potenziell stärksten Partner im Kampf für die ‚bessere Welt’“ (ebd., S. 34). Eine bes- sere Welt ist nicht per se eine Welt, in der alle demütig sind und sich ihre Unvollkommenheit eingestehen. Eine bessere Welt wäre schon eine, in der noch deutlich mehr Unternehmen durch ihr Handeln zeigen, dass sie ihre soziale Verantwortung annehmen. Was deren jeweilige CEOs dabei denken und welche innere Haltung sie haben, ist allein deren Sache.
Demütig(er) führen – Was bleibt?
Was lässt sich nun festhalten in Bezug auf die Demut? Ist Demut eine erstrebenswerte Haltung? Ist sie nützlich? Ist Demut notwendig, um Menschen effektiv führen zu können? Und macht ein Mehr von ihr uns zu glücklicheren Menschen? Ganz ehrlich meint der Autor dieses Textes, es nicht mit Sicherheit zu wissen. Sicher ist, dass es viel Positives bewirken kann, wenn eine Führungskraft Demut an den Tag legt. Demut ist eine jener Voraussetzungen, derer es bedarf, um eine Kultur der Menschenwürde in Organisationen zu etablieren und zu leben. Demut schützt eine Führungs- kraft davor, übermütig zu werden und sich deutlich zu überschätzen. Demut erdet, was einem Unternehmen dienlich sein kann. Wer demütig ist, wird auch eher geneigt sein, seinen Mitmen- schen mit Respekt zu begegnen und deren Expertise anzunehmen. Wer demütig führt, gesteht sich Fehler ein. Er trägt dazu bei, dass eine Kultur der Fehlerfreundlichkeit gelebt wird. Wenn Mitarbeiter ihre Führungskraft als demütig und fehlertolerant erleben, werden sie eher geneigt sein, ebenfalls Fehler einzuräumen. In einer globalisierten Welt, in der Unternehmen weltweit konkurrieren, ist das essenziell, da es Innovationen befördert. Dieter Frey schreibt in Ethische Grundlagen guter Führung (2015, S. 22), dass es zentral sei, „dass jeder Einzelne respektvoll entsprechend seiner Individualität behandelt wird. […] Statt Ruppigkeit, Abwertung oder Mobbing ist respektvoller Umgang geboten. Entscheidend ist, dass Rahmenbedingungen herr- schen, in denen Motivation und Kreativität aktiviert werden. Dies geschieht nur, indem man die Menschen wertschätzend, fair und vertrauensvoll behandelt – und nicht kalt, unwirsch oder zy- nisch. Es geht also im weitesten Sinne um die Umsetzung eines humanistischen Grundprinzips.“ Wer sich der Aufgabe, Menschen zu führen, in Demut annimmt, dem oder der gelingt es am ehes- ten, diese respektvolle, wertschätzende Kultur bei der Arbeit zu etablieren. Dass Demut diesbe- züglich eine zentrale Haltung ist, betont auch Alfred Gaffal, der ehemalige Präsident der Vereini- gung der Bayerischen Wirtschaft e. V. sowie der bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeberver- bände. Im Interview mit dem Roman Herzog Institut (2015, S. 19 ff.) erklärt er: „Führung ist und bleibt im Wesentlichen Kommunikation!“ Er meint, es „sollte ein respektvoller Umgang miteinan- der gepflegt werden. […] Zum einen führen ein intensiverer Austausch und eine stärkere Einbe- ziehung der Mitarbeiter in Entscheidungen nachweislich zu höherer Motivation, zum anderen er- möglicht eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, dass die Mitarbeiter sich mit ihrer Arbeit und dem Unternehmen stärker identifizieren und die Loyalität steigt.“ Das Wissen darum, wie wichtig der Austausch mit Mitarbeitenden ist, habe ihn, so schildert Gaffal (ebd., S. 20 f.), ein Stück weit „Demut gelehrt. Denn nicht alles kann eine Führungskraft trotz guten Willens, guten Wissens und guten Gewissens richtig machen. Es hilft der Führungskraft jedoch immer, im Blick zu behalten, dass sie sowohl bei sich als auch bei anderen die individuellen Eigenarten, Bedürfnisse und Fähig- keiten erkennt, würdigt und so weit wie möglich danach handelt.“
Im Ergebnis ist somit festzuhalten: Demut scheint sinnvoll zu sein. Aber ist sie das wirklich immer? Der Autor dieses Textes meint, dass das so pauschal schwer zu sagen ist. Demut ist eine Tugend, aber wie so oft gilt auch in Bezug auf sie: Die Menge machts. Eine schematisch vereinfachte Dua- lität dergestalt, hier zu postulieren, dass Demut vorteilhaft und Hochmut per se unvorteilhaft sei, verbietet sich. Hochmut kann innovativ wirken, weil er einen veranlasst, Grenzen zu überschrei- ten. Demut kann einen davor bewahren, beim Streben nach Grenzüberschreitung zu weit zu ge- hen und zu risikoreiche Entscheidungen zu treffen. Demut kann Arroganz verhindern helfen – nur manchmal ist ein Schuss Arroganz nicht von Nachteil. Der Autor ist daher überzeugt, dass Kristian Furchs Satz „Demut macht stark“ so unkommentiert nicht stehen gelassen werden kann. Statt- dessen würde er weniger absolutistisch klingend sagen: „Demut kann stark machen.“ Es steht außer Frage, dass Demut helfen kann, zu einem realistischen Selbstbild zu gelangen, dass sie hel- fen kann, unabhängiger zu werden und sich frei von Vergleichszwängen mit dem zufrieden zu geben, wer man ist, ganz gleich, was man erreicht hat. Und wer demütig ist, wer also akzeptiert, dass er selbst nicht Zentrum der Welt ist, der wird vermutlich wirklich eher bereit sein, eigene Wünsche und Bestrebungen zurückzustellen und sein Engagement eher der Sache zu widmen als dem eigenen Fortkommen – wie Level 5 Leader eben. In diesem Sinne kann Demut helfen, freier von Zwängen und Ängsten zu leben, und sie kann zum Erfolgsfaktor werden. Doch kann Demut auch fraglich wirken. Sie kann als Alibi herhalten, wenn es darum geht, die Verantwortung zu negieren. Demut kann uns auf eigene Fehler aufmerksam machen, die wir vielleicht gar nicht erkennen wollen. Denn ist es nicht vielleicht manchmal erstrebenswerter, mit einer guten Lüge zu leben als mit einer schrecklichen Wahrheit? Demut ist Wahrheit! Doch wer würde allen Ernstes leugnen, dass Wahrheit wehtun kann? Warum also sich diesem Schmerz aussetzen? Doch es kommt noch schlimmer: Begibt man sich auf diesen schmerzhaften Weg, und hat man es durch Einsicht, durch Loslassen, durch Akzeptieren der nicht zu verändernden Fakten endlich geschafft, zu etwas Demut zu gelangen, so darf man sich darauf noch nicht einmal etwas einbilden, sonst wäre die Demut gleich wieder dahin. Demut ist mein größter Stolz – so lautet ein bekannter Apho- rismus, der humoristisch auf den Punkt bringt, wie ungemein schwierig es ist, wahrhaft demütig zu sein. Auf den vorherigen Seiten wurden die vielen Vorteile und manche Nachteile eines Zuviels an (unreflektierter) Demut aufgezeigt. In Summe ist es so, dass der Autor dieses Textes durch seine Beschäftigung mit der Demut zum Schluss gekommen ist, dass es schwierig ist, im alltägli- chen Führungshandeln immer demütig zu sein. Wer - wie viele Führungskräfte - ein hohes Selbst- vertrauen hat, wer erfolgsverwöhnt ist, wer gerne derjenige ist, der sagt, wo es langgeht, für den ist es eine echte Herausforderung, »wahre« Demut an den Tag zu legen. Dies umso mehr, als man mit dieser ja noch nicht einmal prahlen kann.
Wer im eigenen Kompetenzprofil die Demut als große Stärke angibt, macht sich schnell des Stol- zes, des Sich-etwas-Einbildens ob der behaupteten Demut, verdächtig. Man glaubt ihm nicht im- mer. Das verwundert kaum, denn wir alle erleben, dass Impression Management, also das Vor- spielen von etwas, häufig bedeutsamer ist als das, was man tatsächlich tut. Summa summarum sind, so schildern es Warode & Gerundt (2015, S. 220) in der Zeitschrift für Fragen des Ordensle- bens, die „Grundhaltungen der Demut und des Dienstes […] keine Führungsmethodik, die eins zu eins auf Führungssituationen in heutigen Organisationen zu übertragen wären. Der Ansatzpunkt einer dienenden Führung liegt darin, sich ihre Inhalte im Kontext persönlicher Kompetenzen, Er- fahrungen und Denkmuster bewusst zu machen und vor dem Hintergrund spezifischer Situatio- nen zu reflektieren. Die dienende Führung fängt immer bei der Führungskraft selbst an und setzt ein reflektiertes Führungsverständnis voraus: ‚sind meine Mitarbeiter für mich da oder ich für sie?‘).“ Wer diese Frage eindeutig mit Ich-bin-für-die-Mitarbeiter-da beantwortet, für den kann die Haltung der Demut hilfreich sein, den Führungsalltag zu meistern, ohne überheblich und ab- gehoben zu werden. Für Menschen, denen die Demut von ihrer Persönlichkeit her nicht in die Wiege gelegt ist, die eher extrovertiert sind und mit ihren Erfolgen prahlen (bzw. dieses werbe- wirksam vermarkten), die von klein auf dahingehend erzogen wurden, dass das (Arbeits-)Leben ein ständiger Konkurrenzkampf sei, ist die Vorstellung, die Führungsarbeit in Demut zu verrichten, wenig lukrativ. Für sie sind die Incentives, die durch Egoismus und Strebsamkeit erreicht werden können, sicher lukrativer. „Wer führen will, muss authentisch sein“ – schreibt Hans H. Hinterhu- ber in seinem Aufsatz Führen heißt die Herzen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen (2009, S. 24 f.). Wer allerdings nur schauspielert, wer Demut lediglich in der Interaktion mit an- deren suggeriert, in Wirklichkeit aber wenig demütig ist, wird die Herzen seiner Mitarbeitenden kaum gewinnen. Früher oder später merken diese mit Sicherheit, dass hinter der Demutsfassade wenig Authentisches steckt. Für Führungskräfte, denen Demut eher fremd ist, ist das permanente An-den-Tag-Legen von Demut nicht unbedingt eine erfolgversprechende Option, da sie sich zu sehr verbiegen müssen – und damit gerade nicht mehr authentisch sind. Im Klartext: Demut ist nicht immer passend. Und noch etwas stimmt nachdenklich: Der Demütige weiß, dass sein Selbst- wert nicht aus seiner Leistung resultiert, sondern dass er universal immer existiert. Nur, so könnte man fragen: Wenn mein Selbstwert universal ist und nicht durch meine Taten determiniert wird, warum soll ich mich dann überhaupt noch anstrengen? Warum Gutes tun, wenn allein die Haltung zählt? Eines jedenfalls steht fest: Es braucht nicht unbedingt einer demütigen Haltung, um ein guter Unternehmensführer zu sein. Überdurchschnittliche Intelligenz und Kommunikationsfähig- keit, gepaart mit einem soliden Controlling, tun es auch. Und wenn wir bedenken, dass Führung ohnehin eine kollektive Leistung ist, wäre es sowieso angebracht, den Fokus abzuwenden von der Persönlichkeit desjenigen an der Spitze. Schaden wird etwas Demut einer Führungskraft sicher nicht. Was Unternehmen durchaus schaden kann, sind jedoch Management-„Gurus“, die be- stimmte Führungsideologien als die besten schlechthin vermarkten. Die universell beste »Passt- Immer-Haltung« gibt es schlichtweg nicht. Wer anderes behauptet, ist nicht seriös.8 9
Bezeichnenderweise sind viele Darlegungen, die sich in den hier zitierten Texten zum Thema die- nende Führung finden, wenig konkret und manchmal arg trivial. Oder schlicht nichtssagend hin- sichtlich ihrer praktischen Relevanz. Da schreibt z. B. Leonhard Schnorrenberg in Servant Lea- dership (2007, S. 18): „Servant Leadership ist [...] eine praktische Führungsphilosophie des krea- tiven Altruismus, wobei der Mensch Mittelpunkt ist und nicht Mittel.“ Oder: „Die Kernfrage un- serer Lebensaufgabe ist: Wozu diene ich (und nicht wozu herrsche ich)“ (ebd., S. 23)? Oder auch:
„Die Liebe zum Nächsten erinnert uns immer wieder an die Menschlichkeit, die Führung inne sein sollte, die Führung Richtungsweiser werden lässt für eine reiche Intimität freiheitlicher Beziehun- gen: Dienstbarkeit ist ihre Kern-Essenz“ (ebd., S. 36). Was sind nun, so sei zum Abschluss gefragt, die handlungsleitenden Schlüsse für all jene, der nach mehr Demut streben, die Demut zeigen und wirklich (er)leben wollen? Diese Frage kann der Autor dieses Textes unmöglich für alle Leser beantwortet. Demütig hält er fest, dass es ihm auch nicht zusteht, darüber zu urteilen. Es bleibt jedem selbst überlassen, die eigenen Schlüsse zu ziehen und für sich selbst zu entscheiden, ob er mehr Demut anstrebt und ob er sich ein erfüllteres Leben sowie erfolgreicheres Arbeiten durch eben diese erhofft. Der Autor dieses Textes beendet seine Reflexion über die Demut bewusst ergebnisoffen mit den Worten Bertolt Brechts aus Der gute Mensch von Sezuan (1964, S. 144):
„Verehrtes Publikum, los, such dir selbst den Schluß!
Es muß ein guter da sein, muß, muß, muß.“
Literatur
Aron-Weidlich, M.: Essenz der Führung. Frankfurt a. M. 201210
Babiak, P. et al.: Corporate Psychopathy: Talking the Walk. In: Behavioral Sciences and the Law, No. 28, 2010, pp. 174–193. Abrufbar unter: https://www.sakkyndig.com/psykologi/artvit/babiak2010.pdf
Baecker, D.: Postheroisches Management. Berlin 1994
Bartscher, T.: Führung. Definition im Gabler Wirtschaftslexikon. 2019. Abrufbar unter: https://wirt- schaftslexikon.gabler.de/definition/fuehrung-33168
Bateson, G.: Ökologie des Geistes. Frankfurt am Main 1983
Benedikt XVI: Caritas in Veritate. Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls Nr. 186 vom 29.06.2009. Abrufbar unter https://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/veroeffentlichungen/verlautbarungen/VE_ 186.pdf
Bilgri, A.: Werteorientierte Führung – Die Benediktsregel als Richtschnur für Unternehmen. Zusammen- fassung des Vortrags von Anselm Bilgri auf dem Hays Forum 2012. Abrufbar unter: https://www. hays.de/documents/10192/135555/hays-forum-2012-vortrag-anselm-bilgri.pdf/81aedb12-8707-42e4- b22f-0a597de3c5eb
Breithaupt, F.: Die dunklen Seiten der Empathie. Berlin 2017
Brunsson, N.: The Organization of Hypocrisy. Talk, Decisions and Actions in Organizations. Oslo 1989
Brecht, B.: Der gute Mensch von Sezuan. Frankfurt am Main 1964
Buchhorn, E.; Werle, K.: Harvard Business School. Ratlos in Boston. Artikel vom 29.07.2009 im Manager- Magazin. Abrufbar unter: https://www.manager-magazin.de/magazin/artikel/a-627538.html
Collins, J.: Good to Great. New York 2001
Collins, J.: Level 5 Leadership. The Triumph of Humility and Fierce Resolve. In: Harvard Business Review, January 2001a, pp. 66-78. Abrufbar unter: https://hbr.org/2001/01/level-5-leadership-the-triumph-of- humility-and-fierce-resolve-2
Covey, S. R.: Management. Essentials für die Unternehmensführung. Offenbach 2014
Crozier, M.; Friedberg, E.: Macht und Organisation. Die Zwänge kollektiven Handelns. Königstein 1979
Dörner, D.: Die Logik des Misslingens. Hamburg 2003
Eggensperger, T.: Demut – eine seltsame Tugend. In: Wort und Antwort. Dominikanische Zeitschrift für Glauben und Gesellschaft. 58. Jg., Heft 4, Juli-September 2017, S. 112-116. Abrufbar unter: https://www.wort-und-antwort.de/pdf/archiv/2017/2017_03.pdf
Farrell, S.: Deutsche Bank bosses fitted for £1,200 suits as thousands lose their jobs. Online-Artikel vom 09.07.2019 im Guardian. Abrufbar unter: https://www.theguardian.com/business/2019/jul/09/deut- sche-bank-bosses-fitted-1200-suits-thousands-lost-jobs-london
Fischer, S.: The Giving Pledge. Der Club der Super-Spender. Artikel vom 21.02.2013 auf SPIEGEL-Online. Abrufbar unter: https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/was-steckt-hinter-dem-super-spender- club-the-giving-pledge-a-884630.html
Frances, A.: An Eminent Psychiatrist Demurs on Trump’s Mental State. A Letter of Opinion to the New York Times. 14.02.2017. Abrufbar unter: https://www.nytimes.com/2017/02/14/opinion/an-eminent- psychiatrist-demurs-on-trumps-mental-state.html
Freyd. Abrufbar unter: https://www.romanherzoginstitut.de/publikationen/detail/download/ethische- grundlagen-guter-fuehrung.html
Furch, K.: Demut macht stark. Hünfelden 2008
Gaffal, A.: „Führung muss Motivation und Begeisterung schaffen“. Alfred Gaffal im Interview. In: Frey, D.: Ethische Grundlagen guter Führung. Herausgegeben vom Roman Herzog Institut e. V. München 2015. Abrufbar unter: https://www.romanherzoginstitut.de/publikationen/detail/download/ethische-grund- lagen-guter-fuehrung.html, S. 19-21
Galasso, A.; Simcoe, T. S.: CEO Overconfidence and Innovation. Working Paper. Cambridge, MA 2010. Abrufbar unter: https://www.nber.org/papers/w16041.pdf
Greenleaf, R.: Servant Leadership. Mahwah, NJ 2002
Groll, T.: Demut mit einem Schuss Selbstverliebtheit. Artikel auf ZEIT-Online vom 24.08.2015. Abrufbar unter: https://www.zeit.de/karriere/2015-08/fuehrung-narzissmus-studie
Groth, A.: Best of Führungslehre. In: managerSeminare. Heft 251, 02/Februar 2019, S. 22-27. Abrufbar unter: https://www.alexander-groth.de/wp-content/uploads/2019/06/Groth-Best-of-F%C3%BChrungs lehre.pdf
Grün, A.: Vom Mut, hinabzusteigen. In: Handelblatt vom 12.12.2013, Nr. 240. Serie: Wirtschaft neu den- ken. Abrufbar unter: https://www.handelsblattmachtschule.de/fileadmin/PDF/Serien/wirtschaft_neu_ denken/10.pdf
Hartmann, M.: Die Abgehobenen. Wie die Eliten die Demokratie gefährden. Lizenzausgabe der Bundes- zentrale für politische Bildung. Bonn 2019
Hawlitzeck, J.: Das Zukunfts-Mindset: Neun Strategien, um auch morgen noch im Spiel zu sein. Wiesba- den 2018
Herz, H. et al.: How Do Judgmental Overconfidence and Overoptimism Shape Innovative Activity? Wor- king Paper Nr. 106. Univ. of Zurich, 11/2013. Abrufbar unter: http://www.econ.uzh.ch/sta- tic/wp/econwp106.pdf
Hinterhuber, H. H.: Führen heißt die Herzen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen. In: Eurich, J.: Brink, A. (Hg.): Leadership in sozialen Organisationen. Wiesbaden 2009, S. 21-30
Homann, K.: Moral und ökonomisches Gesetz. In: Streeck, W.; Beckert, J. (Hg.): Moralische Vorausset- zungen und Grenzen wirtschaftlichen Handelns. Köln 2007, S. 23-36
Hörmann, Karl: Lexikon der christlichen Moral. Innsbruck, Wien, München 1969
Houben, A.: Mehr Mut zur Demut in der Führung. Artikel vom 01.01.2019 auf WELT-Online. Abrufbar unter: https://www.welt.de/wirtschaft/bilanz/article186349074/Managementstrategie-Mehr-Mut-zur- Demut-in-der-Fuehrung.html
Jakobs, H. J.: Die Deutsche Bank übt Demut. Artikel vom 23.05.2019 im Handelblatt Morning Briefing. Abrufbar unter: https://www.handelsblatt.com/meinung/morningbriefing/morning-briefing-die-deut- sche-bank-uebt-demut/24372802.html?ticket=ST-32658224-B2evAGp7sGroxs5vcfZ4-ap2
Jonas, H.: Das Prinzip Verantwortung. Frankfurt am Main 1979
Kaplan, A.: The Conduct of Inquiry. Methodology for Behavioral Science. San Francisco 1964
Kirchner, B.: Benedikt für Manager: Die geistigen Grundlagen des Führens. Wiesbaden 2012
Kühl, S.: Lob der Heuchelei. In: ZEIT-Online 39/2007. Abrufbar unter: https://www.zeit.de /2007/39/Scheinheiligkeit
Löhe, F.: Untersuchungsausschuss startet. Gefährlicher Zeuge für Leyen in der Bundeswehr-Berateraf- färe. Artikel im Tagesspiegel vom 14.02.2019. Abrufbar unter: https://www.tagesspiegel.de/politik/un- tersuchungsausschuss-startet-gefaehrlicher-zeuge-fuer-leyen-in-der-bundeswehr-berateraffa- ere/23982082.html
Menke, B.: Wiederkehr der Demut. Artikel im SPIEGEL vom 02.05.2012. Abrufbar unter: https:// www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/demut-die-wiederkehr-der-werte-a-829604.html
Kirchgeorg, M. et al.: Trendmonitor Weiterbildung. Herausgegeben vom Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e. V., Lecturio und der HHL Leipzig Graduate School of Management. Essen 2018. Abrufbar unter: https://www.stifterverband.org/trendmonitor-weiterbildung-2018
Königswieser, R.; Hillebrand, M.: Einführung in die systemische Organisationsberatung. Heidelberg 2017
Mai, J.: Demut: Wer sich kleinmacht, gewinnt Größe. Artikel vom 26.07.2019 auf Karrierebibel. Abrufbar unter: https://karrierebibel.de/demut/
March J. G.; Levinthal, D. A.: The Myopia of Learning. In: Strategic Management Journal, Vol. 14, 1993, pp. 95-112
March, J. G.; Levinthal, D. A.: The Myopia of Learning. In: March, James G.: The Pursuit of Organizational
Intelligence. London 1999, S. 193-220
Melcher, H.: Albert Einstein wider Vorurteile und Denkgewohnheiten. Berlin 1979
Menendez, E.: Ursula von der Leyen becomes first female European Commission president. Artikel in Metro vom 16.07.2019. Abrufbar unter: https://metro.co.uk/2019/07/16/ursula-von-der-leyen-beco- mes-first-female-european-commission-president-10363889/
Mintzberg, H.: Managers, not MBAs. Managers Not MBAs: A Hard Look at the Soft Practice of Managing and Management Development. San Francisco 2014
Mohe, M.; Karczmarzyk, A.: Führung und Kommunikation. Oldenburg 2015. Abrufbar unter: https://uol.de/fileadmin/user_upload/c3l/Studiengaenge/BABusinessAdmin/Download/Lesepro- ben/bba_leseprobe_fuehrung_kommunikation.pdf
Nerdinger, F. W.: Führung von Mitarbeitern. In: Nerdinger, F. W. et al.: Arbeits- und Organisationspsy- chologie. Berlin und Heidelberg 2014, S. S. 83-102
Neuberger, O.: Führen und Führen lassen: Ansätze, Ergebnisse und Kritik der Führungsforschung. Stutt- gart 2002
Nixdorf, C. P.: Demut als Management-Hype. Unveröffentlichtes Working Paper. Hildesheim 2010
Owens, B. P., Wallace, A. S., & Waldman, D. A. (2015). Leader narcissism and follower outcomes: The counterbalancing effect of leader humility. Journal of Applied Psychology, 100(4), 1203-1213. Abrufbar unter: https://psycnet.apa.org/record/2015-02573-001
Schanetzky, T.: Builder of the Liberal Consensus: Henry J. Kaiser (1882-1967). In: Bulletin of the German Historical Institute. Supplement 12 (2016), pp. 285-307. Abrufbar unter: https://www.ghi-dc.org/filead- min/user_upload/GHI_Washington/Publications/Supplements/Supplement_12/Supp_12.pdf
Scherer, K.: Der bittere Beigeschmack der Schokolade. Artikel in der Süddeutschen Zeitung vom 02.01.2018. Abrufbar unter: https://www.sueddeutsche.de/wissen/kakao-anbau-der-bittere-beige- schmack-der-schokolade-1.3809425-0
Schnorrenberg, L. J.: Servant Leadership – die Führungskultur für das 21. Jahrhundert. In: Hinterhuber, H. H. et al. (Hg.): Servant Leadership. Prinzipien dienender Unternehmensführung. Berlin 2007, S. 17-39
Simon, Fritz B.: Einführung in die systemische Organisationstheorie. Heidelberg 2007
Solomon, R.: A Better Way to Think about Business: How Personal Integrity Leads to Corporate Success. New York and Oxford 1999
Spector, P. E.: Job Satisfaction: Application, Assessment, Causes, and Consequences. Thousand Oaks, CA
Staehle, W.: Management. Eine verhaltenswissenschaftliche Perspektive. München 1999
Statistisches Bundesamt: Soft Skills und allgemeine IT-Kenntnisse stellen zukünftig wichtige Mitarbeiter- qualifikationen dar. Pressemitteilung Nr. 277 vom 27. Juli 2018. Abrufbar unter: https://www.desta- tis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2018/07/PD18_277_215.html;jsessionid=138BB1F482CA8E234 2BA542CD3F30A8D.internet711
Stroebe, R.: Grundlagen der Führung. Frankfurt a. M. 2006
Tavris, C.; Aronson, E: Mistakes Were Made (but not by me). Orlando, Austin, New York, San Diego, Toronto, London 2007
Thielecke, S.: Wer führen will, braucht Mut und Demut. Susanne Thielecke im Interview mit Unsere wirt- schaft vom 23.03.2018. Abrufbar unter: https://unserewirtschaft.ihklw.de/wer-fuehren-will-braucht- mut-und-demut/
Wälde, R.: Understatement: Der Stil des Erfolgs. Frankfurt a. M. 2008
Wallisser, R.: Definition von Demut. In Microsoft Encarta Lexikon 2006
Warode, M.; Gerundt, M.: Führungskräfte profitieren von Franziskus von Assisi. Charakteristika einer franziskanisch geprägten Führung. In: Ordenskorrespondenz. Dokumentation. Jahrgang 2015. , S. 2017- 224. Abrufbar unter: https://www.orden.de/dokumente/1._Ordenskorrespondenz/2015_2/Dokumen- tation/Warode_Gerundt_Fuehrungskraefte_profitieren.pdf
Weber, M.: Politik als Beruf. Stuttgart 1992/1919
Weick, K. E.; Sutcliffe, K. M.: Managing the Unexpected. Resilient Performance in an Age of Uncertain- ty. San Francisco, CA 2007
Weinert, A. B.: Lehrbuch der Organisationspsychologie. Weinheim 1992
Wiedeking, W.: Anders ist besser. Ein Versuch über neue Wege in Wirtschaft und Politik. München 2006
Wimmer, R.: Die Zukunft von Führung. Brauchen wir noch Vorgesetzte im herkömmlichen Sinn? In: Or- ganisationsentwicklung 04/1996, S. 46-57. Abrufbar unter: http://www.harth-therapie.de/down- load/Wimmer_Die_Zukunft_von_Fuehrung.pdf
Wimmer, R.: Führen: eine kollektive Leistung. In: Unternehmensentwicklung, Mai/Juni 2001, S. 10-11
Ziegler, J.: Das Imperium der Schande. München 2008
Žiaran, P. et al.: Humility and Modesty in Leadership – A Bibliometric Perspective. In: Acta Universitatis Agruculturae et Silviculturae Mendelianae Brune, Vol. 63, 243, Number 6, 2015, pp. 2221-2228. Abrufbar unter: https://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2015063062221.pdf
Bildnachweis
Das Foto der Skulptur auf Seite 1 dieses Aufsatzes stammt von Wolfgang Eckert. Es ist abrufbar unter: https://cdn.pixabay.com/photo/2017/09/18/08/27/sculpture-2760974_1280.png
(Das Foto auf S.1 wurde aus urheberrechtlichen Gründen von der Redaktion entfernt)
Die Tabelle und die Pyramide auf Seite 26 wurde selbst erstellt in Anlehnung an ein Schaubild von Jim Collins aus dessen Buch From good to Great. New York 2001, S. 20
[...]
1 Bei The Giving Plege handelt es sich um eine 2010 initiierte gemeinnützige Organisation, bei der bisher 204 Milliardäre das Versprechen abgegeben haben, den Großteil des eigenen Vermögens für das Gemein- wohl zu spenden (Quelle: https://givingpledge.org/). Kritiker sehen das „Versprechen“ indes insofern als fragwürdig an, als niemand kontrolliert, ob wirklich gespendet wird. Es ist eine reine Willensbekundung ohne einklagbare Folgen. Auch wird kritisiert, dass der Eindruck entstehen kann, dass politische Einfluss- nahme als philantrophisches Engagement „verkauft“ wird. Sebastian Fischer beschreibt dies im SPIEGEL vom 21.03.2013 so: Es „verfolgen die meisten durchaus klare Ziele mit ihren Spenden. Bill Gates etwa hat über Jahre bestimmte Schulformen gefördert – und damit politischen Einfluss genommen. Schon kurz nach Präsentation des exklusiven Clubs bemerkte Ellen Remmer, Vorsitzende der ‚Philanthropic Initiative‘, in der ‚New York Times‘, es könne natürlich der Eindruck entstehen, dass es sich hier ‚um eine totales PR- Ding‘ handele: ‚Der Grund für dieses goldene Zeitalter der Menschenfreundlichkeit ist ja die unglaubliche Konzentration von Reichtum - und 'das Versprechen' erinnert uns daran.‘“
2 Anzumerken ist, dass der Ausdruck »neoliberal« sich seit den 1980er Jahren ins Gegenteil dessen ver- kehrt hat, was ursprünglich damit gemeint war. Heute ist »neoliberal« für viele gleichbedeutend mit un- sozial und egoistisch. Diese Vorstellung ist eine Umkehrung dessen, was Neoliberale ursprünglich wollten. Das Präfix »Neo« sollte dereinst verdeutlichen, dass der radikale Markt-Liberalismus, der sogenannte Manchester-Kapitalismus, abgelehnt wird. Es ging den Neoliberalen nicht um den Rückzug des Staates, sondern um dessen Eingreifen. Neoliberale waren (und sind) überzeugt, dass absolute Freiheit der Wirt- schaft ohne staatliche Eingriffe fatal ist, da sie zu Monopolbildungen und Kartellen führt. Eine Überzeu- gung des Neoliberalismus ist daher, dass der Freiheit des Marktes staatlicherseits Grenzen gesetzt werden müssen. Das neoliberale Ansinnen war und ist es, für einen funktionierenden Wettbewerb zu sorgen.
3 Dazu sei gesagt, dass dies aber kein weltweites Phänomen ist. In den USA, wo die soziale Ungleichheit noch weit stärker ausgeprägt ist als in Deutschland, ist es noch immer gesellschaftlich akzeptiert, sich in den eigenen vermeintlichen Erfolgen zu sonnen und den eigenen Reichtum demonstrativ zur Schau zu stellen. Understatement ist dort weniger verbreitet (wenngleich das in diversen Milieus auch dort selbst- verständlich vorkommt).
4 Eine Methode, dies zu eruieren, ist die Critical Incident Technique (CIT) nach Flanagan (1954). Umfassend dazu siehe Nixdorf (2020).
5 Dass diese personale Paradoxie für Führungskräfte sehr nützlich sein kann, konnte Sozialpsychologen unabhängig voneinander in mehreren Untersuchungen und Feldstudien mit Managern ermitteln. Auf zwei dieser Befunde wird später noch näher eingegangen.
6 Zu sehen ist das Interview mit Peter Brabeck in Erwin Wagenhofers Dokumentarfilm We Feed the World aus dem Jahr 2005.
7 Siehe dazu Katja Scherer, die Friedel Hütz-Adams vom Südwind Institut in Der bittere Beigeschmack der Schokolade in der Süddeutschen Zeitung vom 02.01.2018 mit den Worten zitiert: „Trotz aller Initiativen im Kakaoanbau ist es bisher nicht gelungen, die Lebensbedingungen der Bauern wesentlich zu verbessern.“ Scherer schreibt, dass Hütz-Adams zufolge allein in Ghana und der Elfenbeinküste „mehr als zwei Millionen Minderjährige [arbeiten] […]. Die schweren Kakaosäcke schinden ihre Rücken, Pestizide lassen ihre Gesich- ter aufquellen, Schlangenbisse oder Fleischwunden durch Macheten können tödlich sein. […] Der Markt für Kakao ist ein perfektes Beispiel dafür, was alles schieflaufen kann, wenn westliche Großkonzerne mit nicht organisierten Kleinbauern zusammenarbeiten, wenn sich die eine Seite den Renditeforderungen ih- rer Anleger verpflichtet fühlt und die andere ums Überleben kämpft.“
8 Der Ausdruck LOHAS entstammt dem Marketing-Jargon. Er steht für Lifestyle of Health and Sustainability.
9 Zur Reflexion dieser Frage, mithin also zur Unterscheidung von Gesinnungs- und Verantwortungsethik siehe Jonas (1979) und Weber (1992; ursprünglich 1919).
Häufig gestellte Fragen zu Demut und Führung
Worum geht es in diesem Text?
Der Text behandelt Demut als ein Zeitgeist-Phänomen im Management, untersucht die Bedeutung von Demut und Führung, und wie diese beiden Konzepte zusammenpassen. Es wird auch diskutiert, ob Demut immer erstrebenswert ist oder ob sie auch schaden kann, sowie die Paradoxien und falsche Demut im Kontext von Corporate Social Responsibility.
Was bedeutet Demut eigentlich?
Demut wird etymologisch als eine Form des "Muts" bestimmt und leitet sich vom Ausdruck "dien-muot" ab, was "Wille zum Dienen" bedeutet. Im christlichen Verständnis ist es die überdauernde innere Haltung des Individuums Gott gegenüber. Im weiteren Sinne bedeutet Demut, sich nicht über andere zu erheben, sich einzugestehen, nicht unfehlbar zu sein, sich selbst realistisch einzuschätzen und achtsam mit sich und anderen umzugehen.
Was bedeutet Führung?
Führung wird als bewusste und zielbezogene Einflussnahme auf Menschen definiert. Sie beinhaltet Kommunikation, Interaktion, ein Machtgefälle und zielt darauf ab, konkrete Ziele zu erreichen. Führung ist nur dann möglich, wenn die zu führenden Personen die ihnen zugewiesene Rolle annehmen und sich führen lassen.
Wie passen Demut und Führung zusammen?
Demut und Führung können gut zusammenpassen, da Demut eine Führungskraft davor schützt, übermütig zu werden und die Expertise anderer anzuerkennen. Eine Führungskraft kann andere nur überzeugen, wenn sie von sich selbst überzeugt ist. Jedoch verhindert Demut im Kontext von Führung, dass Führungskräfte ein Schwarz-Weiss-Denken an den Tag legen.
Was ist Level 5 Leadership?
Level 5 Leadership ist ein Konzept von Jim Collins, das eine paradoxe Mischung aus persönlicher Bescheidenheit und rigoros-professionellem Willen beschreibt. Level 5 Leader schreiben Erfolge nicht sich selbst zu, sondern erkennen die Beiträge anderer an und übernehmen Verantwortung für Misserfolge.
Kann Demut auch schaden?
Ja, Demut kann auch schaden, insbesondere wenn sie als Vorwand für mangelnde Verantwortungsübernahme dient oder dazu führt, dass man sich gar nicht erst anstrengt. Hochmut und Arroganz können auch positive Auswirkungen haben, z.B. um sich Aufgaben anzunehmen, denen man sich sonst nicht stellen würde.
Was ist falsche Demut?
Falsche Demut ist Demut, die nicht aus Überzeugung praktiziert wird, sondern nur zur Schau gestellt wird, um das eigene Image zu verbessern oder andere zu täuschen. Sie kann als Heuchelei wahrgenommen werden und das Vertrauen in die Führungskraft untergraben.
Warum betreiben Unternehmen Corporate Social Responsibility (CSR)?
Unternehmen betreiben CSR aus verschiedenen Gründen, darunter ethische Überzeugung, Imagepflege und die Erwartungen der Stakeholder. Auch wenn CSR-Aktivitäten eigennützig motiviert sind, können sie dennoch einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leisten.
Was ist das Fazit des Textes?
Demut ist eine wertvolle Eigenschaft, die Führungskräften helfen kann, erfolgreich zu sein und eine positive Unternehmenskultur zu schaffen. Es gibt jedoch keine universelle "Passt-Immer-Haltung" und Demut kann in bestimmten Situationen auch nachteilig sein. Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zu finden und authentisch zu sein.
- Citar trabajo
- Christian Philipp Nixdorf (Autor), 2020, Demut Macht Sinn. Über Demut als Führungshaltung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/584240