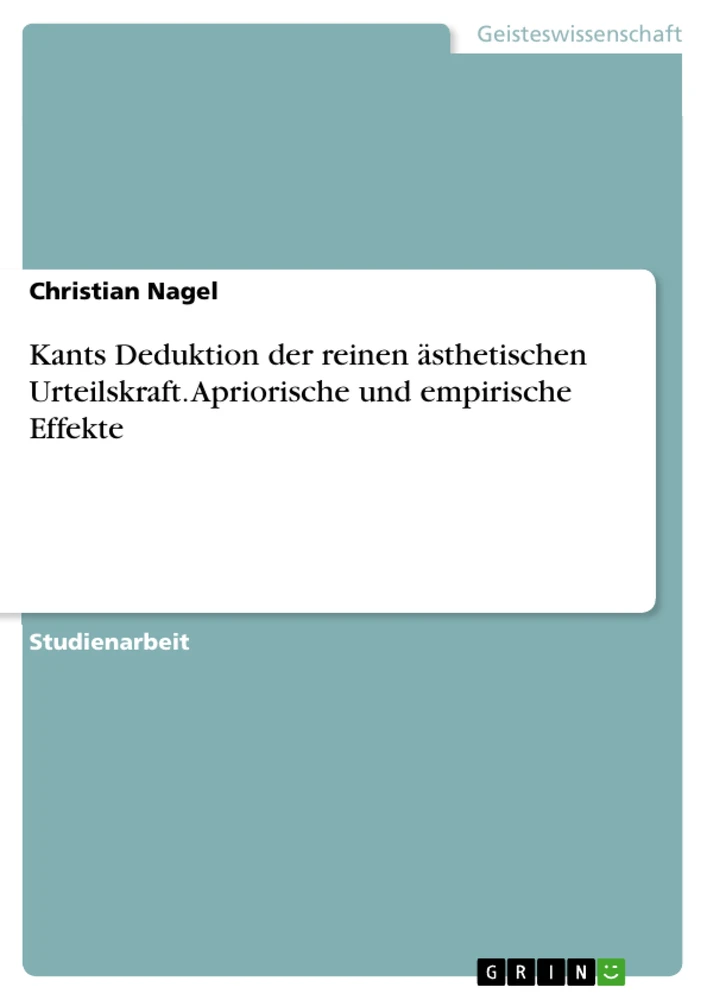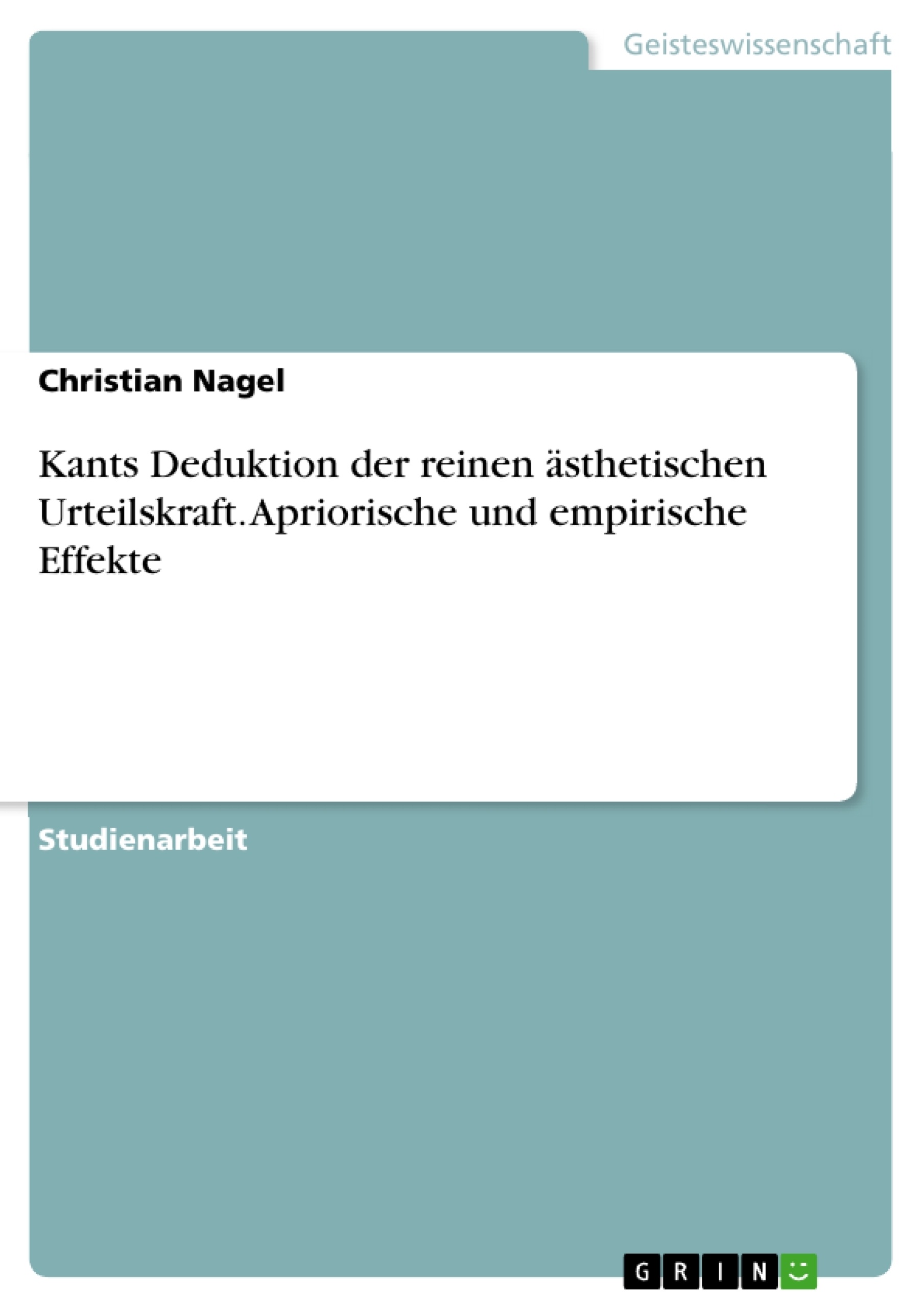Die Arbeit widmet sich Immanuel Kants Deduktion der reinen ästhetischen Urteilskraft. Im Zentrum steht das Paradox, welches sich aus seiner scheinbaren Unklarheit generiert. Dabei wird zwischen den apriorischen und empirischen Aspekten, deren Lösung sich die Arbeit widmet.
Für eine kritische Wissenschaft der Ästhetik und des Geschmacks ist kaum ein Werk so einflussreich wie das Spätwerk Immanuel Kants: die Kritik der Urteilskraft. Mit ihr hoffte er, die Frage zu erörtern, inwiefern die kritische Beurteilung des Schönen unter Vernunftprinzipien und die Regeln derselben zur Wissenschaft erhoben werden können. Dieses Vorhaben war von einer Reihe von Unklarheiten begleitet, war ihm doch bereits zu Anfang seiner Untersuchungen bewusst, dass sich ästhetische Urteile lediglich empirisch fällen lassen, während die angestrebte regelhafte Genauigkeit, die einer Wissenschaft vom Geschmacksurteil zugrunde liegen soll, allein auf einem logischen Apriori begründet werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Fragestellung - zum Apriori eines wissenschaftlichen Geschmacksurteils?
- Kritik der Urteilskraft – Einflüsse
- Zusammenfassung der Kritik der ästhetischen Urteile – Analytik des Schönen
- Deduktion der reinen ästhetischen Urteile
- § 30 Das Erhabene und das Schöne – Hintergrund
- § 32 Erste Eigentümlichkeit des Geschmacksurteils - Pseudoobjektivität
- § 33-35 Zweite Eigentümlichkeit des Geschmacksurteils – Souveränität
- § 36-37 Synthetische Geschmacksurteile
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Kritik der Urteilskraft von Immanuel Kant und untersucht das Paradoxon, das sich aus der scheinbaren Unklarheit zwischen apriorischen und empirischen Aspekten des Geschmacksurteils ergibt. Das Ziel ist es, Kants Lösungsansatz für dieses Paradoxon zu analysieren und zu bewerten.
- Die Kritik der Urteilskraft als Bindeglied zwischen Verstand und Vernunft
- Die Rolle des Gefühls und der reinen Urteilskraft in der ästhetischen Beurteilung
- Die Analyse des Geschmacksurteils in vier Momente: Qualität, Quantität, Relation und Modalität
- Die Bedeutung des "reinen" Geschmacksurteils, das frei von persönlichen Interessen ist
- Die Unterscheidung zwischen dem Erhabenen und dem Schönen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit vor und erläutert Kants Ziel, die kritische Beurteilung des Schönen auf wissenschaftliche Prinzipien zu gründen.
Kapitel 1.1 beleuchtet die Einflüsse auf Kants Überlegungen zur Kritik der Urteilskraft, darunter Georg Friedrich Meier, Alexander Gottlieb Baumgarten, David Hume und Edmund Burke.
Kapitel 2 fasst die Kritik der ästhetischen Urteile zusammen, wobei der Fokus auf der Analyse des Schönen liegt. Kant zeigt, dass ästhetische Urteile sich auf das Subjekt des Urteils beziehen und nicht auf das Objekt selbst. Er erklärt, wie die Zweckmäßigkeit eines Objekts bei der ästhetischen Vorstellung Lust oder Unlust erzeugt.
Kapitel 3 befasst sich mit der Deduktion der reinen ästhetischen Urteile, die durch eine Reihe von Paragrafen strukturiert ist. Diese Paragraphen behandeln Themen wie die Pseudoobjektivität des Geschmacksurteils, die Souveränität des Urteils und die synthetischen Geschmacksurteile.
Schlüsselwörter
Kritik der Urteilskraft, Immanuel Kant, ästhetisches Urteil, Geschmacksurteil, Apriori, Empirie, Erhabenes, Schönes, Pseudoobjektivität, Souveränität, synthetische Urteile.
- Citation du texte
- Christian Nagel (Auteur), 2018, Kants Deduktion der reinen ästhetischen Urteilskraft. Apriorische und empirische Effekte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/584363