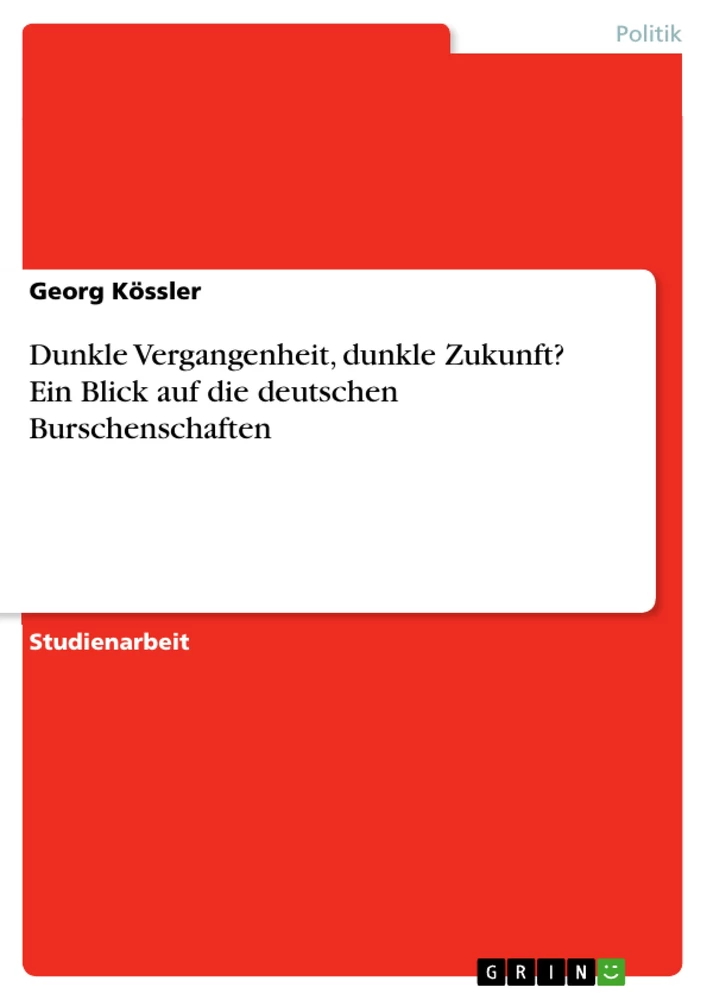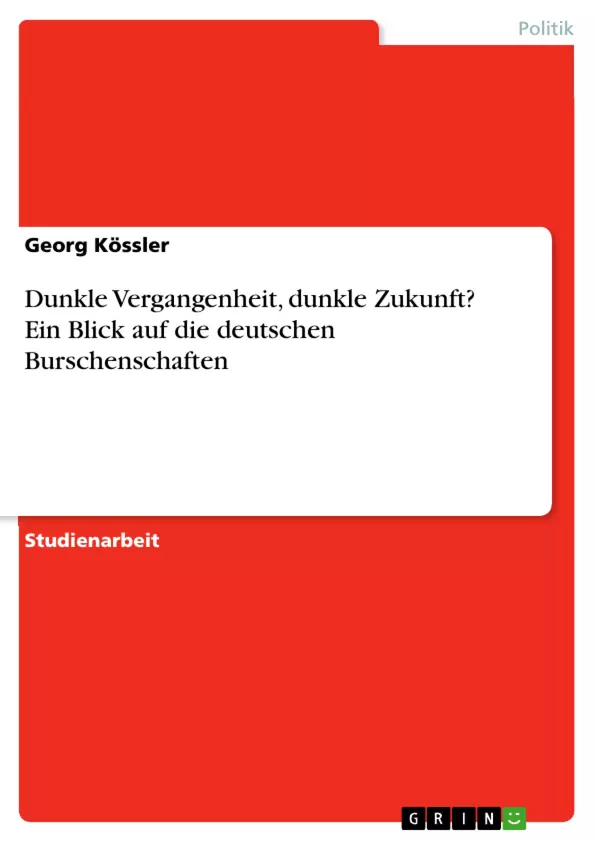In der vorliegenden Arbeit soll untersucht werden, wie die B! historisch entstanden sind und ob sie heute dem „Rechten Rand“ zuzuordnen sind.
Drei wesentliche Punkte werden bearbeitet. Waren die Burschenschaften früher „ja ganz gut“ und haben ihre liberalen Ideen die Einheit und Demokratie in Deutschland befördert? Wie standen sie wirklich zu Hitler und dem Dritten Reich? Welche Flügelkämpfe gab es und welche werden bis heute ausgetragen? Welche Ideologien bzw. Einstellungspotenziale waren bestimmend und haben diese sich bis heute erhalten? Ziel der Arbeit ist es, eine begründete Stellungnahme zur Forderung des Verbotes von Burschenschaften zu geben.
Napoleons Siegeszug über Europa lies in Deutschland anti-französische Tendenzen erwachen. Hier entstammt nicht nur die deutsche Fahne, sondern erwuchs auch die erste wirkliche B!. Damit verbunden war der Wunsch nach nationaler Einheit, aber auch eine Ablehnung der Errungenschaften der Aufklärung.
Liberale Gegenströmungen innerhalb der B! – gegen das christlich deutsche Dogma – gab es um F.-W. Carové, doch schon auf dem Burschentag 1818 wurde der Ausschluss von Juden aus allen B! formal per Mehrheitsbeschluss festgelegt. Eine neuere liberalere Strömungen wäre die Neue Deutsche Burschenschaft (NDB), welche den harten, um den „volkstumsbezogener Vaterlandsbegriff“ rotierenden und in Verbindung zur „Neuen Rechte“ eingeschlagenen Kurs dieser nicht mittragen wollten.
Während der NS-Zeit gingen die meisten B! freiwillig in den „Kameradschaften“ auf und nach der Befreiung durch die Alliirten ist es zuvorderst den „Alten Herren“ – ehemals Studierenden, welche aufgrund des Lebensbundprinzips noch in der B! sind – , aber auch den katholischen Verbindungen zu verdanken, dass die B! wieder zugelassen wurden. Sie definierten sich im Folgenden beinahe ausschließlich als „Gegen-68er“ und wirken heute zu weiten Teilen, so die These des Autors, als akademischer Arm der „Neuen Rechten“, dem Scharnier zwischen kompromissbereiten, revidierenden Konservatismus und unveränderbaren, fundamentalen und absoluten Rechtsextremismus. Das Ziel des „reinen Deutschtums“ bleibt somit bestehen
An diese sind sie, weil sie sich nicht von ihren Wurzeln verabschieden wollen, unweigerlich gekettet. Dietrich Heither bemerkte korrekt: die Dogmatik der B! ist ein „schaler Aufguß jener historischen Linie antidemokratischen Denkens, die sich machtpolitisch mit dem „Deutschen Sonderweg“ verbunden [hatte]“ und im Faschismus gipfelte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ideenpolitische Entstehung der Burschenschaften
- Die Folgen Napoleons und der Romantik auf Deutschland
- Männerbund und Frauenbild
- Die Jenaer Urburschenschaft
- Die liberale Minderheit von Carové bis zur NDB
- Einzelfall oder Kollektivschuld? – das Kapitel „NS-Zeit“
- In der frühen Bundesrepublik - zwischen Protektion und 68ern
- Wie die Burschenschaften die Entnazifizierung überlebten - Die Bedeutung der Alten Herren
- Zurechtfindung in der neuen Demokratie – die „Gegen-68er“?
- Einfallstor der „Neuen Rechten“?
- Die „Neue Rechte“
- Die Träger rechter Ideologie innerhalb der DB
- Rechte Ideologien und Aktivitäten
- Einfallstor der „Neuen Rechten“?
- Theoretische Erklärungsansätze
- Wie radikal sind sie? - Verbot oder Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Charakter der deutschen Burschenschaften, indem sie die weit verbreitete, vereinfachte Sichtweise ihrer Geschichte kritisch hinterfragt. Es wird geprüft, ob die Behauptung, Burschenschaften seien einst liberal gewesen und hätten sich erst 1936 durch Hitler auflösen lassen, zutrifft. Die Arbeit beleuchtet interne Differenzen und Ideologien der Burschenschaften und analysiert ihre Einordnung im rechtsextremen Spektrum der Bundesrepublik. Schließlich wird die Frage nach dem Umgang mit Burschenschaften seitens der Nicht-Korporierten erörtert.
- Kritische Auseinandersetzung mit der vereinfachten Darstellung der Geschichte der Burschenschaften.
- Analyse innerer Differenzen und Ideologien innerhalb der Burschenschaften.
- Einordnung der Burschenschaften im rechtsextremen Spektrum der Bundesrepublik.
- Untersuchung des völkischen Denkens und dessen Beständigkeit.
- Diskussion über den Umgang mit Burschenschaften durch Nicht-Mitglieder.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit untersucht die Frage nach dem Charakter der deutschen Burschenschaften und hinterfragt die These, sie seien einst liberal gewesen und erst 1936 durch Hitler aufgelöst worden. Sie analysiert interne Differenzen, Ideologien und die Einordnung der Burschenschaften im rechtsextremen Spektrum, sowie die Frage nach dem Umgang mit Burschenschaften seitens der Nicht-Korporierten.
Ideenpolitische Entstehung der Burschenschaften: Dieses Kapitel erforscht die Ursprünge der Burschenschaften im Kontext der Französischen Revolution, der napoleonischen Hegemonie und der Romantik. Es analysiert den Einfluss des „Volkes“ als romantisches Konzept und dessen Entwicklung zu einer Abstammungsgemeinschaft, im Gegensatz zum französischen aufgeklärten Staatsverständnis. Die Entstehung der Burschenschaften als Ausdruck des Bedürfnisses nach nationaler Einheit und die Rolle der „Volksgemeinschaft“ werden untersucht, wobei die anhaltende Präsenz völkischen Denkens hervorgehoben wird. Die Rolle der Romantik und des „Volkes“ wird als Wurzel des späteren Nationalismus und dessen Bedeutung für die Burschenschaften herausgestellt. Das Kapitel beleuchtet den Widerspruch zwischen dem Wunsch nach nationaler Einheit und der gleichzeitigen Vorstellung einer elitären Führungsschicht innerhalb dieser Gemeinschaft.
Die liberale Minderheit von Carové bis zur NDB: [Summary would go here - information not provided in the text sample]
Einzelfall oder Kollektivschuld? – das Kapitel „NS-Zeit“: [Summary would go here - information not provided in the text sample]
In der frühen Bundesrepublik - zwischen Protektion und 68ern: Dieses Kapitel untersucht, wie die Burschenschaften die Entnazifizierung überlebten und sich in der frühen Bundesrepublik neu positionierten. Es analysiert die Rolle der „Alten Herren“ und die Reaktion der Burschenschaften auf die Studentenbewegung von 1968. Der Fokus liegt auf der Anpassung und dem Überlebenskampf der Burschenschaften im Nachkriegsdeutschland und dem Umgang mit ihrer NS-Vergangenheit. Die Frage nach der erfolgreichen Neuorientierung und die Rolle der „Gegen-68er“ innerhalb dieses Kontextes wird diskutiert.
Einfallstor der „Neuen Rechten“?: Dieses Kapitel analysiert die Rolle der Burschenschaften im Kontext der „Neuen Rechten“. Es untersucht die Verbreitung rechter Ideologien und Aktivitäten innerhalb der Burschenschaften und erörtert die Frage, inwieweit sie als Einfallstor für die „Neue Rechte“ dienen. Die Kapitel analysiert verschiedene rechte Ideologien und deren Durchdringung in der Burschenschaft, und bewertet den Einfluss dieser Ideologien auf die heutige Situation. Die Rolle der Burschenschaften als Plattform für rechte Ideologien wird kritisch hinterfragt.
Theoretische Erklärungsansätze: [Summary would go here - information not provided in the text sample]
Wie radikal sind sie? - Verbot oder Diskussion: [Summary would go here - information not provided in the text sample]
Schlüsselwörter
Burschenschaften, Rechtsextremismus, Rechtspopulismus, Nationalsozialismus, Völkisch, Romantik, Napoleon, „Neue Rechte“, Entnazifizierung, Studentenbewegung 1968, Männerbund, Frauenbild, nationale Einheit, Korporationen, Alten Herren.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit über Deutsche Burschenschaften
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Charakter der deutschen Burschenschaften und hinterfragt gängige vereinfachte Darstellungen ihrer Geschichte. Sie analysiert interne Differenzen und Ideologien, die Einordnung der Burschenschaften im rechtsextremen Spektrum der Bundesrepublik und den Umgang mit ihnen durch Nicht-Mitglieder.
Welche These wird in der Arbeit geprüft?
Die Arbeit prüft die These, dass Burschenschaften einst liberal waren und erst 1936 durch Hitler aufgelöst wurden. Sie beleuchtet, ob diese Darstellung der komplexen Geschichte der Burschenschaften gerecht wird.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit der kritischen Auseinandersetzung mit der vereinfachten Darstellung der Geschichte der Burschenschaften, der Analyse innerer Differenzen und Ideologien, der Einordnung im rechtsextremen Spektrum, der Untersuchung des völkischen Denkens und der Diskussion über den Umgang mit Burschenschaften durch Nicht-Mitglieder.
Wie werden die Ursprünge der Burschenschaften dargestellt?
Die Arbeit untersucht die Ursprünge im Kontext der Französischen Revolution, der napoleonischen Hegemonie und der Romantik. Der Einfluss des „Volkes“ als romantisches Konzept und dessen Entwicklung zu einer Abstammungsgemeinschaft wird analysiert, ebenso wie die Entstehung der Burschenschaften als Ausdruck des Bedürfnisses nach nationaler Einheit und die Rolle der „Volksgemeinschaft“.
Welche Rolle spielt die NS-Zeit in der Arbeit?
Die Arbeit befasst sich mit der Rolle der Burschenschaften während des Nationalsozialismus und untersucht, wie sie die Entnazifizierung überlebten. Die Bedeutung der „Alten Herren“ und die Frage nach Kollektiv- oder Einzelfallschuld werden thematisiert.
Wie wird die Position der Burschenschaften in der frühen Bundesrepublik dargestellt?
Das Kapitel zur frühen Bundesrepublik analysiert die Anpassung und den Überlebenskampf der Burschenschaften im Nachkriegsdeutschland, ihren Umgang mit der NS-Vergangenheit, die Rolle der „Alten Herren“ und die Reaktion auf die Studentenbewegung von 1968. Die Frage nach der erfolgreichen Neuorientierung und die Rolle der „Gegen-68er“ wird diskutiert.
Welche Rolle spielen die Burschenschaften im Kontext der „Neuen Rechten“?
Die Arbeit untersucht die Verbreitung rechter Ideologien und Aktivitäten innerhalb der Burschenschaften und erörtert kritisch, inwieweit sie als Einfallstor für die „Neue Rechte“ dienen.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit kommt zu Schlussfolgerungen über den Charakter der Burschenschaften, ihre Entwicklung und ihren Platz im deutschen Kontext. Die konkreten Schlussfolgerungen sind im Text selbst nachzulesen und werden durch die Analyse der verschiedenen Kapitel erschlossen. Die Frage nach einem Verbot oder einer Diskussion über die Burschenschaften wird ebenfalls thematisiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Burschenschaften, Rechtsextremismus, Rechtspopulismus, Nationalsozialismus, Völkisch, Romantik, Napoleon, „Neue Rechte“, Entnazifizierung, Studentenbewegung 1968, Männerbund, Frauenbild, nationale Einheit, Korporationen, Alten Herren.
- Citation du texte
- Georg Kössler (Auteur), 2006, Dunkle Vergangenheit, dunkle Zukunft? Ein Blick auf die deutschen Burschenschaften , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/58438