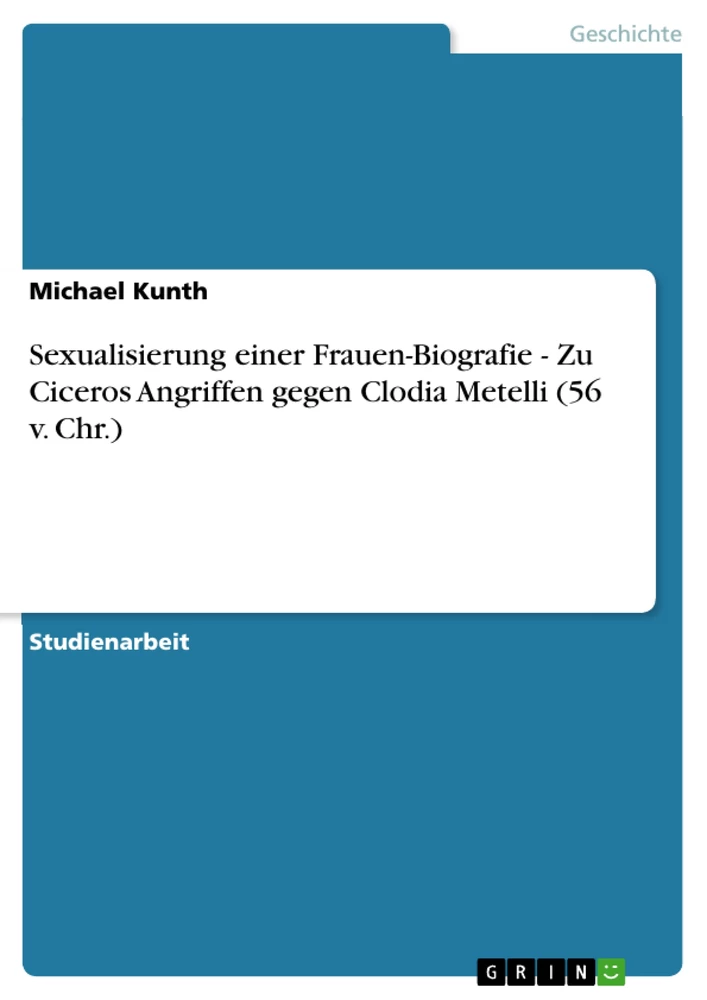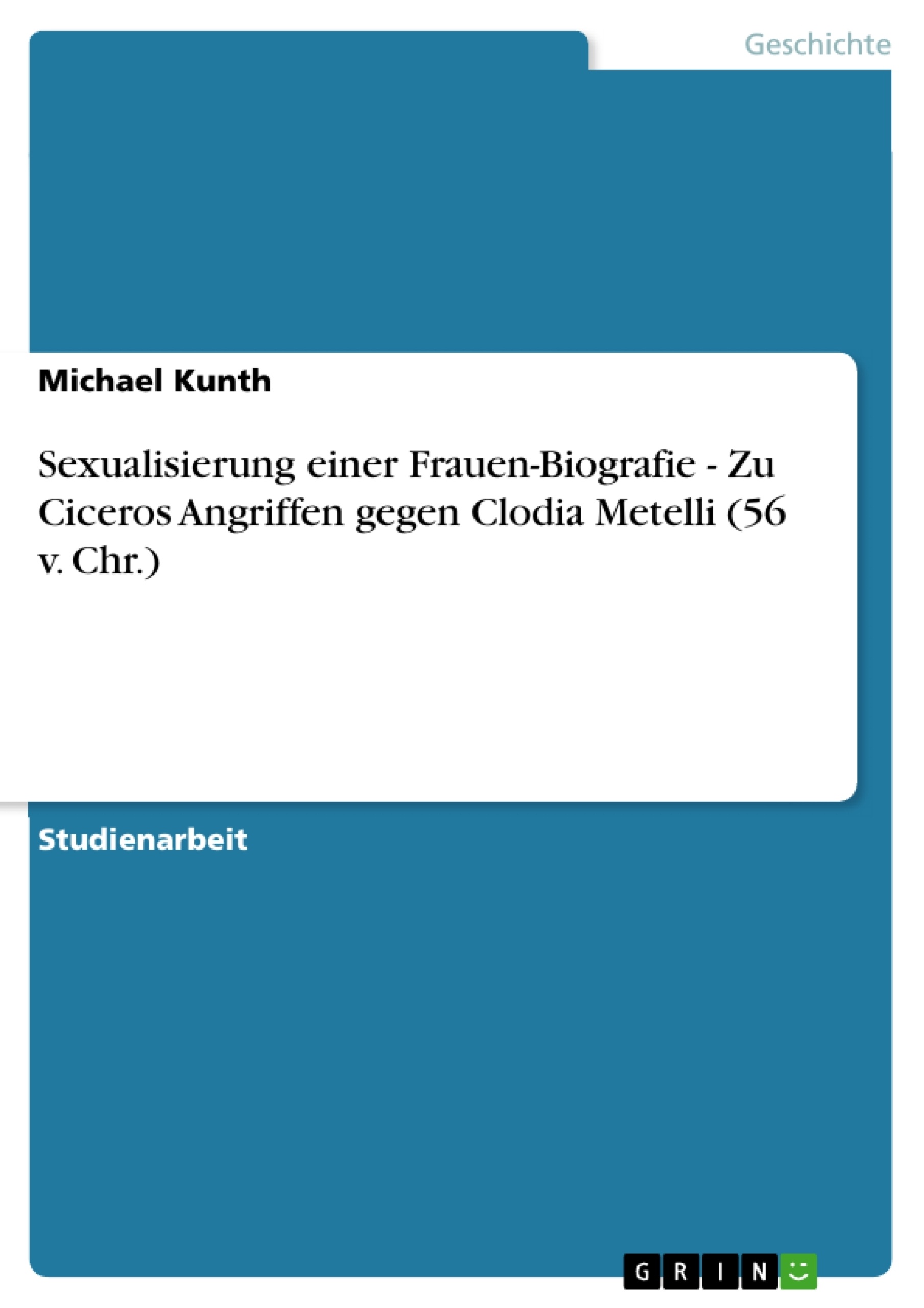Einleitung
Im Jahre 56 v. Chr. saß M. Caelius Rufus, ein junger Mann aus dem Ritterstand und ehemaliger Schüler von Cicero und Crassus,, auf der Anklagebank. Der Anklagepunkt lautete vi, bewaffneter Aufruhr und Gewaltanwendung. Caelius soll an den Übergriffen auf die alexandrinische Gesandtschaft in Neapel und Puteoli und an der Ermordung des Gelehrten Dion, der die Delegation angeführt hatte, beteiligt gewesen sein. Die Gesandtschaft wollte in Rom gegen die Wiedereinsetzung des vertriebenen Königs protestieren. Der König Ptolemaios XII befand sich in Rom im Exil und wurde von einflussreichen Kreisen Roms, darunter Pompeius, unterstützt.
In Ciceros Verteidigungsrede für Caelius geht es aber nur am Rande um die Ägyptenfrage. Scheinbar werden nicht politische Themen verhandelt, sondern nur ein Streit eines ehemaligen Liebespaares. Clodia wirft Caelius, ihrem ehemaligen Geliebten vor, er habe sich bei ihr Gold geliehen, das er für die Durchführung seiner Übergriffe gegen die Gesandtschaft genutzt habe, ferner habe er sie vergiften wollen. Cicero als letzter der wohl sechs Redner hatte die Aufgabe, die vorangegangenen Vorwürfe der Anklage, in denen Caelius’ sexuelle Eskapaden betont wurden, zu entkräften und zweitens die Zeugin der Anklage, Clodia, unglaubwürdig zu machen. So platzierte Cicero die sexuelle Diffamierung Clodias ins Zentrum seiner Rede.
Das negative Bild, das Cicero in seiner Rede von Clodia entwarf, beeinflusste auch antike Autoren wie Cassius Dio und Plutarch und ebenso die ältere Forschung. Das mag verschiedene Gründe haben. Zum einen ist die Rede Pro Caelio die einzige Quelle über diesen Prozess. Die anderen Reden sind nicht erhalten, auch Cicero berichtet in keiner anderen Schrift darüber. Zum anderen ist in der älteren Forschung die Tendenz zu erkennen, die Person Cicero positiv darzustellen. Überliefert ist eine Fülle von Cicero-Texten, die aufgrund Ciceros herausragenden rhetorischen Fähigkeiten wohl auch die älteren Forscher überzeugten. Ein weiterer Grund für die negative Clodia-Darstellung mag daran liegen, dass Frauengeschichte lange Zeit als nicht beachtenswerter Teil der Geschichte gesehen wurde und dass das Frauen-Bild heute ein anderes ist als damals. Die neuere Forschung hingegen versucht die Entstehung des negativen Clodia-Bilds zu erklären, um dann die Figur kritisch zu rekonstruieren. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Situation der Clodia Metelli
- Clodias Abkunft und rechtlicher Status
- Die Verbindung zu P. Clodius Pulcher
- Die iuvenes barbatuli
- Clodias Aktivitäten nach Cicero
- meretrix - Clodia als aktive Gestalterin
- impudicita - Clodia in der Öffentlichkeit
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert die Angriffe des römischen Redners Cicero auf Clodia Metelli in seiner Rede "Pro Caelio" (56 v. Chr.). Ziel ist es, Ciceros sexuelle Diffamierung von Clodia zu untersuchen und die Rolle der Sexualität in der römischen Politik zu beleuchten.
- Rekonstruktion der Situation von Clodia Metelli
- Analyse von Ciceros sexuellen Angriffen auf Clodia
- Verbindung von Sexualität und Politik in Ciceros Rede
- Kritik an der Entstehung des negativen Clodia-Bildes
- Untersuchung des Einflusses von Clodia auf die römische Politik
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt den Prozess gegen M. Caelius Rufus und Ciceros Rede "Pro Caelius" vor. Sie diskutiert die Entstehung des negativen Clodia-Bildes und die Bedeutung der Quellenlage.
- Das Kapitel "Die Situation der Clodia Metelli" untersucht Clodias Abkunft, rechtlichen Status, Verbindung zu ihrem Bruder P. Clodius Pulcher und den iuvenes barbatuli.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter des Textes sind: Clodia Metelli, Cicero, Pro Caelio, sexuelle Diffamierung, römische Politik, Geschlechterverhältnisse, römische Gesellschaft, iuvenes barbatuli, meretrix, impudicita.
- Citation du texte
- Michael Kunth (Auteur), 2006, Sexualisierung einer Frauen-Biografie - Zu Ciceros Angriffen gegen Clodia Metelli (56 v. Chr.), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/58441