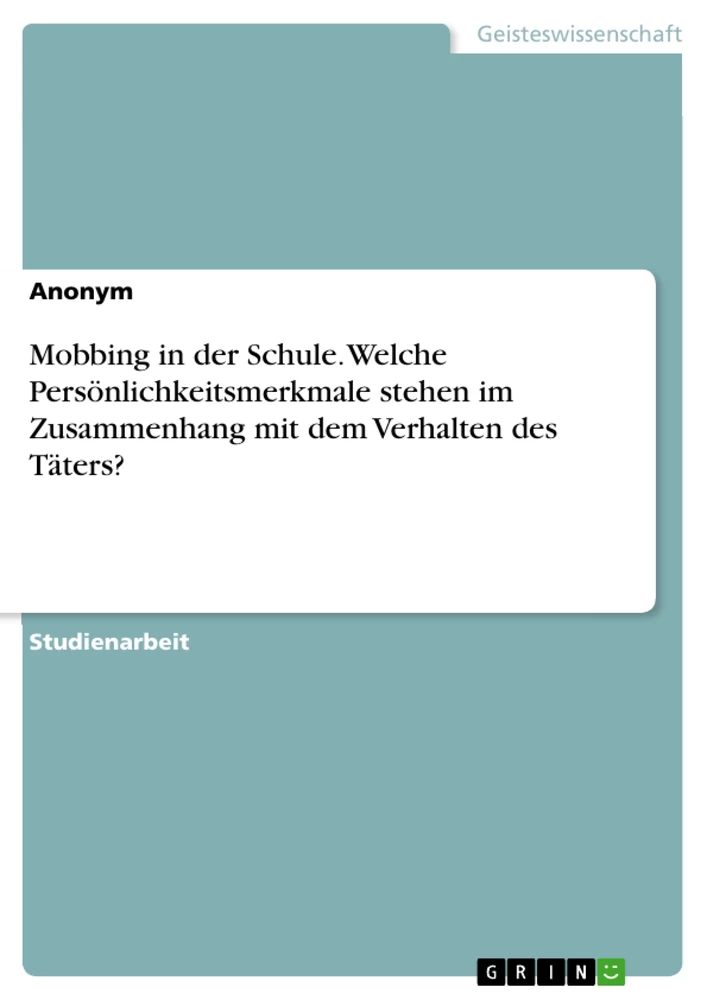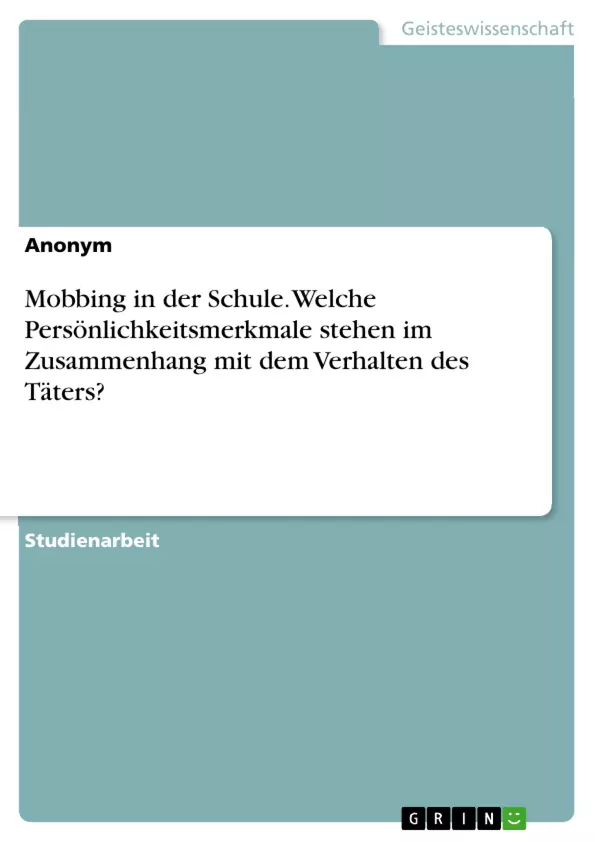In dieser Arbeit wird sich auf diejenigen Menschen konzentriert, die Anderen körperliche und/oder seelische Schmerzen hinzufügen. Gegenstand der Hausarbeit soll sein, herauszustellen, inwiefern Persönlichkeitsmerkmale im Zusammenhang mit dem Täterverhalten stehen. Dabei beziehe ich sowohl typische Verhaltensweisen, aber auch das Geschlecht, familiäre Erziehungsstile bzw. familiäre Umstände sowie Migrationshintergründe ein, die ebenfalls Einfluss auf Persönlichkeitsstrukturen haben können.
Im ersten Teil der Arbeit werde ich zunächst den Begriff Mobbing genauer definieren und mit dem begriffsverwandten Wort Bullying vergleichen. Anschließend soll die Frage geklärt werden, ab wann man tatsächlich einen Mobbingfall identifizieren kann und wo demnach die Grenzen zwischen Spielereien und einem echten Mobbing-Verhalten von Kindern und Jugendlichen gezogen werden können. Danach soll die Rollenverteilung in Mobbing-Situationen genauer untersucht werden, indem zuerst die Rolle des Opfers und die des Täters gegenübergestellt wird und danach weitere bedeutsame Rollen betrachtet werden. Im vierten Kapitel sollen dann Ursachen und Folgen für Mobbing geklärt werden. Dafür werden sowohl die Ursachen und Folgen des Opfers beschrieben, der Fokus soll allerdings in beiden Punkten auf der Täterseite liegen. Folgend werden Befunde der HBSC-Studie zu Tätermerkmalen dargestellt, welche im nächsten Schritt diskutiert werden. Zudem sollen weitere Persönlichkeitsmerkmale beschrieben und die Ergebnisse dieser Hausarbeit im Fazit zusammengefasst werden.
Fast jeder sechste 15-Jährige wird in Deutschland regelmäßig Opfer von teils massiven körperlichen und/oder seelischen Misshandlungen durch Mitschüler. Die 2017 veröffentlichte PISA-Studie zeigt, dass diese Schüler dabei sogar mehrmals im Monat von Mobbing betroffen sind. Die Schule wird in solchen Fällen von Kindern und Jugendlichen weniger als Lernort, sondern mehr als ein Ort der Qual wahrgenommen. Durch die alltäglichen Vorfälle entwickelte sich Mobbing als Teil des Schulalltags und bildet seit einigen Jahrzehnten den Ausgangspunkt vieler öffentlicher Debatten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Mobbing in der Schule
- Der Begriff ,,Mobbing‘‘ vs. ,,Bullying‘‘
- Ab wann spricht man von Mobbing?
- Die Rollenverteilung
- Die Unterscheidung zwischen Opfer und Täter
- Mobbing als Gruppenphänomen/weitere Rollen
- Ursachen und Folgen
- Mögliche Ursachen im Fokus der Täterseite
- Mögliche Folgen im Fokus der Täterseite
- Studie zur Täterperspektive
- Diskussion und weitere Persönlichkeitsmerkmale des Täters
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit setzt sich zum Ziel, die Persönlichkeitsmerkmale von Mobbing-Tätern zu untersuchen und deren Zusammenhang mit dem Täterverhalten zu beleuchten. Dabei werden typische Verhaltensweisen, Geschlecht, familiäre Erziehungsstile, familiäre Umstände sowie Migrationshintergründe analysiert.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs „Mobbing“
- Rollenverteilung in Mobbing-Situationen
- Ursachen und Folgen von Mobbing aus Täterperspektive
- Analyse von Tätermerkmalen im Kontext der HBSC-Studie
- Diskussion weiterer Persönlichkeitsmerkmale des Mobbing-Täters
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt das Thema Mobbing in der Schule vor und erläutert die persönliche Motivation der Autorin für die Themenwahl. Mobbing wird als ein wichtiges und unterschätztes Problem dargestellt, das besonders die Opfer betrifft. Die Hausarbeit konzentriert sich auf die Täterseite und untersucht, welche Persönlichkeitsmerkmale mit ihrem Verhalten in Verbindung stehen.
- Mobbing in der Schule: Das zweite Kapitel definiert den Begriff „Mobbing“ und grenzt ihn vom Begriff „Bullying“ ab. Es werden verschiedene Aspekte des Mobbing-Verhaltens und dessen Merkmale diskutiert. Außerdem wird die Frage geklärt, ab wann man von Mobbing sprechen kann und wo die Grenzen zwischen „Spielereien“ und „echtem“ Mobbing-Verhalten liegen.
- Die Rollenverteilung: Dieses Kapitel analysiert die Rollenverteilung in Mobbing-Situationen und unterscheidet zwischen Opfern (Victims) und Tätern (Bullies). Außerdem werden weitere wichtige Rollen wie Assistenten, Verstärker, Verteidiger und Außenstehende vorgestellt und ihre Funktionen im Mobbing-Prozess erläutert.
- Ursachen und Folgen: Das vierte Kapitel befasst sich mit den Ursachen und Folgen von Mobbing, wobei der Fokus auf der Täterseite liegt. Es werden verschiedene Faktoren untersucht, die das Risiko erhöhen, zum Mobbing-Täter zu werden, wie z.B. familiäre Sozialisation, Erziehungsstil, Peergroup-Einfluss und die Rolle von Medien. Darüber hinaus werden die möglichen Folgen von Mobbing für Täter und Opfer beleuchtet, die weitreichende Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl, die psychische Gesundheit und die soziale Entwicklung haben können.
- Studie zur Täterperspektive: Kapitel 5 präsentiert Ergebnisse der HBSC-Studie (2015), die sich mit dem Thema Mobbing und Gewalt im schulischen Kontext auseinandersetzt. Die Studie untersucht den Zusammenhang zwischen dem Täterverhalten und verschiedenen soziodemografischen Faktoren wie Geschlecht, Alter, familiärem Wohlstand und Migrationshintergrund. Die Ergebnisse zeigen eine Jungendominanz bei Mobbing-Tätern, wobei insbesondere Jungen aus mittleren und hohen Wohlstandsgruppen häufiger zu Mobbing-Tätern werden. Die Studie beleuchtet zudem den Einfluss des Migrationshintergrundes und die Rolle von externalisierender Problembewältigung bei Jungen.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter und Fokusthemen der Hausarbeit umfassen Mobbing, Bullying, Tätermerkmale, Persönlichkeitsmerkmale, Risikofaktoren, familiäre Sozialisation, Erziehungsstil, Peergroup, Migrationshintergrund, Geschlechterunterschiede, HBSC-Studie, Selbstwertgefühl, Empathie, soziale Kompetenz, Dominanz, Gewaltprävention und die Bedeutung von Interventionen.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2018, Mobbing in der Schule. Welche Persönlichkeitsmerkmale stehen im Zusammenhang mit dem Verhalten des Täters?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/584652