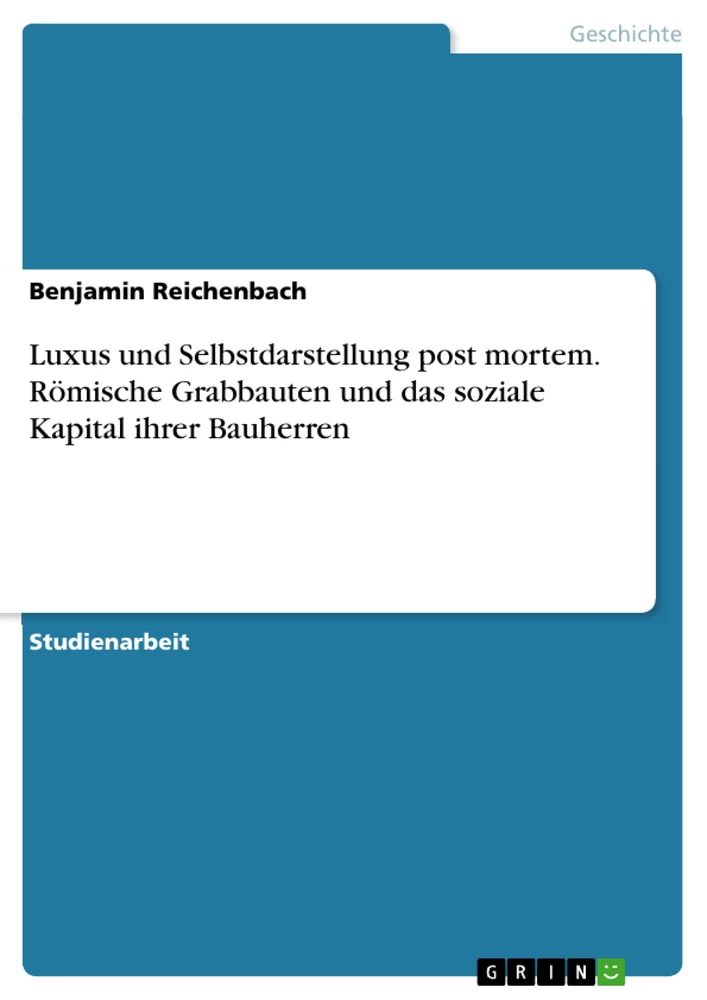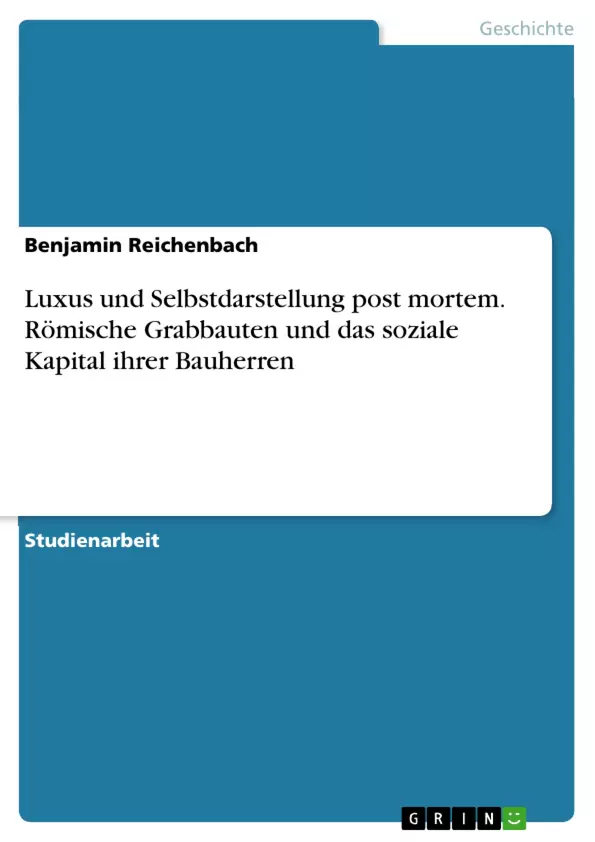In welchem Zusammenhang der funerale Luxus der Nobilität zu der römischen Expansion steht und was mit der immer weiter fortschreitenden Monumentalisierung der Grabbauten erreicht werden sollte, ist das Thema dieser Hausarbeit. Zu Beginn wird sowohl die Quellen- und Forschungslage als auch die Kapitalstheorie von Pierre Bourdieu erläutert. Im darauffolgenden Kapitel soll die römische Expansion, sowie der damit einhergehende Wohlstand und die einsetzende Hellenisierung Roms ab dem späten dritten Jahrhundert bis zur Kaiserzeit, erörtert werden. Die Bestattungsformen werden anschließend erläutert. Kapitel 2.5 beschäftigt sich daraufhin mit den Grabmälern und der Sepulkralkultur. Diese wird wiederum im Zusammenhang mit der Theorie der Kapitalumwandlung von Pierre Bourdieu erörtert.
Sei es durch Kriege, unzureichende Hygiene oder schlechte Lebensmittelversorgung, die Todesthematik war in Rom ebenso omnipräsent wie der Wunsch nach einem gesellschaftlichen Aufstieg, der durch die soziale Dynamik und den cursus honorum fortwährend verstärkt wurde. Diese Tendenzen führten dazu, dass der Tod selbst zu einem sozialen Ereignis wurde. Durch die pompa funebris, den Leichenzug, welcher der tatsächlichen Bestattung vorausging, erreichten die Angehörigen des Verstorbenen einen großen Teil der römischen Bürgerschaft und versuchten durch diese Prozession, das soziale Kapital der Familie zu steigern.
Im Konkurrenzkampf um Ämter und Macht war der Umgang mit den Verstorbenen ein wichtiges Instrument, respektive eine bedeutende Form, sowohl der privaten als auch der öffentlichen Repräsentation. Um die sozialen Umstände der Sepulkralkultur genauer zu erörtern, bezieht sich diese Arbeit auf den französischen Sozialphilosophen und Soziologen Pierre Bourdieu, dessen Theorie zu den Kapitalumwandlungen hier angewendet wird. Während in der frühen und mittleren Republik noch Brandbestattungen die Regel waren, kamen in der späten Republik immer mehr Körperbestattungen auf. Doch wie kam es zu dieser Veränderung in der Kultur des Bestattens? Um dies erklären zu können, lohnt es sich zunächst einen Blick auf das wachsende ökonomische Kapital der römischen Nobiles zu werfen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Luxus und Selbstdarstellung post mortem
- Quellen- und Forschungslage
- Methodik
- Schaffung von ökonomischem Kapital durch Expansion
- Bestattungsformen
- Grabbauten als soziales Kapital
- Resümee
- Quelleneditionen
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit beschäftigt sich mit dem Phänomen des Luxus und der Selbstdarstellung nach dem Tod im Kontext römischer Grabbauten. Sie untersucht den Zusammenhang zwischen dem ökonomischen Kapital der römischen Nobilität, der Expansion des Römischen Reichs und der zunehmenden Monumentalisierung von Grabbauten in der späten Republik.
- Soziale Dynamik und der cursus honorum in der römischen Republik
- Entwicklung der Sepulkralkultur in der römischen Republik
- Einfluss der griechischen Kultur auf die römische Bestattungskultur
- Theorie der Kapitalumwandlungen von Pierre Bourdieu im Kontext der römischen Grabbauten
- Zusammenhang zwischen ökonomischem Kapital, Luxus und gesellschaftlicher Repräsentation
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik des Todes und der postmortalen Existenz in der römischen Republik dar. Sie zeigt auf, wie der Tod selbst zu einem sozialen Ereignis wurde und die pompa funebris als Mittel der Repräsentation des sozialen Kapitals der Familie diente.
Kapitel 2.1 beleuchtet die Quellenlage und Forschungsgeschichte zum Thema Bestattung und Grabbauten in der römischen Republik. Es wird festgestellt, dass die antiken literarischen Quellen relativ spärlich sind und die neuzeitliche Forschung sich hauptsächlich auf archäologische Funde und Befunde konzentriert.
Kapitel 2.2 erläutert die Methodik der Arbeit, die auf Pierre Bourdieus Theorie der Kapitalumwandlungen basiert.
Kapitel 2.3 behandelt die ökonomischen Folgen der römischen Expansion und deren Einfluss auf den Wohlstand der römischen Nobilität. Es wird die Bedeutung der Kriege gegen Karthago und Makedonien für die Akkumulation von ökonomischem Kapital hervorgehoben.
Kapitel 2.4 befasst sich mit den unterschiedlichen Bestattungsformen in der römischen Republik und zeigt den Wandel von der Brandbestattung hin zur Körperbestattung auf.
Kapitel 2.5 analysiert die Grabbauten als Ausdruck des sozialen Kapitals ihrer Bauherren im Kontext der Theorie der Kapitalumwandlungen von Pierre Bourdieu.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Schlüsselbegriffen Sepulkralkultur, römische Republik, Nobilität, Luxus, Selbstdarstellung, soziale Kapital, ökonomisches Kapital, Expansion, Hellenisierung, Bestattungsformen, Grabbauten, Pierre Bourdieu, Kapitalumwandlungen.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Zweck erfüllten monumentale Grabbauten im antiken Rom?
Sie dienten der Selbstdarstellung der Nobilität und der Umwandlung von ökonomischem Reichtum in dauerhaftes soziales Kapital für die Familie.
Was ist die 'pompa funebris'?
Ein prunkvoller Leichenzug, der der Bestattung vorausging und dazu diente, die öffentliche Aufmerksamkeit auf das Prestige und die Ahnen der Familie zu lenken.
Wie beeinflusste die Expansion Roms die Bestattungskultur?
Durch Kriege und Eroberungen floss massiv ökonomisches Kapital nach Rom, was einen luxuriöseren Lebensstil und aufwendigere Sepulkralkultur ermöglichte.
Welche Rolle spielt die Theorie von Pierre Bourdieu in dieser Arbeit?
Bourdieus Konzept der 'Kapitalumwandlung' wird genutzt, um zu erklären, wie römische Eliten materiellen Besitz in gesellschaftliches Ansehen (soziales Kapital) transformierten.
Wann fand der Wandel von Brand- zu Körperbestattungen statt?
Dieser Wandel setzte verstärkt in der späten Republik ein, beeinflusst durch wachsenden Wohlstand und die Hellenisierung Roms.
- Quote paper
- Benjamin Reichenbach (Author), 2020, Luxus und Selbstdarstellung post mortem. Römische Grabbauten und das soziale Kapital ihrer Bauherren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/584744