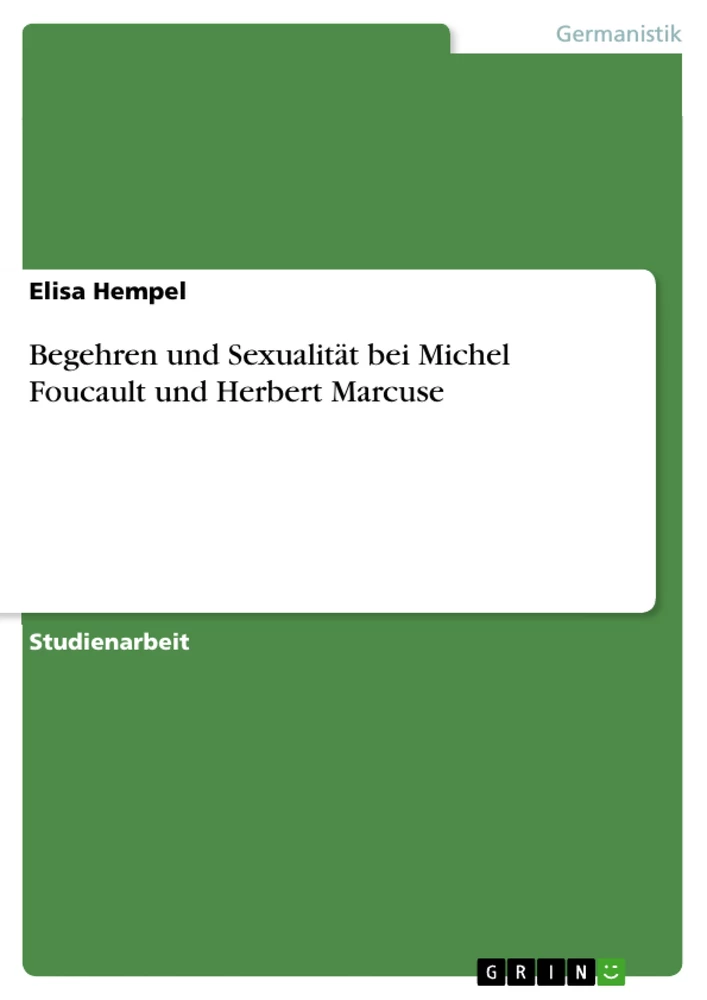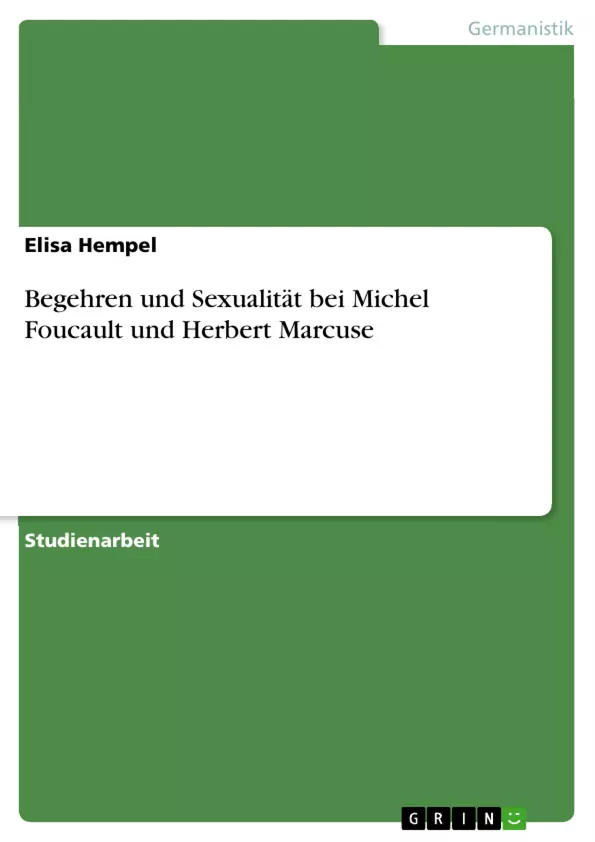Michel Foucault, der Sexualität in "Der Wille zum Wissen", dem ersten Band aus der Reihe "Sexualität und Wahrheit", im Zusammenhang mit seiner Theorie der Macht und des Subjektes untersucht, versteht das Begehren als gemacht, geformt und verändert.
Auch Herbert Marcuse geht in seiner Theorie der Entsublimierung in "Der eindimensionale Mensch" und "Triebstruktur und Gesellschaft" von einer beeinflussten Sexualität in der fortgeschrittenen Industriegesellschaft aus.
Die Arbeit beschäftigt sich vergleichend mit beiden Auffassungen von Begehren und Sexualität und arbeitet die Gemeinsamkeiten heraus. Diese finden sich beispielsweise in der Annahme eines "Verblendungszusammenhanges" oder im Hinblick auf positive, produktive Formen von Macht.
Am Ende steht als Alternative, sowohl bei Foucault als auch bei Marcuse, eine erweiterte Erotik, die vom Körper und den Lüsten ausgeht.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Sexualität und Begehren bei Michel Foucault
- Sexualität als Ansatzpunkt für die Untersuchung von Macht und Wissen
- Anreizung statt Unterdrückung
- Macht und Lust
- Scientia sexualis gegen ars erotica
- In der Repressionshypothese gefangen?
- Sexualität bei Herbert Marcuse
- Unterworfenes Lustprinzip in „Triebstruktur und Gesellschaft“
- Unfreie Bedürfnisse und unfreie Befriedigung
- „Der eindimensionale Mensch“: Sexualität bleibt systemkonform
- Gemeinsamkeiten zwischen Foucault und Marcuse
- Frankfurter Schule und Poststrukturalismus
- Totalitäre Machtformen
- Verblendungszusammenhang
- Deformierte Sexualität
- Repression
- Positive Formen der Macht
- Auswege und Gegenentwürfe
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Konzepte von Sexualität und Begehren bei Michel Foucault und Herbert Marcuse, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede in ihren Ansätzen aufzuzeigen. Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse der jeweiligen Theorien im Kontext von Machtstrukturen und gesellschaftlichen Normen.
- Foucaults Theorie der Macht und Wissen in Bezug auf Sexualität
- Marcuses Kritik an der repressiven Gesellschaft und deren Einfluss auf das Begehren
- Die Repressionshypothese und ihre Kritik bei beiden Denkern
- Gemeinsamkeiten zwischen Foucaults Poststrukturalismus und der Frankfurter Schule
- Konzepte von totalitärer Macht und Verblendungszusammenhang
Zusammenfassung der Kapitel
2. Sexualität und Begehren bei Michel Foucault: Dieses Kapitel analysiert Foucaults genealogischen Ansatz zur Sexualität, der Macht und Wissen als untrennbar miteinander verbunden darstellt. Foucault kritisiert die Repressionshypothese, die Sexualität als primär unterdrückt betrachtet. Stattdessen argumentiert er, dass Macht nicht nur repressiv, sondern auch produktiv ist, indem sie Sexualität konstituiert und Diskurse formt. Der Text beleuchtet Foucaults Konzept der "Scientia sexualis" im Gegensatz zur "ars erotica", wobei der Fokus auf der Generierung von Wissen über Sexualität liegt, anstatt auf ihrer unmittelbaren Erfahrung. Die Analyse betont, wie Sprechen über Sexualität, trotz des Anscheins von Befreiung, das bestehende System aufrechterhält und die Machtstrukturen festigt. Foucault betont die Produktivität von Macht, die Sexualität nicht nur einschränkt, sondern auch gestaltet und in neue Formen bringt.
3. Sexualität bei Herbert Marcuse: Dieses Kapitel befasst sich mit Marcuses Theorie der Sexualität im Kontext der fortgeschrittenen Industriegesellschaft. Es untersucht das Konzept des unterworfenen Lustprinzips und die Deformation von Bedürfnissen und Befriedigungen in einer Gesellschaft, die durch technologische Kontrolle und Manipulation gekennzeichnet ist. Marcuses Analyse in "Der eindimensionale Mensch" und "Triebstruktur und Gesellschaft" wird eingehend betrachtet. Der Fokus liegt auf der Frage, wie die herrschenden Machtstrukturen die Sexualität beeinflussen und sie in systemkonforme Bahnen lenken, wodurch authentische Befriedigung und individuelle Entfaltung verhindert werden. Die Zusammenfassung analysiert, wie Marcuse die Unterdrückung der Sexualität als Ausdruck einer umfassenderen gesellschaftlichen Repression versteht.
4. Gemeinsamkeiten zwischen Foucault und Marcuse: Dieses Kapitel untersucht die Überschneidungen zwischen den Theorien Foucaults und Marcuses, trotz ihrer unterschiedlichen methodischen Ansätze. Es analysiert Parallelen in ihren Analysen totalitärer Machtstrukturen, dem Konzept des Verblendungszusammenhangs, und der Deformation von Sexualität als Folge gesellschaftlicher Repression. Der Vergleich zwischen dem Poststrukturalismus Foucaults und der Frankfurter Schule Marcueses wird vorgenommen, um Gemeinsamkeiten in ihrer Kritik an den herrschenden Machtverhältnissen und deren Auswirkungen auf das Individuum und dessen Begehren aufzuzeigen. Der Text beleuchtet die positiven Konzepte der Macht bei Foucault und erörtert mögliche Auswege und Gegenentwürfe, die beide Autoren implizit oder explizit ansprechen.
Schlüsselwörter
Michel Foucault, Herbert Marcuse, Sexualität, Begehren, Macht, Wissen, Repression, Frankfurter Schule, Poststrukturalismus, Totalitarismus, Verblendungszusammenhang, Industriegesellschaft, Diskurse, Subjekt.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Sexualität und Begehren bei Foucault und Marcuse
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht und kontrastiert die Theorien von Michel Foucault und Herbert Marcuse zur Sexualität und zum Begehren. Der Fokus liegt auf der Analyse ihrer jeweiligen Ansätze im Kontext von Machtstrukturen und gesellschaftlichen Normen. Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Denker werden herausgearbeitet.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Foucaults Theorie von Macht und Wissen in Bezug auf Sexualität, Marcuses Kritik an der repressiven Gesellschaft und deren Einfluss auf das Begehren, die Repressionshypothese und ihre Kritik bei beiden Denkern, Gemeinsamkeiten zwischen Foucaults Poststrukturalismus und der Frankfurter Schule, sowie Konzepte von totalitärer Macht und Verblendungszusammenhang.
Wie analysiert die Arbeit Michel Foucaults Ansatz?
Die Arbeit analysiert Foucaults genealogischen Ansatz zur Sexualität, der Macht und Wissen als untrennbar miteinander verbunden darstellt. Sie beleuchtet seine Kritik an der Repressionshypothese und sein Konzept der "Scientia sexualis" im Gegensatz zur "ars erotica". Der Fokus liegt auf der Produktivität von Macht, die Sexualität nicht nur einschränkt, sondern auch gestaltet und in neue Formen bringt.
Wie wird Herbert Marcuses Theorie der Sexualität dargestellt?
Die Arbeit befasst sich mit Marcuses Theorie der Sexualität im Kontext der fortgeschrittenen Industriegesellschaft. Sie untersucht das Konzept des unterworfenen Lustprinzips und die Deformation von Bedürfnissen und Befriedigungen in einer technologisch kontrollierten Gesellschaft. Der Fokus liegt auf dem Einfluss herrschender Machtstrukturen auf die Sexualität und die Verhinderung authentischer Befriedigung und individueller Entfaltung.
Welche Gemeinsamkeiten zwischen Foucault und Marcuse werden aufgezeigt?
Die Arbeit untersucht die Überschneidungen zwischen den Theorien Foucaults und Marcuses, trotz ihrer unterschiedlichen methodischen Ansätze. Sie analysiert Parallelen in ihren Analysen totalitärer Machtstrukturen, dem Konzept des Verblendungszusammenhangs und der Deformation von Sexualität als Folge gesellschaftlicher Repression. Der Vergleich zwischen dem Poststrukturalismus Foucaults und der Frankfurter Schule Marcueses wird vorgenommen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Michel Foucault, Herbert Marcuse, Sexualität, Begehren, Macht, Wissen, Repression, Frankfurter Schule, Poststrukturalismus, Totalitarismus, Verblendungszusammenhang, Industriegesellschaft, Diskurse, Subjekt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet ein Vorwort, Kapitel zu Sexualität und Begehren bei Foucault und Marcuse, ein Kapitel zum Vergleich beider Ansätze, und ein Schlusswort. Jedes Kapitel beinhaltet eine detaillierte Analyse der jeweiligen Theorien.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit richtet sich an Leser, die sich für die Theorien von Michel Foucault und Herbert Marcuse interessieren, insbesondere im Kontext von Sexualität, Macht und Gesellschaft. Sie eignet sich für akademische Zwecke und die Analyse von gesellschaftlichen und politischen Themen.
- Citar trabajo
- Elisa Hempel (Autor), 2004, Begehren und Sexualität bei Michel Foucault und Herbert Marcuse, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/58489