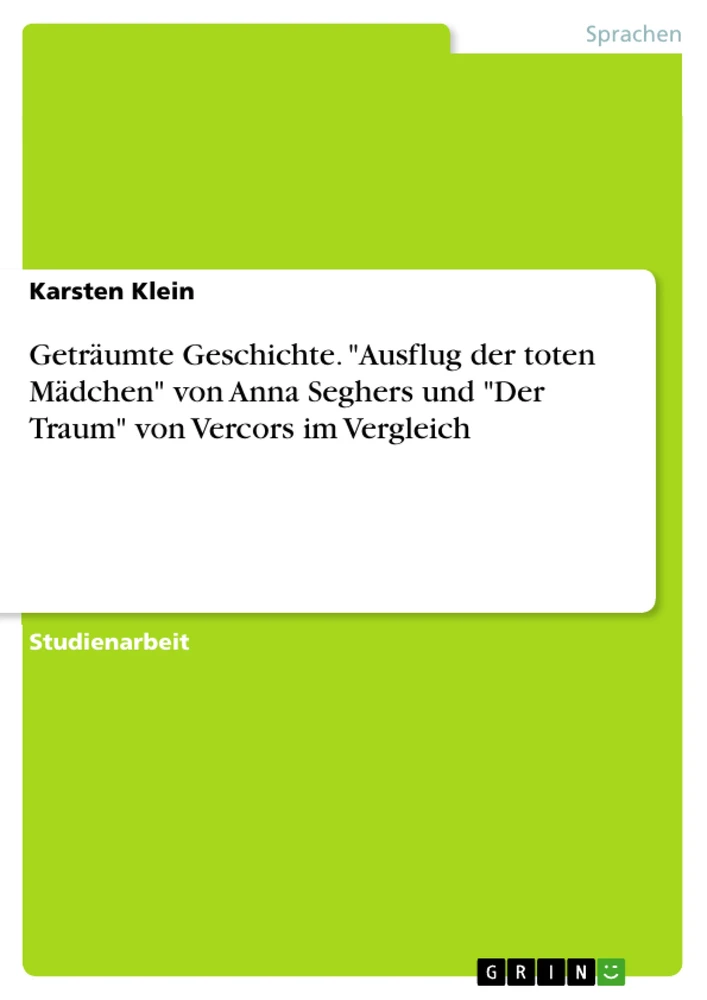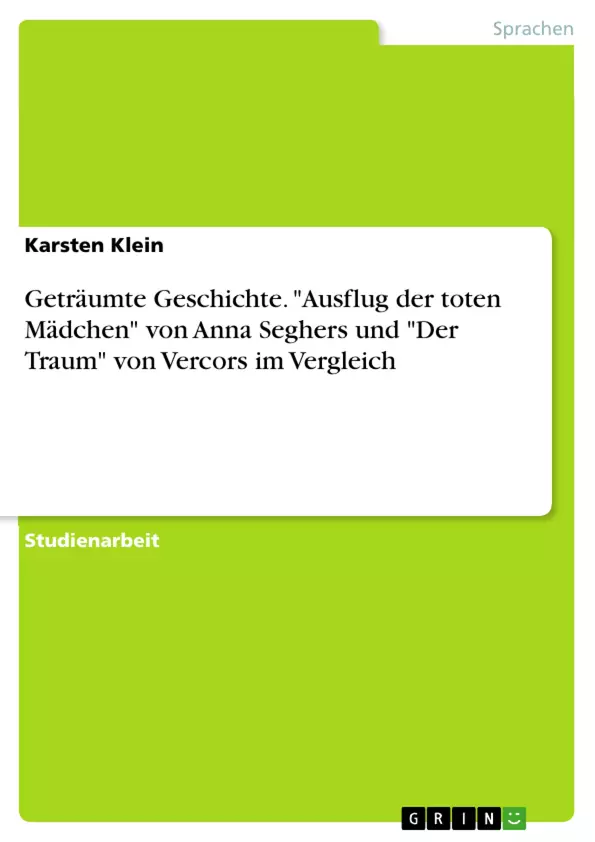Die Darstellung von historischen Ereignissen ist, für die Kunst im Allgemeinen und die Literatur im Besonderen, schon immer ein beliebtes Sujet. Jedoch ist dies nicht ohne weiteres möglich, ohne auf eine Reihe von Problemen zu stoßen. Diese Probleme manifestieren sich speziell, wenn man ein historisches Ereignis mithilfe einer homodiegetischen Erzählinstanz zu präsentieren versucht. Diese Erzählsituation wirft unmittelbar die Frage auf, ob die gesamten Auswirkungen des betreffenden historischen Ereignisses, nur durch die subjektive Wahrnehmung einer einzelnen Person wiedergegeben werden können.
Einzig durch die Wahl dieser Art der Darstellung entsteht also das Problem, dass die geschichtlichen Geschehnisse und deren Bedeutsamkeit für eine Vielzahl von Menschen auf die subjektiven Erlebnisse einzelner Figuren reduziert werden. Zudem eröffnet sich ein weiteres Problemfeld durch eine Tatsache, die unabhängig von der Erzählsituation auf jegliche literarische Darstellung von Geschichte zutrifft und die seit den ausführlichen Arbeiten Hayden Whites stark diskutiert wird. Bei diesem Umstand handelt es sich um die Frage, wie das Problem zu bewältigen ist, dass geschichtliche Ereignisse nur zeitlich rückblickend verstanden werden können.
Dieses Spannungsfeld stellt Autoren stets vor neue Herausforderungen, die sie versuchen mit unterschiedlichen literarischen Ansätzen zu bewältigen. Diese Strategien müssen sich zudem ebenfalls nach dem konkreten historischen Ereignis richten, welches beschrieben werden soll. Besonders relevant wird dies bei der Betrachtung von historisch bedeutsamen Ereignissen. Wichtige Beispiele aus der jüngeren Geschichte sind der Erste und Zweiten Weltkrieg, sowie die Shoah. Bei dieser geschichtlich sehr einschneidenden Thematik ergibt sich, neben den bereits erläuterten Schwierigkeiten, ein weiteres Problem.
Während der Shoah wurde die systematische Vernichtung einer gesamten Bevölkerungsgruppe angestrebt, was auch die Beseitigung jeglicher Überbleibsel ihrer Existenz unweigerlich mit sich führt. Durch die Vernichtung können die Angehörigen dieser Bevölkerungsgruppe, die während der Shoah ermordet wurden und vergessen werden sollten, selber nicht als Zeugen für diesen Teil der Geschichte auftreten, sondern es müssen andere an ihre Stelle treten und für diese Menschen sprechen und berichten. Diese Problematik der Darstellbarkeit, oder auch ‚Unsagbarkeit‘, spielt in den holocaust studies eine wichtige Rolle.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Grenzen der literarischen Darstellung von Geschichte
- Der Traum als Grenzüberschreitung
- Der Traum in Der Ausflug der toten Mädchen
- Die Erzähltechnik und das Zeitverhältnis
- Der Perspektivwechsel in der Binnenerzählung
- Die Verwendung von Tempusformen
- Die Traumsituation
- Der Traum in Der Traum
- Der Rahmen
- Die Traumsituation
- Die Begegnung der Darstellungsproblematik
- Der Vergleich der Träume
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die literarische Darstellung von Geschichte mithilfe des Traums, insbesondere im Kontext des Holocaust. Sie vergleicht die Traumerfahrungen in Anna Seghers’ Der Ausflug der toten Mädchen und Vercors’ Der Traum, um zu analysieren, wie diese literarischen Mittel der Unsagbarkeit des Holocaust begegnen und die Grenzen der Darstellung überschreiten.
- Die Grenzen der literarischen Darstellung von Geschichte, insbesondere des Holocaust
- Die Rolle des Traums als Grenzüberschreitung und Möglichkeit, Unsagbares zu repräsentieren
- Analyse der Erzähltechnik und der Traumsituation in Der Ausflug der toten Mädchen und Der Traum
- Der Vergleich der beiden Traumerfahrungen und ihrer literarischen Gestaltung
- Die Bedeutung des Traums für die literarische Auseinandersetzung mit Geschichte
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beschäftigt sich mit den Grenzen der literarischen Darstellung von Geschichte, insbesondere mit den Herausforderungen, die sich bei der Darstellung des Holocaust ergeben. Dabei wird auf die Problematik der subjektiven Geschichtswahrnehmung und die Schwierigkeiten der zeitlichen Rekonstruktion von Ereignissen eingegangen. Im Anschluss wird der Traum als Mittel der Grenzüberschreitung vorgestellt und seine Möglichkeiten, Unsagbares zu repräsentieren, erörtert.
Kapitel zwei untersucht die Traumsituation in Anna Seghers’ Der Ausflug der toten Mädchen. Hierbei werden die Erzähltechnik, der Perspektivwechsel in der Binnenerzählung, die Verwendung von Tempusformen sowie die konkrete Gestaltung der Traumsituation analysiert.
Das dritte Kapitel befasst sich mit Vercors’ Der Traum. Hier werden die Rahmenerzählung und die Traumsituation analysiert, um zu untersuchen, wie die Darstellungsproblematik in diesem Text bewältigt wird.
Das vierte Kapitel vergleicht die beiden Traumerfahrungen in Der Ausflug der toten Mädchen und Der Traum und identifiziert Gemeinsamkeiten und Unterschiede in ihrer Gestaltung. Hierbei werden die Ergebnisse der vorherigen Kapitel zusammengeführt, um die unterschiedlichen Möglichkeiten des Traums als Mittel der literarischen Auseinandersetzung mit Geschichte zu beleuchten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Holocaust, Traum, literarische Darstellung von Geschichte, Unsagbarkeit, Erzähltechnik, Perspektivwechsel, Tempusformen, Traumsituation, Der Ausflug der toten Mädchen, Anna Seghers, Der Traum, Vercors, Vergleich, literarische Auseinandersetzung mit Geschichte.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird Geschichte im „Ausflug der toten Mädchen“ dargestellt?
Anna Seghers nutzt eine Traumsituation und Rückblenden, um die persönlichen Schicksale ihrer Mitschülerinnen mit den Schrecken des Nationalsozialismus zu verknüpfen.
Welche Funktion hat der Traum in Vercors’ „Der Traum“?
Der Traum dient als Mittel, um die „Unsagbarkeit“ und das Grauen des Holocaust literarisch zu verarbeiten und Grenzen der Realität zu überschreiten.
Was ist das Problem der subjektiven Geschichtswahrnehmung in der Literatur?
Historische Ereignisse werden oft auf das Erleben einzelner Figuren reduziert, was die Frage aufwirft, ob so die gesamte Tragweite der Geschichte erfasst werden kann.
Was bedeuten „holocaust studies“ im Kontext dieser Arbeit?
Sie untersuchen die Schwierigkeit, die systematische Vernichtung und das Leid der Opfer angemessen darzustellen, ohne die Zeugenrolle zu verletzen.
Welche Rolle spielt die Erzähltechnik bei Seghers?
Durch den Wechsel der Tempusformen und Perspektiven zwischen Gegenwart und Vergangenheit wird die Unausweichlichkeit der Geschichte verdeutlicht.
- Arbeit zitieren
- Karsten Klein (Autor:in), 2020, Geträumte Geschichte. "Ausflug der toten Mädchen" von Anna Seghers und "Der Traum" von Vercors im Vergleich, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/584903