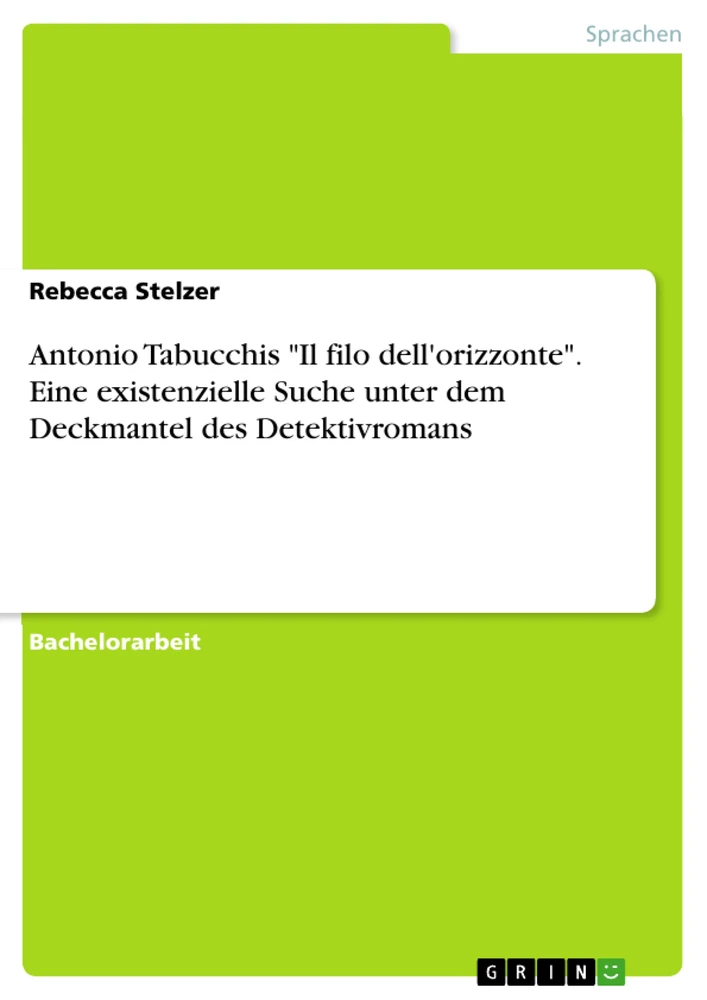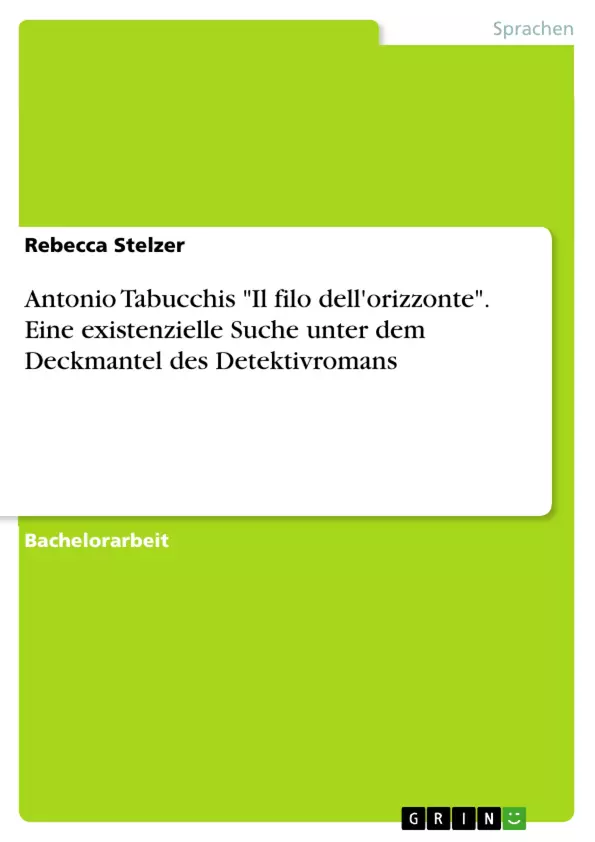Die vorliegende Arbeit untersucht wie in "Il filo dell'orizzonte" (1986) von Antonio Tabucchi (1943-2012) mit Gattungskonventionen des klassischen Detektivromans verfahren wird, Strukturen und Elemente gegebenenfalls modelliert und moduliert werden und mit welcher Funktionalisierung.
In diesem Zusammenhang wird vermutet, dass Gattungsstrukturen in "Il filo" genutzt werden, um zunächst die eigentliche Intention des Textes zu verbergen, wobei auch hier nach der Funktion zu fragen ist. Um dies untersuchen zu können, muss zunächst festgelegt werden, wie der begriffliche und inhaltliche Rahmen eines klassischen Detektivromans abzustecken ist. Dafür wird zu Beginn der Arbeit der „klassische“ Detektivroman definiert (Kapitel II.1) und dessen gattungstypische Strukturen und Elemente (Kapitel II.2) angeführt, um diese für die Untersuchung von "Il filo"(Kapitel III) als Kriterien heranziehen zu können. Dabei wird insbesondere der typische Handlungsaufbau erläutert, den es in der Analyse mit "Il filo" zu vergleichen gilt. Da die Handlung im vorliegenden Werk vorrangig den Unternehmungen des Protagonisten folgt, werden Parallelen und Abweichungen vom typischen Schema insbesondere anhand seiner Schritte und Vorgehensweise aufgezeigt. Des Weiteren werden Erzählstrategien des klassischen Detektivromans (Kapitel II.2) mit denen in "Il filo" verglichen, um deren spezifische Umsetzung und Funktionalisierung im vorliegenden Werk herausstellen zu können.
Innerhalb der Untersuchung des Werkes (Kapitel III) werden die vorab formulierten Fragen anhand eines Vergleiches der Kriterien des klassischen Detektivromans mit denen in "Il filo" beantwortet. Abschließend werden die Ergebnisse der Analyse in einem Fazit zusammengefasst (Kapitel IV).
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Der klassische Detektivroman.
- II.1. Definition des klassischen Detektivromans
- II.2. Der Aufbau des klassischen Detektivromans.
- III. Eine Untersuchung von Il filo dell'orizzonte.
- III.1. Il filo dell'orizzonte - Ein klassischer Detektivroman?
- III.2. Von der Detektion zur existenziellen Suche
- IV. Fazit.......
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit Antonio Tabucchis Roman "Il filo dell'orizzonte" und analysiert dessen Verhältnis zum klassischen Detektivroman. Ziel ist es, zu untersuchen, inwiefern der Roman Gattungskonventionen des Detektivgenres übernimmt und gleichzeitig transformiert, um eine tiefere, existenzielle Ebene zu erschließen.
- Gattungskonventionen des klassischen Detektivromans
- Analyse des Handlungsaufbaus und der Erzählstrategien in "Il filo dell'orizzonte"
- Funktion des "Deckmantels" des Detektivromans für die Intention des Textes
- Die Transformation des Detektivromans in eine existenzielle Suche
- Der Einfluss von Tabucchis eigener Lebensgeschichte und seiner literarischen Intention auf das Werk
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext des Romans "Il filo dell'orizzonte" vor, beleuchtet Tabucchis eigene Aussagen zum Genre des Detektivromans und führt die Forschungsfrage ein. Kapitel II definiert den klassischen Detektivroman und untersucht dessen typische Strukturen und Elemente, um diese als Vergleichsbasis für die Analyse von "Il filo dell'orizzonte" zu nutzen. Kapitel III analysiert das Werk, indem es dessen Handlungsaufbau, Erzählstrategien und Figuren mit den Kriterien des klassischen Detektivromans vergleicht, um zu zeigen, wie Tabucchi mit Gattungskonventionen umgeht und welche Funktionen diese im Kontext des Romans erfüllen.
Schlüsselwörter
Antonio Tabucchi, Il filo dell'orizzonte, Detektivroman, klassischer Detektivroman, Gattungskonventionen, Handlungsaufbau, Erzählstrategie, existenzielle Suche, Deckmantel, literarische Intention, Analyse, Vergleich, Forschung.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Antonio Tabucchis „Il filo dell'orizzonte“?
Der Roman nutzt die Struktur eines Detektivromans, um eine tiefgreifende existenzielle Suche des Protagonisten nach Identität und Sinn darzustellen.
Ist das Buch ein klassischer Detektivroman?
Nur vordergründig. Die Arbeit untersucht, wie Tabucchi Gattungskonventionen moduliert, um die eigentliche Intention – die existenzielle Suche – hinter dem Genre-Deckmantel zu verbergen.
Welche Merkmale eines klassischen Detektivromans werden untersucht?
Die Arbeit analysiert den typischen Handlungsaufbau, Erzählstrategien und die Vorgehensweise des Ermittlers als Vergleichskriterien.
Was ist die Funktion des „Deckmantels“ in Tabucchis Werk?
Der Detektivroman dient als Rahmen, um den Leser in eine Geschichte zu führen, die sich letztlich von der Lösung eines Kriminalfalls hin zu philosophischen Fragen entwickelt.
Welche Rolle spielt die literarische Intention des Autors?
Tabucchis eigene Ansichten über das Genre und seine Lebensgeschichte beeinflussen, wie er die Detektion in eine Suche nach dem „Horizont“ transformiert.
Wie weicht der Protagonist vom typischen Schema eines Detektivs ab?
Seine Schritte und Vorgehensweisen folgen nicht nur der Logik der Spurensuche, sondern spiegeln seine innere Wandlung und persönliche Betroffenheit wider.
- Quote paper
- Rebecca Stelzer (Author), 2013, Antonio Tabucchis "Il filo dell'orizzonte". Eine existenzielle Suche unter dem Deckmantel des Detektivromans, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/585227